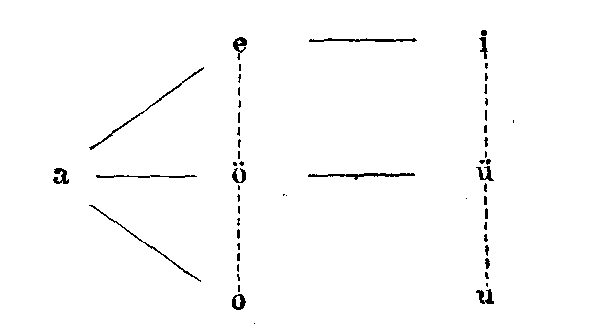
Zunächst ist indessen zu bemerken, daß man bisher im Allgemeinen geneigt war alle möglichen verschiedenen Eigentümlichkeiten der Klänge, welche nicht gerade deren Stärke und Tonhöhe betrafen, der Klangfarbe zuzuschreiben, was auch insofern richtig war, als der Begriff der Klangfarbe selbst eben nur negativ definiert werden konnte. Eine leichte Überlegung zeigt nun aber, daß manche von diesen Eigentümlichkeiten der Klänge von der Art und Weise abhängen, wie die Klänge anfangen und enden. Die Arten des Anklingens und Ausklingens sind ja zum Teil so charakteristisch, daß sie für die menschliche Stimme durch eine Reihe verschiedener Buchstaben bezeichnet werden. Es gehören hierher namentlich die explosiven Konsonanten B, D, G und P, T, K. Diese Buchstaben werden gebildet, indem entweder die verschlossene Mundhöhle geöffnet oder die geöffnete verschlossen wird. Bei B und P liegt der Verschluß zwischen den Lippen, bei D und T zwischen Zunge und Oberzähnen, bei G und K zwischen Zungenrücken und Gaumen. Die Reihe der Mediae B, D, G unterscheidet sich von der der Tenues P, T, K dadurch, daß bei ersteren die Stimmritze zur Zeit der Öffnung des Verschlusses schon hinreichend verengt ist, um tönen zu können, oder um wenigstens das Luftgeräusch der Flüsterstimme hervorzubringen, daß bei den Tenues dagegen die Stimmritze erweitert ist und nicht tönen kann. Die Mediae sind deshalb vom Stimmton begleitet; dieser kann sogar, wenn sie die Silbe anfangen, schon einen Augenblick vorher einsetzen, und wenn sie die Salbe schließen, noch einen Augenblick länger dauern, als die Öffnung des Mundes, weil etwas Luft auch noch in die verschlossene Mundhöhle eingetrieben werden und die Ansprache der Stimmbänder im Kehlkopfe unterhalten kann. Wegen der verengten Stimmritze ist der Zufluß der Luft mäßiger, das Luftgeräusch deshalb weniger scharf als bei den Tenues, welche mit geöffneter Stimmritze gesprochen werden, so daß eine große Menge Luft aus dem Brustkasten auf einmal hervorstürzen kann. Dabei wechselt sehr schnell die Resonanz der Mundhöhle, deren großen Einfluß wir später bei den Vokalen genauer kennen lernen werden, sowie die Tonhöhe, entsprechend der schnell veränderten Größe ihres Volumens und ihrer Öffnung, und dies bedingt einen entsprechend schnellen Wechsel der Klangfarbe des Stimmtons.
Wie bei diesen Buchstaben beruht auch der Unterschied des Klanges angeschlagener Saiten zum Teil auf der Schnelligkeit, mit der der Ton sich verliert. Wenn die Saiten wenig Masse haben (Darmsaiten) und auf einem leicht beweglichen Resonanzboden befestigt sind (wie an der Violine, Gitarre, Zither), oder wenn die Teile, auf die sie sich stützen oder die sie berühren, wenig elastisch sind (wenn z. B. die Violinsaiten mit der weichen Fingerspitze auf das Griffbrett gedrückt werden), so erlöschen ihre Schwingungen sehr schnell nach dem Anschlag, der Ton wird trocken, kurz und klanglos, wie beim Pizzicato der Violinen. Sind dagegen die Saiten von Metall, und deshalb von größerem Gewicht und starker Spannung, auf starken und schweren Stegen befestigt, die wenig erschüttert werden können, so geben sie ihre Schwingungen nur langsam an die Luft und den Resonanzboden ab; ihre Schwingungen halten länger an, ihr Klang wird dauernder und voller, wie beim Pianoforte, ist aber verhältnismäßig nicht so kräftig und durchdringend, wie bei gleich stark geschlagenen Saiten, welche den Ton schnell abgeben; daher das Pizzicato der Streichinstrumente, gut ausgeführt, viel durchdringender ist als ein Klavierton. Die Klaviere mit schweren und starken Widerlagen für die Saiten haben deshalb einen weniger durchdringenden, aber viel anhaltenderen Ton, als die mit leichteren Widerlagen bei gleicher Saitenstärke.
So liegt andererseits viel Charakteristisches darin, wie die Töne bei den Blechinstrumenten, der Trompete und Posaune, meist abgebrochen und schwerfällig einsetzen. Die verschiedenen Töne werden bei diesen Instrumenten dadurch erzeugt, daß man verschiedene Obertöne der Luftsäule durch verschiedenes Anblasen hervorbringt, wobei diese sich ähnlich einer Saite in schwingende Abteilungen von verschiedener Zahl und Länge teilt. Den neuen Schwingungszustand an Stelle des früheren hervorzurufen kostet immer eine etwas größere Anstrengung; ist er einmal eingetreten, so läßt er sich mit geringerer Kraft des Luftstromes unterhalten. Dagegen geschieht der Übergang von einem Ton zum andern sehr leicht bei den Holzblaseinstrumenten, Flöte, Oboe, Klarinette, wo die Luftsäule durch verschiedene Applicatur der Finger an die Seitenöffnungen und Klappen schnell ihre Länge ändern kann, und die Weise des Anblasens wenig zu ändern ist.
Diese Beispiele mögen genügen um zu zeigen, wie gewisse charakteristische Eigentümlichkeiten des Klanges mancher Instrumente abhängen von der Art, wie ihr Klang beginnt und wieder aufhört. Wenn wir im Folgenden von musikalischer Klangfarbe reden, sehen wir zunächst von diesen Eigentümlichkeiten des Anfangs und Endes ab, und berücksichtigen nur die Eigentümlichkeiten des gleichmäßig andauernden Klanges.
Aber auch wenn ein Klang mit gleicher oder veränderlicher Stärke andauert, mischen sich ihm bei den meisten Methoden seiner Erregung Geräusche bei als der Ausdruck kleinerer oder größerer Unregelmäßigkeiten der Luftbewegung. Bei den durch einen Luftstrom unterhaltenen Klängen der Blasinstrumente hört man meistenteils mehr oder weniger Sausen und Zischen der Luft, die sich an den scharfen Rändern der Anblaseöffnung bricht. Bei den mit dem Violinbogen gestrichenen tönenden Saiten oder Stäben und Platten hört man ziemlich viel Reibegeräusch des Bogens. Die Haare, mit denen dieser bespannt ist, sind wohl nie ganz frei von vielen, wenn auch sehr kleinen Unregelmäßigkeiten, der harzige Überzug ist nicht absolut gleichmäßig verbreitet, auch treten wohl kleine Ungleichmäßigkeiten in der Führung des Bogens durch den Arm, in der Stärke des Druckes ein, welche auf die Bewegung der Saite von Einfluß sind, so daß der Ton eines schlechten Instruments oder eines ungeschickten Spielers wegen dieser Unregelmäßigkeiten rauh, kratzend und veränderlich ausfällt. Über die Beschaffenheit der diesen Geräuschen entsprechenden Luftbewegungen und Gehörempfindungen können wir erst später sprechen, wenn wir den Begriff der Schwebungen erörtert haben. Gewöhnlich sucht man, wenn man Musik hört, diese Geräusche zu überhören, man abstrahiert absichtlich von ihnen, bei näherer Aufmerksamkeit jedoch hört man sie in den meisten durch Blasen und Streichen hervorgebrachten Klängen sehr deutlich. Bekanntlich werden auch viele Konsonanten der menschlichen Sprache durch solche anhaltende Geräusche charakterisiert, wie F, W, S, Sz, englisch Th, J, Ch. Bei einigen wird der Klang durch Zitterungen der Mundteile noch unregelmäßiger gemacht, wie beim R und L. Beim R wird der Luftstrom durch Zittern des weichen - Gaumens oder der Zungenspitze periodisch ganz unterbrochen, und wir bekommen dadurch einen intermittierenden Klang, dessen eigentümliche knarrende Beschaffenheit eben durch diese Intermissionen hervorgebracht wird. Beim L sind es die vom Luftstrom bewegten schlaffen seitlichen Zungenränder, welche zwar nicht vollständige Unterbrechungen, aber doch Schwankungen der Tonstärke hervorbringen.
Aber auch die Vokale der menschlichen Stimme sind nicht ganz frei von solchen Geräuschen, wenn sie auch neben dem musikalischen Teile des Stimmtons mehr zurücktreten. Auf diese Geräusche hat Donders zuerst aufmerksam gemacht; es sind zum Teil dieselben, welche beim leisen, tonlosen Sprechen für die entsprechenden Vokale hervorgebracht werden. Am stärksten sind sie beim I, Ü, U, und bei diesen Vokalen kann man sie auch laut sprechend leicht hörbar machen; durch einfache Verstärkung derselben geht der Vokal I in den Konsonanten J, und der Vokal U in das englische W über. Bei A, Ä, E, O scheinen mir die Geräusche des leisen Sprechens nur in der Stimmritze hervorgebracht zu werden, und beim lauten Sprechen in den Stimmton aufzugehen. Bemerkenswert ist aber daß man beim Sprechen die Vokale A, A und JE in einer tonloseren Weise hervorbringt als beim Singen, indem man unter dem Gefühl stärkerer Pressung im Kehlkopf statt des klangvollen Stimmtons einen mehr knarrenden Ton herausbringt, bei welchem eine deutlichere Artikulation möglich ist. Es scheint hier die Verstärkung des Geräusches die Charakterisierung des besonderen Vokalklanges zu erleichtern. Beim Singen sucht man dagegen den musikalischen Teil des Klanges zu begünstigen, wobei die Artikulation etwas undeutlicher wird.
Wenn nun aber auch in den begleitenden Geräuschen, also in den kleinen Unregelmäßigkeiten der Luftbewegung, viel Charakteristisches für die Klänge der musikalischen Instrumente und für die verschiedener Mundstellung entsprechenden menschlichen Stimmtöne liegt, so bleiben doch auch noch genug Eigentümlichkeiten der Klangfarbe übrig, die an dem eigentlich musikalischen Teile des Klanges, an dem vollkommen regelmäßigen Teile der Luftbewegung haften. Wie wichtig diese letzteren sind, kann man namentlich erkennen, wenn man musikalische Instrumente und menschliche Stimmen ans solcher Entfernung hört, wo die verhältnismäßig schwachen Geräusche nicht mehr hörbar sind. Trotzdem diese mangeln, bleibt es in der Regel möglich, die verschiedenen musikalischen Instrumente von einander zu unterscheiden, wenn auch allerdings unter solchen Umständen einmal einzelne Horntöne mit Gesang, oder ein Violoncell mit einem Harmonium verwechselt werden kann. Bei der menschlichen Stimme verlieren sich in der Entfernung zuerst die Konsonanten, welche durch Geräusche charakterisiert sind, während M, N und die Vokale noch in großer Entfernung erkennbar bleiben. M und N sind den Vokalen dadurch ähnlich gebildet, daß in keinem Teile der Mundhöhle ein Luftgeräusch gebildet wird, diese vielmehr vollkommen geschlossen ist, und der Stimmton durch die Nase entweicht. Der Mund bildet nur eine Resonanzhöhle, die den Klang verändert. Bei recht stillem Wetter ist es interessant, von hohen Bergen herab die Stimmen der Menschen aus der Ebene zu belauschen. Worte sind dann nicht mehr erkennbar, oder höchstens solche, welche aus M, N und bloßen Vokalen zusammengesetzt sind, wie Mama, Nein. Aber die in den gesprochenen Worten enthaltenen Vokale unterscheidet man leicht und deutlich. Sie folgen sich in seltsamem Wechsel und wunderlich erscheinenden Tonfällen, weil man sie nicht mehr zu Worten und Sätzen zu verbinden weiß.
Wir wollen in dem vorliegenden Abschnitte zunächst von allen unregelmäßigen Teilen der Luftbewegung, vom Ansetzen und Abklingen, des Schalles absehen und nur auf den eigentlich musikalischen Teil des Klanges, welcher einer gleichmäßig anhaltenden, regelmäßig periodischen Luftbewegung entspricht, Rücksicht nehmen, und die Beziehungen zu ermitteln suchen zwischen dessen Zusammensetzung aus einzelnen Tönen und der Klangfarbe. Was von den Eigentümlichkeiten der Klangfarbe hierher gehört, wollen wir kurz die musikalische Klangfarbe nennen.
Die Aufgabe des vorliegenden Abschnittes wird es nun sein, die verschiedene Zusammensetzung der Klänge, wie sie von verschiedenen musikalischen Instrumenten hervorgebracht werden, zu beschreiben, um daran nachzuweisen, wie ein verschiedener Charakter in der Kombination der Obertöne gewissen charakteristischen Abarten der Klangfarbe entspricht. Es stellen sich dabei gewisse allgemeine Regeln heraus für diejenigen Anordnungen der Obertöne, welche den in der Sprache als weich, scharf, schmetternd, leer, voll oder reich, dumpf, hell u. s. w. unterschiedenen Arten der Klangfarbe entsprechen. Abgesehen von dem hier zunächst vorliegenden Zwecke die physiologischen Tätigkeiten des Ohres genauer bestimmen zu können, welche zur Unterscheidung der Klangfarbe fuhren, ein Geschäft, welches dem nächstfolgenden Abschnitte vorbehalten bleibt, sind die Ergebnisse dieser Untersuchung auch deshalb für die Beantwortung rein musikalischer Fragen in späteren Abteilungen dieses Buches von Wichtigkeit, weil sie uns lehren, wie reich im Allgemeinen die musikalisch gut zu verwendenden Klangfarben an Obertönen sind, und welche Eigentümlichkeiten der Klangfarben an solchen musikalischen Instrumenten begünstigt werden, deren Klangfarbe einigermaßen der Willkür des Erbauers überlassen ist.
Da die Physiker über diesen Gegenstand noch verhältnismäßig wenig gearbeitet haben, werde ich gezwungen sein, etwas tiefer auf die Mechanik der Tonerzeugung mehrerer Instrumente einzugehen, als es vielleicht manchem meiner Leser angenehm sein wird. Ein solcher findet die Hauptresultate am Ende dieses Abschnittes zusammengestellt. Andererseits muß ich um Nachsicht bitten, wenn ich in diesem fast ganz neuen Gebiete große Lücken bestehen lassen muß, und mich hauptsächlich auf diejenigen Instrumente beschränke, deren Wirkungsweise so weit bekannt ist, daß wir einen einigermaßen genügenden Einblick in die Entstehung ihrer Klänge gewinnen können. Es liegt hier noch reiches Material für interessante akustische Arbeiten vor; ich selbst mußte mich damit begnügen, hier so viel zu leisten, als für den Fortgang der Untersuchung nötig war.
l. Klänge ohne Obertöne.
Wir beginnen mit denjenigen Klängen, welche nicht zusammengesetzt
sind, sondern nur aus einem einfachen Tone bestehen. Am reinsten und leichtesten
werden solche hervorgebracht, wenn eine Stimmgabel, angeschlagen, vor die
Mündung einer Resonanzröhre gebracht wird, wie es im vorigen
Abschnitte schon beschrieben worden ist1). Es sind diese Töne
ungemein weich, frei von allem Scharfen und Rauhen; sie scheinen, wie schon
früher angeführt ist, verhältnismäßig tief zu
liegen, so daß schon die, welche ihrer Tonhöhe nach den tiefen
Tönen einer Baßstimme entsprechen, den Eindruck einer ganz besonderen
und ungewöhnlichen Tiefe machen; die Klangfarbe solcher tiefen einfachen
Töne ist auch ziemlich dumpf. Die einfachen Töne der Sopranlage
klingen hell, aber auch die den höchsten Soprantönen entsprechenden
sind sehr weich, ohne eine Spur von der schneidenden oder gellenden Schärfe,
welche diese Töne auf den meisten Instrumenten zeigen mit Ausnahme
etwa der Flöte, deren Klänge den einfachen Tönen ziemlich
nahe stehen, indem sie wenige und schwache Obertöne haben. Unter den
menschlichen Stimmlauten kommt das V diesen einfachen Tönen
am nächsten, doch ist auch dieser. Vokal nicht ganz frei von Obertönen.
Vergleicht man die Klangfarbe eines solchen einfachen Tones mit der eines
zusammengesetzten Klanges, dem sich die niedrigeren harmonischen Obertöne
anschließen, so hat der letztere etwas klangvolleres, metallischeres
und glänzenderes neben dem einfachen Tone. Selbst schon der Vokal
U der menschlichen Stimme, obgleich er unter allen der dumpfeste
und klangloseste ist, klingt merklich glänzender und weniger dumpf
als ein gleich hoher einfacher Ton. Wenn wir die Reihe der sechs ersten
Partialtöne eines zusammengesetzten Klanges überblicken, so können
wir letzteren in musikalischer Beziehung als einen Dur-Akkord mit überwiegend
starkem Grundton betrachten, und wirklich hat auch ein solcher Klang, zum
Beispiel ein schöner Gesangton, neben einem einfachen Tone in der
Klangfarbe ganz deutlich etwas von der angenehmen Wirkung eines harmonischen
Akkordes.
Einfache Töne, die nur von einem Luftreibegeräusch begleitet sind, kann man auch erhalten, wie oben erwähnt ist, wenn man bauchige Flaschen anblast. Wenn man von der Luftreibung abstrahiert, so ist die eigentlich musikalische Klangfarbe dieser Töne wirklich dieselbe, wie die der Stimmgabeltöne.
2. Klänge mit unharmonischen Obertönen.
An diese Töne ohne Obertöne schließen sich zunächst solche Klänge an, deren Nebentöne unharmonisch zum Grundtone sind, und welche deshalb, unserer Definition entsprechend, strenge genommen nicht zu den musikalischen Klängen gerechnet werden können. Sie werden auch nur ausnahmsweise in der künstlerischen Musik gebraucht und, wo es geschieht, nur in solcher Anschlagsweise, daß der Grundton die Nebentöne an Stärke bei weitem übertrifft, so daß deren Existenz vernachlässigt werden kann. Daher stelle ich sie hier unmittelbar hinter die einfachen Töne, weil sie musikalisch nur in Betracht kommen, insofern sie mehr oder weniger gut einfache Töne darstellen. Zunächst gehören die Stimmgabeln selbst hierher, wenn man sie anschlägt, und dann auf einen Resonanzboden setzt, oder dem Ohre sehr nahe bringt. Die Obertöne der Stimmgabeln liegen sehr hoch; der erste machte bei den von mir untersuchten Gabeln 5,8 bis 6,6 so viel Schwingungen als der Grundton, liegt also zwischen der dritten verminderten Quinte und großen Sext des Grundtones. Die Schwingungszahlen dieser hohen Obertöne verhalten sich zu einander wie die Quadrate der ungeraden Zahlen. In der Zeit, wo der erste angeführte Oberton 3 × 3 = 9 Schwingungen macht, machen die folgenden 5 × 5 = 25, 7 × 7 = 49 etc. Schwingungen. Ihre Höhe steigt also außerordentlich schnell, und sie sind in der Regel alle unharmonisch zum Grundton, einzelne von ihnen können aber durch Zufall auch harmonisch werden. Nennen wir den Grundton der Stimmgabel c, so sind die folgenden Töne etwa asII, dIV, cisV. Diese hohen Nebentöne bewirken neben dem Grundtone ein helles unharmonisches Klingen, welches auch leicht beim Anschlagen der Gabel aus weiterer Entfernung gehört wird, während man den Grundton nur hört, wenn man die Gabel dicht an das Ohr bringt. Das Ohr trennt den Grundton leicht von den Obertönen, und hat keine Neigung beide zu verschmelzen. Die hohen Töne verklingen gewöhnlich schnell, während der Grundton lange stehen bleibt. Übrigens ist zu bemerken, daß das Verhältnis der Stimmgabeltöne zu einander etwas verschieden ist nach der Form der Gabel, und. die gemachten Angaben deshalb nur als annähernd betrachtet werden dürfen. Bei der theoretischen Bestimmung der höheren Töne kann jede Zinke der Stimmgabel als ein an einem Ende fester Stab betrachtet werden.
Ähnlich verhält es sich mit den geraden elastischen Stäben; auch diese geben, wie schon angeführt wurde, beim Anschlagen ziemlich hohe unharmonische Obertöne. Wenn man solche Stäbe an der Stelle der beiden Knotenlinien ihres Grundtons auf einer Unterlage festhält, so begünstigt man dadurch allerdings das Fortklingen des Grundtones vor allen anderen höheren Tönen, und die höheren Töne stören wenig, weil sie schnell nach dem Anschlagen erlöschen; aber zur eigentlich künstlerischen Musik bleiben solche Stäbe trotzdem wenig anwendbar, obgleich man sie in der Militär- und Tanzmusik ihres durchdringenden Tones wegen neuerdings verwendet hat. Früher hat man auch Glasstäbe und Holzstäbe ähnlich verwendet, zur Glasstabharmonika und Strohfiedel oder Holzharmonika. Die Stäbe werden zwischen zwei Paar zusammengedrehter Schnüre ein geschoben, so daß sie zwischen diese am Orte der beiden Knotenlinien des Grundtones eingeklemmt sind. Die Holzstäbe der Strohfiedel ließ man auch einfach auf Strohzylindern ruhen. Sie werden mit hölzernen oder Korkhämmern geschlagen.
Das Material der Stäbe hat auf die Klangfarbe hierbei wohl nur dadurch Einfluß, daß es mehr oder weniger lange die Töne verschiedener Höhe nachklingen läßt. Am längsten pflegen die Töne, namentlich auch die hohen, in elastischem Metall von feinem gleichmäßigem Gefüge nachzuklingen, weil dies durch seine große Masse ein größeres Bestreben hat in der einmal angenommenen Bewegung zu verharren, und weil wir unter den Metallen beim Stahl, den besseren Kupferzink- und Kupferzinnlegierungen auch die vollkommenste Elastizität finden. Bei den schwach legierten edlen Metallen wird das Beharren des Klanges trotz der geringeren Elastizität durch die große Schwere gesteigert. Die vollkommenere Elastizität scheint besonders das Fortbestehen der höheren Töne zu begünstigen, da schnellere Schwingungen im Allgemeinen durch unvollkommene Elastizität und durch Reibung schneller gedämpft werden als langsamere Schwingungen. Das allgemeine Kennzeichen dessen, was man metallische Klangfarbe zu nennen pflegt, glaube ich deshalb dadurch bezeichnen zu können, daß verhältnismäßig hohe Obertöne anhaltend und in gleichmäßigem Flusse mitklingen. Die Klangfarbe des Glases ist ähnlich; aber da man ihm nicht starke Erschütterungen zumuten darf, bleibt der Ton immer schwach und zart, auch ist er verhältnismäßig hoch und verklingt schneller, wegen der geringeren Masse des schwingenden Körpers. Beim Holz dagegen ist die Masse gering, die innere Struktur verhältnismäßig grob, mit zahllosen kleinen Hohlräumen erfüllt, die Elastizität verhältnismäßig unvollkommen, deshalb verklingen die Töne und namentlich die höheren Töne schnell. Eben deshalb aber ist die Strohfiedel vielleicht den Ansprüchen eines musikalischen Ohres mehr entsprechend, als die aus Stahlstäben oder Glasstäben gebildete Harmonika mit den gellenden unharmonischen Obertönen, so weit eben einfache Töne zur Musik geeignet sind, worüber später mehr.
Man braucht bei allen diesen Schlaginstrumenten Hämmer aus Holz oder Kork, überzieht diese auch wohl noch mit Leder; dadurch werden die höchsten Obertöne schwächer, als wenn man harte Metallhämmer nimmt. Letztere würden größere Diskontinuitäten in der anfänglichen Bewegung der Platte geben. Ich werde diesen Einfluß bei dem Anschlag der Saiten näher besprechen, wo er sich in ähnlicher Weise äußert.
Ebene elastische Scheiben, kreisförmig, oval, quadratisch,
rechteckig, dreieckig oder sechseckig geschnitten, können nach Chladni's
Entdeckung in einer großen Zahl verschiedener Formen schwingen und
dabei Töne geben, welche im Allgemeinen unharmonisch zu einander sind.
In Fig. 21 sind die
einfacheren Schwingungsformen einer kreisförmigen Scheibe dargestellt;
viel kompliziertere Schwingungsformen entstehen, wenn noch mehr Kreise
oder Durchmesser als Knotenlinien auftreten, oder Kreise sich mit Durchmessern
verbinden. Wenn die Schwingungsform A den Ton c gibt,
geben die anderen folgenden Töne:
| Anzahl der Knotenkreise |
|
|||||
| 0 | l | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 0 | c | D' | c" | g" - gis"' | ||
| 1 | gis | b' | g" | |||
| 2 | gis" + | |||||
Man sieht, wie viele einander verhältnismäßig nahe liegende Töne eine solche Scheibe gibt. So oft man die Scheibe anschlägt, erklingen alle diejenigen unter ihren Tönen, welche an der geschlagenen Stelle keinen Knotenpunkt haben. Das Auftreten von bestimmten einzelnen Tönen kann man indessen dadurch begünstigen, daß man die Scheibe in solchen Punkten unterstützt, die den Knotenlinien der gewünschten Töne angehören; dann verklingen alle diejenigen Töne schneller, die in den berührten Punkten keine Knotenlinien bilden können. Unterstützt man z. B. eine kreisförmige Scheibe in drei Punkten des Knotenkreises in Fig. 21 C, und schlugt genau im Mittelpunkt an, so erhält man den Ton der genannten Schwingungsform, der in unserer Tabelle gis genannt ist, und es werden alle Töne sehr schwach, unter deren Knotenlinien Durchmesser des Kreises sind2), also die Töne c, d', c", g", b' unserer Tabelle. Ebenso verklingt der Ton gis" mit zwei Knotenkreisen sogleich, weil die Unterstützungspunkte in einen seiner Schwingungsbäuche fallen, und es kann erst der Ton mit drei Knotenkreisen stärker mitklingen, dessen eine Knotenlinie der von Fig. 21 C ziemlich nahe kommt. Dieser ist drei Oktaven und mehr als einen ganzen Ton höher, als der Ton mit einem Knotenkreis und stört diesen nicht sehr wegen des großen Intervalls. Deshalb gibt ein solcher Anschlag der Scheibe einen ziemlich guten musikalischen Klang, während sonst im Allgemeinen der Klang der Scheiben, aus vielen unharmonischen und nahe an einander liegenden Tönen gemischt, hohl und kesselartig klingt, und musikalisch nicht brauchbar ist. Aber auch bei zweckmäßiger Unterstützung verklingt er gewöhnlich schnell, wenigstens wenn die Scheiben aus Glas bestehen, weil die Berührung mehrerer Punkte, selbst wenn es Knotenpunkte sind, die Freiheit der Schwingungen immer merklich beeinträchtigt.
2) Vorausgesetzt, daß die unterstützten Stellen nicht etwa in eines der Systeme gleich weit abstehender Durchmesser hinein passen.
Der Klang der Glocken ist ebenfalls von unharmonischen Nebentönen
begleitet, die aber nicht so nahe wie bei den ebenen Platten an einander
liegen. Die gewöhnlich eintretenden Schwingungsarten sind solche,
wo sich 4, 6, 8, 10 etc. Knotenlinien bilden, welche von dem Scheitelpunkte
nach dem Rande der Glocke in gleichen Abständen von einander herablaufen.
Die entsprechenden Töne sind bei Glasglocken, welche überall
ziemlich gleiche Dicke haben, nahehin den Quadraten der Zahlen 2, 3, 4,
5 proportional, also wenn wir den tiefsten c nennen:
| Zahl der Knotenlinien | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Töne ........ | c | d' | c" | gis'' | d'" |
Die Töne ändern sich aber, wenn die Wand der Glocke nach dem Rande zu dünner oder dicker wird, und es scheint ein wesentlicher Punkt in der Kunst des Glockengusses zu sein, daß man die tieferen Töne durch eine empirisch gefundene, passende Form der Glocke zu einander harmonisch machen kann. Nach Beobachtungen des Herrn Organisten Gleitz3) gibt die im Jahre 1477 gegossene Glocke des Domes zu Erfurt folgende Töne: E, e, gis, h, e', gis', h', cis". Die Glocke der Paulskirche in London gibt a und cis'; Hemony in Zütphen, ein Meister des 17ten Jahrhunderts, verlangte von einer guten Glocke drei Oktaven, zwei Quinten, eine große und eine kleine Terz. Der stärkste Ton ist nicht der tiefste; der Kessel der Glocken, angeschlagen, gibt tiefere Töne als der Schallring, letzterer dagegen die lautesten. Übrigens sind auch wohl noch andere Schwingungsformen der Glocke möglich, wobei sich Knotenkreise bilden, die dem Rande parallel sind, diese scheinen aber schwer zu entstehen, und sind noch nicht untersucht.
3) Geschichtliches über die große Glocke und die übrigen Glocken des Domes zu Erfurt. Erfurt 1867. Siehe auch Schafhäutl im Kunst- und Gewerbeblatt für das Königreich Bayern 1868, LIV, 325 bis 350, 385 bis 427.
Wenn eine Glocke nicht ganz symmetrisch in Beziehung auf ihre Achse ist, z. B. die Wand an einer Stelle ihres Umfanges etwas dicker als an anderen, so gibt die Glocke beim Anschlag im Allgemeinen zwei ein wenig von einander verschiedene Töne, die mit einander Schwebungen geben. Man findet vier um rechte Winkel von einander entfernte Stellen des Randes, wo nur der eine dieser Töne ohne Schwebungen hörbar wird, vier andere dazwischen liegende, wo nur der andere erklingt; wenn man irgend eine andere Stelle anschlägt, erklingen beide und geben die Schwebungen, welche man bei den meisten Glocken hört, wenn dieselben ruhig ausklingen.
Die gespannten Membranen geben wieder unharmonische Töne,
die einander ziemlich nahe liegen; diese würden für eine. kreisförmige
Membran nach der Tonhöhe geordnet, wenn der tiefste Ton c
ist, im luftleeren Raume folgende sein:
| Zahl der Khotenlinien |
|
|
| Durchmesser | Kreise | |
| 0 | 0 | c |
| l | 0 | as |
| 2 | 0 | cis' + 0,1 |
| 0 | l | d' + 0,2 |
| l | l | g' - 0,2 |
| 0 | 2 | b' + 0,1 |
Diese Töne verklingen sehr schnell. Tönen die Membranen in Luft4) oder werden sie mit einem Luftraume verbunden, wie in der Pauke, so wird dadurch das Verhältnis, der Töne abgeändert. Nähere Untersuchungen über die Beitöne des Paukentones fehlen noch. Die Pauke wird zwar in der künstlerischen Musik gebraucht, aber doch nur, um einzelne Akzente zu geben; man stimmt sie zwar ab, aber nicht, um durch ihren Ton die Akkorde zu füllen, sondern nur, damit sie nicht störend in die übrige Harmonie einfalle.
Man kann die genannten Körper mit unharmonischen Klängen auch durch den Violinbogen in Tönung bringen und dabei durch passende Dämpfung in den Knotenlinien des gewünschten Tones die nächsten Nebentöne beseitigen. Es klingt dann der eine Ton kräftig über alle anderen hervor und wäre also eher musikalisch zu brauchen; aber der Violinbogen gibt auf allen diesen Körpern mit unharmonischen Obertönen, Stimmgabeln, Platten, Glocken, ein heftig kratzendes Geräusch, und bei der Untersuchung mit den Resonanzröhren zeigt sich, daß dieses Geräusch hauptsächlich durch die unharmonischen Nebentöne der Platte gebildet ist, welche in kurzen unregelmäßigen Stößen hörbar werden. Daß intermittierende Töne den Eindruck des Knarrens oder Kratzens geben, ist schon früher erwähnt. Nur wenn der vom Bogen erregte Körper harmonische Obertöne hat, kann er sich jedem Bewegungsanstoß, den der Bogen ihm mitteilt, vollständig fügen, und gibt einen vollständig musikalischen Ton. Das beruht darin, daß eben jede beliebige periodische Bewegung, wie sie der Bogen hervorzubringen strebt, aus den Bewegungen, die den harmonischen Obertönen entsprechen, zusammengesetzt werden kann, aber nicht aus anderen unharmonischen Schwingungsbewegungen.
3. Klänge der Saiten.
Wir gehen nun über zur Analyse der eigentlich musikalischen Klänge, welche durch harmonische Obertöne charakterisiert sind. Wir können sie am besten einteilen nach der Art, wie der Ton erregt wird, in solche, die l) entweder durch Anschlag, 2) oder durch den Bogen, 3) oder durch Blasen gegen eine scharfe Kante, 4) durch Blasen gegen elastische Zungen zum Tönen kommen. Die beiden ersten Klassen umfassen allein Saiteninstrumente, da die Saiten außer den musikalisch nicht gebrauchten longitudinal schwingenden Stäben die einzigen festen elastischen Körper sind, welche reine harmonische Obertöne geben. In die dritte Klasse gehören die Flöten und die Flötenwerke der Orgel, in die vierte die übrigen Blasinstrumente und die menschliche Stimme.
Saiten durch Anschlag erregt. Von den jetzt gebräuchlichen musikalischen Instrumenten gehören hierher das Fortepiano, die Harfe, Gitarre, Zither, von den physikalischen das Monochord, eingerichtet zur genaueren Untersuchung der Gesetze der Saitenschwingungen; auch ist das Pizzicato der Streichinstrumente hierher zu rechnen. Daß die geschlagenen und gerissenen Saiten Klänge mit einer großen Menge von Obertönen geben, ist schon früher erwähnt worden. Für die gerissenen Saiten haben wir den Vorteil, eine ausgebildete Theorie ihrer Bewegung zu besitzen, aus der sich die Stärke ihrer Obertöne unmittelbar ergibt. Schon im vorigen Abschnitte haben wir einen Teil der Folgerungen aus dieser Theorie mit der Erfahrung verglichen und als damit übereinstimmend gefunden. Eine ebenso vollständige Theorie läßt sich für den Fall aufstellen, wo eine Saite mit einem harten scharfkantigen Körper in einem ihrer Punkte geschlagen worden ist. Weniger einfach ist das Problem, wenn weiche elastische Hämmer, wie die des Klaviers, die Saite treffen, doch läßt sich auch in diesem Fall für die Bewegung der Saite eine Theorie geben, welche wenigstens die wesentlichsten Züge des Vorganges umfaßt und über die Stärke der Obertöne Rechenschaft gibt 5).
2) von der Stelle des Anschlags,
3) von der Dicke, Steifigkeit und Elastizität der Saite.
6) Wenn hier von Intensität die Rede ist,
so ist sie immer objektiv gemessen, nämlich durch die lebendige
Kraft oder das mechanische Arbeitsäquivalent der entsprechenden
Bewegung.
Man kann sich an jedem Fortepiano, dessen Deckel man öffnet, von der Richtigkeit des Gesagten leicht überzeugen. Wenn man eine der Tasten durch ein aufgesetztes Gewicht herabdrückt, wird die entsprechende Saite von ihrem Dämpfer frei, und man kann sie nun nach Belieben mit dem Finger oder mit einem Stift reißen, mit einem metallenen Stift oder mit dem Pianofortehammer schlagen. Man erhält dabei ganz verschiedene Klangarten. Wenn man mit hartem Metall reißt oder schlägt, ist der Ton scharf und klimpernd, und man hört bei einiger Aufmerksamkeit leicht eine große Menge sehr hoher Töne darin. Diese fallen weg, der Klang der Saite wird weniger hell, weicher und wohlklingender, wenn man mit dem weichen Finger reißt oder mit dem weichen Hammer des Instruments anschlägt. Auch die verschiedene Stärke des Grundtons erkennt man leicht. Wenn man mit Metall schlägt, hört man ihn kaum; der Klang hört sich dem entsprechend ganz leer an. Die Eigentümlichkeit des Klanges nämlich, welche wir mit dem Namen der Leerheit belegen, entsteht, wenn die Obertöne verhältnismäßig zu stark gegen den Grundton sind. Am vollsten hört man den Grundton, wenn man mit dem weichen Finger die Saite zupft, wobei der Ton voll und doch harmonisch klingend ist. Der Anschlag mit dem Pianofortehammer gibt wenigstens in den mittleren und tieferen Oktaven des Instruments den Grundton nicht so voll, wie das Reißen der Saite.
Hierin ist der Grund zu suchen, warum es vorteilhaft ist, die Pianofortehammer mit dicken Lagen stark gepreßten und dadurch elastisch gewordenen Filzes zu überziehen. Die äußersten Lagen sind die weichsten und nachgiebigsten, die tieferen sind fester. Die Oberfläche des Hammers legt sich ohne hörbaren Stoß der Saite an, die tieferen Lagen geben namentlich die elastische Kraft, durch welche der Hammer wieder von der Saite zurückgeworfen wird. Nimmt man einen Klavierhammer heraus und läßt ihn kräftig gegen eine Tischplatte oder gegen die Wand schlagen, so springt er auch von solchen unnachgiebigen Flächen zurück, wie ein Kautschukball. Je schwerer der Hammer und je dicker die Filzlagen sind, was namentlich bei den Hämmern der tieferen Oktaven der Fall ist, desto länger muß es währen, ehe er von der Saite abspringt. Die Hämmer der höheren Oktaven pflegen leichter zu sein und dünnere Filzlagen zu haben. Offenbar haben die Erbauer der Instrumente durch die Praxis hier gewisse Verhältnisse allmählich ausgefunden, wie die Elastizität des Hammers dem Tone der Saite sich am besten anpaßt. Die Beschaffenheit des Hammers hat einen außerordentlich großen Einfluß auf die Klangfarbe. Die Theorie ergibt, daß diejenigen Obertöne beim Anschlage besonders begünstigt werden, deren halbe Schwingungsdauer nahe gleich ist der Zeit, während welcher der Hammer anliegt, daß dagegen diejenigen verschwinden, deren halbe Schwingungsdauer 3,5,7 etc. Mal so groß ist.
Im Allgemeinen wird es vorteilhaft sein, namentlich bei den tieferen Tönen, daß aus der Reihe der Obertöne diejenigen wegfallen, welche einander zu nahe liegen, um einen guten Zusammenklang zu geben, was etwa vom siebenten oder achten an der Fall ist. Die von noch höherer Ordnungszahl sind an sich schon verhältnismäßig schwach. An einem neuen Flügel der Herren Steinway von New-York, der sich durch die Gleichmäßigkeit seiner Klangfarbe auszeichnet, finde ich, daß die durch die Dauer des Schlags bedingte Dämpfung in den tieferen Lagen auf den neunten oder zehnten Partialton fällt, in den höheren Lagen dagegen sind schon der vierte und fünfte durch den Anschlag des Hammers kaum noch hervorzubringen, während sie beim Reißen mit dem Fingernagel deutlich hörbar werden. Bei einem älteren und viel gebrauchten Flügel dagegen, der ursprünglich die Hauptdämpfung in der Gegend des siebenten bis fünften Partialtons in den mittleren und tiefen Lagen zeigte, sind jetzt der neunte bis dreizehnte Ton stark entwickelt, was auf härter gewordene Hämmer schließen läßt, und dem Klange jedenfalls nur nachtheilig sein kann. Beobachtungen über diese Verhältnisse lassen sich nach der auf Seite 90 erwähnten Methode gut in der Weise anstellen, daß man die Fingerspitze leicht auf einen der Knotenpunkte desjenigen Tons legt, dessen Stärke man ermitteln will, und dann mittels der Taste den Hammer zum Anschlage bringt. Indem man für den berührenden Finger diejenige Stelle sucht, wo der gewünschte Ton am reinsten herauskommt und am längsten nachklingt, kann man die Stelle des Knotenpunkts leicht ganz genau finden. Die Knotenpunkte, welche der Anschlagsstelle des Hammers sehr nahe liegen, sind allerdings meist durch den Dämpfer gedeckt; aber die betreffenden Töne sind aus einem gleich zu besprechenden Grunde doch verhältnismäßig schwach. Übrigens spricht der fünfte Ton auch gut an, wenn man um zwei Fünftel vom Ende entfernt berührt, und der siebente in 2/7 der Saitenlänge. Diese letzteren Stellen sind aber frei vom Dämpfer. Überhaupt findet man alle bei der gebrauchten Anschlagsweise der Saite zum Vorschein kommenden Partialtöne, wenn man immer wiederholt anschlägt, und den berührenden Finger dabei allmählich über die Länge der Saite verschiebt, wobei namentlich die Berührung des kürzeren Endes der Saite zwischen dem Anschlagsende und dem Steg die musikalisch nicht wünschenswerten höheren Obertöne vom neunten bis zum sechzehnten hören läßt.
Wie sich die Stärke der einzelnen Obertöne berechnet, wenn die Anschlagsdauer des Hammers gegeben ist, wird weiter unten mitgeteilt werden.
Der zweite Umstand, welcher auf die Zusammensetzung des Klanges Einfluß hat, ist die Anschlagsstelle. Es ist schon im vorigen Abschnitte bei der Prüfung des von Ohm für die Analyse der Klänge durch das Ohr aufgestellten Gesetzes bemerkt worden, daß sowohl im Klange gerissener als geschlagener Saiten diejenigen Obertöne fehlen, welche am Orte des Anschlags einen Knotenpunkt haben. Umgekehrt sind diejenigen anderen verhältnismäßig am stärksten, welche an der geschlagenen Stelle ein Schwingungsmaximum haben. Überhaupt, wenn man dieselbe Art des Anschlags nach einander bei verschiedenen Punkten der Saite anwendet, wachsen die einzelnen Obertöne oder nehmen ab in demselben Verhältnisse, wie die Schwingungsstärke der entsprechenden einfachen Schwingung der Saite an den betreffenden Punkten ihrer Länge größer oder kleiner ist. So kann denn die Zusammensetzung des Saitenklanges mannigfach abgeändert werden, indem man nichts tut, als den Ort des Anschlags ändern.
Schlägt man die Saite z. B. gerade in ihrer Mitte, so fällt ihr zweiter Ton fort, dessen einziger Knotenpunkt dort liegt. Der dritte Ton dagegen, dessen Knotenpunkte in 1/3 und 2/3 der Saitenlänge liegen, tritt kräftig heraus, weil die Anschlagsstelle in der Mitte dieser beiden Knotenpunkte liegt. Der vierte Ton hat seine Knotenpunkte in 1/4, 2/4 (= 1/2) und 3/4 der Saitenlänge. Er bleibt aus, weil die Anschlagsstelle mit seinem zweiten Knotenpunkte zusammenfällt; ebenso der sechste, achte, überhaupt alle geradzahligen Töne, während der fünfte, siebente, neunte und die anderen ungeradzahligen gehört werden. Durch das Ausbleiben der geradzahligen Töne erhält die Saite, in der Mitte angeschlagen, in der Tat eine eigentümliche Klangfarbe, die sich von dem gewöhnlichen Saitenklange wesentlich unterscheidet; sie klingt einigermaßen hohl oder näselnd. Der Versuch läßt sich leicht an jedem Pianoforte ausführen, nachdem man es geöffnet und den Dämpfer gehoben hat. Die Mitte der Saite findet man schnell hinreichend genau, indem man die Stelle sucht, wo man mit dem Finger die Saite leise berühren muß, um beim Anschlag den ersten Oberton rein und klingend zu erhalten.
Schlägt man in 1/3 der Saitenlänge an, so fällt der dritte, sechste, neunte u. s. w. Ton fort. Auch dies gibt dem Klange etwas Hohles, obgleich viel weniger als der Anschlag in der Mitte. Wenn man mit der Anschlagsstelle dem Ende der Saite sehr nahe rückt, so wird das Hervortreten sehr hoher Obertöne auf Kosten des Grundtons und der niederen Obertöne begünstigt, der Klang der Saite wird dadurch leer und klimpernd.
In den Pianofortes ist bei den mittleren Saiten die Anschlagsstelle auf 1/7 bis 1/9 der Saitenlänge verlegt; wir müssen annehmen, daß diese Stelle hauptsächlich deshalb so gewählt ist, weil sie erfahrungsgemäß den musikalisch schönsten und für harmonische Verbindungen brauchbarsten Klang liefert. Es hat dazu keine Theorie geleitet, sondern allein das Bedürfnis des künstlerisch gebildeten Ohres und die technische Erfahrung zweier Jahrhunderte. Es ist deshalb die Untersuchung der Zusammensetzung des Klanges bei dieser Anschlagsstelle von besonderem Interesse. Ein wesentlicher Vorzug für die Wahl dieser Stelle scheint darin zu liegen, daß der siebente und neunte Partialton des Klanges wegfallen oder mindestens sehr schwach werden. Es sind diese Töne die ersten in der Reihe, welche dem Durdreiklange des Grundtons nicht angehören. Bis zum sechsten Tone haben wir nur Oktaven, Quinten und große Terzen des Grundtons, der siebente ist nahehin eine kleine Septime, der neunte die große Sekunde des Grundtons. Diese passen also in den Durdreiklang nicht hinein. In der Tat kann man sich an den Pianofortes leicht überzeugen, daß, während es leicht ist, unter Berührung entsprechender Knotenpunkte die sechs ersten Töne wenigstens auf den Saiten der mittleren und unteren Oktaven des Instruments durch Anschlag der Taste hören zu lassen, es nicht gelingt den siebenten, achten und neunten Ton hervorzubringen, oder dieselben wenigstens sehr unvollkommen und schwach hervortreten. Die Schwierigkeit beruht hier nicht in der Unfähigkeit der Saite, so kurze schwingende Abteilungen zu bilden; denn wenn man, statt die Taste anzuschlagen, die Saite näher nach ihrem Ende hin mit dem Finger reißt und die betreffenden Knotenpunkte dämpft, bekommt man den siebenten, achten, neunten, ja selbst den zehnten und elften Partialton noch sehr gut und klingend. Erst in den höheren Oktaven werden die Saiten zu kurz und steif, um noch hohe Obertöne bilden zu können. Dort pflegen manche Instrumentenmacher die Anschlagsstelle auch näher dem Ende zu wählen, wodurch ein hellerer und durchdringenderer Klang dieser hohen Saiten erzielt wird. Deren Obertöne, welche wegen der Steifigkeit schon schwer ansprechen, werden in solchem Falle durch diese Wahl der Anschlagsstelle dem Grundton gegenüber begünstigt. Einen ähnlich helleren, aber auch dünneren und leeren Klang erhält man, wenn man einer der tieferen Saiten einen Steg näher der Anschlagsstelle unterlegt, so daß der Hammer die Saite jetzt in einem Punkte trifft, der um weniger als 1/7 ihrer Länge von ihrem einen Ende entfernt ist.
Während man einerseits den Klang klimpernder, schärfer und spitzer machen kann, indem man die Saite mit härteren Körpern schlägt, so kann man andererseits den Ton auch dumpfer machen, d. h. den Grundton über die Obertöne überwiegen machen, wenn man mit einem weichen und schweren Hammer schlägt, z. B. mit einem kleinen eisernen Hammer, dessen Schlagfläche mit einer Kautschukplatte überzogen ist. Namentlich die Saiten der tieferen Oktaven geben dann einen viel volleren, aber dumpfen Klang. Um hierbei die verschiedenen Klänge der Saite vergleichen zu können, die der verschiedenen Beschaffenheit des Hammers entsprechen, muß man aber darauf achten, daß man immer in derselben Entfernung von einem beider Enden anschlägt, wie der Hammer des Instruments; sonst vermischen sich damit die Änderungen des Klanges, welche von der Lage der Anschlagsstelle abhängen. Diese Umstände sind den Instrumentenmachern natürlich bekannt, da sie ja selbst schon teils schwerere und weichere Hämmer für die tiefen Oktaven, teils leichtere und weniger weiche für die hohen Oktaven gewählt haben. Wenn sie aber denn doch bei einem gewissen Maße der Hämmer stehen geblieben sind und diese nicht weiter in der Weise abgeändert haben, daß die Stärke der Obertöne noch mehr beschränkt wird, so beweist dies klar, daß das musikalisch gebildete Ohr einen mit Obertönen in gewisser Stärke ausgestatteten Klang bei einem Instrumente, welches für reiche Harmonie Verbindungen bestimmt ist, vorzieht. In dieser Beziehung ist die Zusammensetzung des Klanges der Klaviersaiten von großem Interesse für die ganze Theorie der Musik. Bei keinem anderen Instrumente ist eine so breite Veränderlichkeit der Klangfarbe vorhanden, wie hier; bei keinem anderen kann deshalb das musikalische Ohr sich so frei den seinen Bedürfnissen entsprechenden Klang auswählen.
Ich habe schon oben darauf aufmerksam gemacht, daß bei den Klaviersaiten der mittleren und unteren Oktaven die sechs ersten Partialtöne in der Regel deutlich durch den Anschlag der Taste zu erzeugen sind, und zwar die drei ersten stark, der 5te und 6te zwar deutlich, aber doch viel schwächer. Der 7te, 8te, 9te fehlen, wegen der Lage der Anschlagsstelle; die noch höheren sind immer sehr schwach. Ich lasse zur näheren Vergleichung hier eine Tabelle folgen, in welcher die Intensität der Partialtöne einer Saite für verschiedene Anschlagsweisen theoretisch aus den in den Beilagen entwickelten Formeln berechnet ist. Die Wirkung des Anschlags durch den Hammer hängt ab von der Zeit, während welcher er der Saite anliegt. Diese Zeit ist in der Tabelle angegeben in Teilen der Schwingungsdauer des Grundtons. Außerdem findet sich die Berechnung für eine mit dem Finger gerissene Saite. Die Anschlagsstelle ist stets in 1/7 der Saitenlänge angenommen.
Theoretische Intensität der Partialtöne.
|
|
|||||||
| Ordnungszahl des
Partial- Tons |
Anschlag
durch Reißen
|
|
Anschlag
mit einem ganz harten Hammer |
||||
|
|
|
|
|
||||
|
|
|||||||
|
|
|
|
|||||
| L | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 2 | 81,2 | 99,7 | 189,4 | 249 | 285,7 | 324,7 | |
| 3 | 56,1 | 8,9 | 107,9 | 242,9 | 367,0 | 504,9 | |
| 4 | 31,6 | 2,3 | 17,3 | 118,9 | 259,8 | 504,9 | |
| 5 | 13,0 | 1,2 | 0,0 | 26,1 | 108,4 | 324,7 | |
| 6 | 2,8 | 0,01 | 0,5 | 1,3 | 18,8 | 100,0 | |
| 7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Der besseren Vergleichung wegen ist die Intensität7)
des Grundtons immer gleich 100 gesetzt worden. Ich habe die berechnete
Stärke der Obertöne verglichen mit ihrer Stärke an dem schon
erwähnten Flügel, und gefunden, daß die erste mit 3/7
überschriebene Reihe etwa paßt für die Gegend des c".
In noch höherer Lage werden die Obertöne noch schwächer,
als in dieser Columne. Beim Anschlag der Taste c" bekam ich den
zweiten Ton stark, den dritten fast gar nicht mehr. Die zweite mit 3/10
überschriebene Columne würde etwa entsprechen der Gegend des
g', die ersten beiden Obertöne sind hier sehr stark, der vierte
Ton ist schwach. Die dritte Columne entspricht den tieferen Saiten vom
c' an abwärts: die ersten vier Partialtöne sind kräftig
da, der fünfte schwächer. In der folgenden Columne wird der dritte
Partialton stärker als der zweite, was an den Klängen des von
mir untersuchten Flügels nicht mehr vorkommt. Bei dem ganz harten
Hammer werden endlich der dritte und vierte Ton gleich stark, und die stärksten
von allen. Es ergibt sich aus den in der Tabelle zusammengestellten Berechnungen,
daß bei den Klavierklängen der mittleren und tieferen Oktaven
der Grundton schwächer ist als der erste oder selbst als die beiden
ersten Obertöne. Es läßt sich dies auch durch den schon
erwähnten Vergleich mit den gerissenen Saiten bestätigen. Auf
diesen ist der zweite Ton etwas schwächer als der erste; der letztere,
der Grundton, ist aber in dem Klange viel deutlicher, wenn man eine Klaviersaite
mit dem Finger reißt, als wenn man sie mittels der Taste anschlägt.
Endlich hat, wie ich oben erwähnt habe, auch die Dicke und das Material der Saiten Einfluß auf die Klangfarbe. Es können sich namentlich auf sehr steifen Saiten keine sehr hohen Obertöne bilden, weil solche Saiten nicht leicht in sehr kurzen Abteilungen entgegengesetzte Biegungen annehmen. Man bemerkt dies leicht, wenn man auf dem Monochord zwei Saiten von verschiedener Dicke aufzieht, und ihre hohen Obertöne hervorzubringen sucht. Dies gelingt auf der dünneren viel besser als auf der dickeren. Um hohe Obertöne hervorzubringen, sind Saiten von ganz feinem Draht, wie ihn die Posamentiere zum Bespinnen brauchen, am vorteilhaftesten, und wenn man eine Anschlagsweise braucht, welche hohe Obertöne hervorzubringen geeignet ist, zum Beispiel mit einem Metallstift die Saite schlägt oder reißt, hört man dies auch dem Klange an. Die vielen hohen Obertöne, die einander in der Skala sehr nahe liegen, geben nämlich das eigentümlich hohe, unharmonische Geräusch, welches wir mit dem Worte "Klimpern" zu bezeichnen pflegen. Vom 8ten Partialtone an liegen diese Töne um weniger als eine ganze Tonstufe von einander entfernt, vom 15ten ab um weniger als eine halbe. Sie bilden deshalb eine enge Reihe dissonierender Töne. Auf einer Saite aus feinstem Eisendraht, wie er zur Verfertigung künstlicher Blumen gebraucht wird, von 700 Zentimeter Länge, konnte ich noch den 18ten Ton isoliert hervorbringen. Die Eigentümlichkeit der Zitherklänge beruht auf der Anwesenheit solcher klimpernder hoher Obertöne; nur geht die Reihe der Obertöne bei ihnen nicht so weit hinauf, wie an dem genannten Eisendrahte, weil ihre Saiten kürzer sind.
Die Darmsaiten sind bei gleicher Festigkeit viel leichter als Metallsaiten und geben deshalb höhere Töne. Der Unterschied ihres Klanges beruht teils hierauf, teils aber auch wohl auf der weniger vollkommenen Elastizität der Darmsaiten, wodurch ihre Töne, namentlich die hohen, schneller gedämpft werden. Der Klang gerissener Darmsaiten (Gitarre, Harfe) ist deshalb weniger klimpernd als der von Metallsaiten.
4. Klänge der Streichinstrumente.
Für die Bewegung der mit dem Violinbogen gestrichenen Saiten kann noch keine vollständige mechanische Theorie gegeben werden, weil man nicht weiß, in welcher Weise der Bogen auf die Bewegung der Saite einwirkt. Doch habe ich es möglich gefunden, mittels einer eigentümlichen, von dem französischen Physiker Lissajous in ihren Grundzügen vorgeschlagenen Methode die Schwingungsform der einzelnen Punkte einer Violinsaite zu beobachten, und aus der beobachteten Schwingungsform, welche verhältnismäßig sehr einfach ist, dann die ganze Bewegung der Saite und die Stärke ihrer Obertöne zu berechnen.
Man sehe durch eine Lupe, welche eine stark vergrößernde konvexe Glaslinse enthält, nach einem kleinen lichten Objekte, zum Beispiel nach einem Stärkemehlkörnchen, welches das Licht einer Flamme reflektiert und als ein sehr feines Lichtpünktchen erscheint. Wenn man dann die Lupe auf und ab bewegt, während das lichte Pünktchen in Wirklichkeit ruhig an seinem Orte bleibt, so scheint dieses Pünktchen doch, durch die bewegte Lupe gesehen, selbst auf und ab zu schwanken. Eine solche Lupe L ist nun in dem Apparate, welchen ich angewendet habe, und der in Fig. 22 (a. f. S.) dargestellt ist, am Ende einer Zinke der Stimmgabel G befestigt. Sie ist ans zwei achromatischen Glaslinsen zusammengesetzt, wie sie als Objektivgläser der Mikroskope gebraucht werden. Man benutzt diese beiden Linsen entweder allein, ohne sie noch mit anderen Linsen zu verbinden; oder wenn man eine stärkere Vergrößerung braucht, wird hinter der Metallplatte A A, welche die Stimmgabel trägt, die Röhre und das Okularstück M eines Mikroskops angebracht, dessen Objektiv dann von den genannten Glaslinsen gebildet wird. Wenn man nun das Instrument, welches wir das Vibrationsmikroskop nennen können, so aufstellt, daß man durch dasselbe einen feststehenden lichten Punkt deutlich sieht, und dann die Gabel in Schwingung setzt, so wird von dieser das Linsensystem L periodisch auf und ab bewegt, und zwar in pendelartiger einfacher Schwingung. Für den Beobachter entsteht dadurch der Schein, als ob das Lichtpünktchen selbst sich auf und ab bewegte, und da die einzelnen Schwingungen so schnell auf einander folgen, daß der Eindruck des Lichts im Auge während der Dauer einer Schwingung nicht erlöschen kann, so scheint der Weg des Lichtpünktchens als eine feststehende gerade Linie, welche um so länger ist, je größer die Exkursionen der Gabel sind8).
8) Das Ende der zweiten Zinke der Stimmgabel ist verdickt und bildet ein Gegengewicht für die Lupe. Das eiserne Bügelchen B, welches auf die eine Zinke aufgeklemmt ist, dient dazu, die Tonhöhe der Gabel etwas zu verändern; wenn man es gegen das Ende der Zinke hinschiebt, wird ihr Ton tiefer. E ist ein Elektromagnet, mit dessen Hilfe man die Gabel dauernd in gleichmäßiger Schwingung erhalten kann, wenn man seine Drahtrollen von intermittierenden elektrischen Strömen durchfließen läßt, wie dies im sechsten Abschnitt näher beschrieben werden soll.
Das Stärkekörnchen nun, dessen Lichtreflex man wahrnimmt, wird an demjenigen tönenden Körper befestigt, dessen Schwingungsform man beobachten will, und dieser in solche Lage gebracht, daß das Körnchen horizontal hin und her schwingt, während das Linsensystem sich vertikal auf und ab bewegt. Wenn beide Arten von Bewegungen gleichzeitig vor sich gehen, erblickt der Beobachter den Lichtpunkt sowohl horizontal hin und her bewegt, entsprechend seiner wirklichen Bewegung, als auch scheinbar vertikal hin- und hergehend wegen der Bewegung der Glaslinsen, und beide Arten von Verschiebungen setzen sich dann zusammen zu einer krummlinigen Bewegung. Dabei erscheint im Gesichtsfelde des Mikroskops eine scheinbar ganz feststehende und unveränderliche helle Kurve, wenn entweder die Schwingungsperiode des Stärkekörnchens und die der Stimmgabel genau gleich sind, oder die eine genau 2, 3 oder 4 Mal so groß ist als die andere, weil in diesem Falle der lichte Punkt nach einer oder einigen Schwingungen immer genau wieder dieselbe Bahn durchläuft, die er vorher durchlaufen hatte. Sind diese Verhältnisse der Schwingungszahlen nicht vollkommen genau getroffen, so verändern sich die Kurven langsam, und zwar sieht es täuschend so aus, als wären sie auf die Oberfläche eines durchsichtigen Zylinders gezeichnet, der sich langsam um seine Achse dreht. Eine solche langsame Verschiebung der gesehenen Kurven ist nicht unvorteilhaft, weil der Beobachter sie dann nach einander in verschiedenen Lagen erblickt. Weicht aber das Verhältnis der Schwingungszahlen des beobachteten Körpers und der Gabel zu sehr von einem durch kleine ganze Zahlen darstellbaren Verhältnisse ab, so geschieht die Bewegung der Kurven zu schnell, als daß das Auge ihnen folgen könnte, und es verwirrt sich dann alles.
Soll das Vibrationsmikroskop zur Untersuchung der Bewegung einer Violinsaite benutzt werden, so muß man den Lichtpunkt an dieser anbringen. Zu dem Ende schwärzt man zunächst die betreffende Stelle der Saite mit Tinte, reibt sie, wenn sie trocken geworden ist, mit Klebwachs ein und pulvert etwas Stärkemehl über, so daß einige Körnchen haften bleiben. Die Violine wird dann dem Mikroskope gegenüber so befestigt, daß die Saiten vertikal stehen, und man durch das Mikroskop blickend den Lichtreflex eines der Stärkemehlkügelchen deutlich sieht. Den Bogen führt man den Zinken der Stimmgabel parallel über die Saite; dann schwingt jeder Punkt der Saite horizontal, und der Beobachter sieht bei gleichzeitiger Bewegung der Stimmgabel die eigentümlichen Schwingungskurven. Zar Beobachtung habe ich die a-Saite der Violine benutzt, welche ich etwas höher, auf b', stimmte, so daß sie gerade zwei Oktaven höher war als die Stimmgabel des Apparats, welche B gab.
In Figur 23 sind Schwingungskurven abgebildet, wie sie durch das Vibrationsmikroskop erscheinen. Die gerade Vertikallinie der Figuren a a, bb und cc stellt die scheinbare Bahn des beobachteten Lichtpunktes dar, ehe er selbst in Schwingung versetzt ist, die Kurven und Zickzacklinien derselben Figuren dagegen die Bahn des Lichtpunktes, wenn er selbst ebenfalls schwingt. Daneben sind in A, B, C dieselben Schwingungsformen nach der im ersten und zweiten Abschnitte angewendeten Methode dargestellt, wobei die einzelnen Teile der vertikalen Grundlinie den entsprechenden Zeitteilen direkt proportional sind, während in den Figuren aa, bb und cc die vertikalen Längen den Exkursionen der schwingenden Linse proportional sind. A und a a stellen die Schwingungskurven für eine Stimmgabel dar, also eine einfache Schwingung, B und bb die des Mittelpunktes einer Violinsaite, welche mit der Gabel des Vibrationsmikroskops im Einklange ist, C und cc dieselbe für eine Saite, die eine Oktave höher gestimmt ist. Man kann sich die Figuren aa, bb und cc aus den Figuren A, B und C gebildet denken, indem man die Fläche, auf welche die letzteren gezeichnet sind, um einen durchsichtigen Zylinder herumgelegt denkt, dessen Umfang gleich der vertikalen Grundlinie dieser Figuren ist. Die auf die Zylinderfläche gezeichnete Kurve werde dann aus einer solchen Stellung des Beobachters betrachtet, daß ihm die um den Zylinder zum Kreise zusammengeschlossene vertikale Grundlinie jener Figuren perspektivisch als einfache gerade Linie erscheint, dann wird ihm auch die Schwingungskurve A in der Form aa, B als bb, C als cc erscheinen. Wenn die Tonhöhe der beiden schwingenden Körper nicht in einem genauen harmonischen Verhältnisse ist, sieht es so aus, als wenn dieser imaginäre Zylinder, auf den die Schwingungskurve gezeichnet ist, rotierte.
Es ist nun auch leicht, aus den Formen a a, bb und cc die A, B, C wiederzufinden, und da die letzteren ein verständlicheres Bild der Bewegung der Saite, geben als die ersteren werde ich im Folgenden immer gleich die scheinbar auf eine Zylinderfläche gezeichnete Kurve so zeichnen, als wäre die Zylinderfläche wie in den Figuren A, B und C auf eine Ebene abgerollt. Dann entspricht der Sinn unserer Schwingungskurven ganz den in den früheren Abschnitten dargestellten ähnlichen Kurven. Wenn vier Schwingungen der Violinsaite auf eine Schwingung der Gabel kommen, wie das bei unseren Versuchen der Fall war, also vier Wellen rings um den Umfang des imaginären Zylinders aufgezeichnet erscheinen, und diese außerdem noch langsam rotieren und sich in verschiedenen Stellungen zeigen, ist es gar nicht schwer, sie gleich auf die Ebene abgewickelt nachzuzeichnen; denn die mittleren Zacken erscheinen dann auf der Zylinderfläche ziemlich ebenso, als wären sie auf eine Ebene gezeichnet.
Die Figuren 23 B und C geben direkt die Schwingungsform für die Mitte einer Violinsaite, wenn der Bogen gut faßt und der Grundton der Saite voll und kräftig zum Vorschein kommt. Man sieht leicht, daß diese Schwingungsform sich wesentlich unterscheidet von der in Fig. 23 A dargestellten Form einer einfachen Schwingung. Mehr gegen die Enden der Saite zu wird die Schwingungsfigur die nachstehende der Fig. 24 A, und zwar verhalten sich die beiden Abschnitte ab und bg je einer Welle zu einander, wie die beiden Stücke der Saite, welche zu beiden Seiten des beobachteten Punktes gelegen sind. In der Figur ist dieses Verhältnis 1 : 3, wie man es findet, wenn der beobachtete Punkt 1/4 vom Ende der Saite entfernt liegt. Ganz gegen das Ende der Saiten hin wird die Form wie Fig. 24 B. Da die Geschwindigkeit des hellen Punktes in den kurzen Stücken der Figur sehr groß ist, so werden diese Teile so lichtschwach, daß sie oft dem Auge entschwinden und nur die langen Linienstücke stehen bleiben.
Diese Figuren geben zu erkennen, daß jeder Punkt der Saite sich zwischen den Endpunkten einer Schwingung mit konstanter Geschwindigkeit hin und her bewegt. Für den Mittelpunkt ist die Geschwindigkeit, mit der er aufsteigt, gleich der, mit der er absteigt. Wird der Violinbogen nahe dem rechten Ende der Saite absteigend gebraucht, so ist auf der rechten Hälfte der Saite die Geschwindigkeit des Absteigens kleiner als die des Aufsteigens, desto mehr, je näher man dem Ende kommt. Auf der linken Hälfte der Saite ist es umgekehrt. An der Stelle, wo gestrichen wird, scheint die Geschwindigkeit des Absteigens der Geschwindigkeit des Violinbogens gleich zu sein. Während des größeren Teiles jeder Schwingung haftet hier die Saite an dem Violinbogen, und wird von ihm mitgenommen; dann reißt sie sich plötzlich los und springt schnell zurück, um sogleich wieder von einem anderen Punkte des Bogens gefaßt und mitgenommen zu werden 9).
9) Die hier beschriebenen Tatsachen genügen, um die Bewegung der gestrichenen Saite vollständig festzustellen. Siehe Beilage No. VI. Eine neue viel einfachere Methode, die Schwingungsform der Violine zu beobachten, ist von Herrn Clem. Neumann angegeben in Sitzungsber. d. k. k. Akademie zu Wien, Math. naturw. Klasse Bd. 61, S. 89. Er hat am Bogen selbst kammförmig gestellte Drähte befestigt. Blickt man zwischen diesen hindurch nach der Saite, so sieht man ein System von Zickzacklinien aus geradlinigen Teilen zusammengesetzt. Die Schlüsse auf die Bewegungsart der Saite stimmen mit den oben erhaltenen Ergebnissen.
Für unseren gegenwärtigen Zweck kommt es nun namentlich auf die Bestimmung der Obertöne an. Da wir die Schwingungsform der einzelnen Punkte der Saite kennen, so läßt sich aus ihr die Intensität der einzelnen Obertöne vollständig berechnen. Die mathematischen Formeln für diese Rechnung sind in der Beilage entwickelt. Die Rechnung selbst ergibt Folgendes. Es sind bei guter Ansprache der gestrichenen Saite alle Obertöne auf ihr vorhanden, welche bei dem bestehenden Grade von Steifigkeit der Saite überhaupt sich bilden können, und zwar nach der Höhe hin in abnehmender Stärke. Die Schwingungsweite sowohl als die Intensität des zweiten Tones ist ein Viertel von der des Grundtones, die des dritten Tones ein Neuntel, die des vierten ein Sechszehntel etc. Es ist dies dasselbe Verhältnis in der Stärke der Obertöne wie bei einer Saite, die man in ihrer Mitte durch Reißen in Bewegung gesetzt hat, nur daß bei letzterer die geradzahligen Töne alle fehlen, welche im Gegenteile durch die Anwendung des Bogens mit hervorgerufen werden. Übrigens hört man die Obertöne im Klange der Violine sehr leicht und stark, namentlich wenn man sie sich vorher als Flageolettöne auf der Saite angegeben hat. Letzteres erreicht man bekanntlich dadurch, daß. man die Saite streicht, während man sie in einem Knotenpunkte des gewünschten Tones mit dem Finger leise berührt. Bis zum sechsten Obertone sprechen die Saiten der Violine leicht an, mit einiger Mühe bringt man es auch bis zum zehnten Obertone. Die tieferen Töne sprechen am besten an, wenn man die Saite um 1/10 bis 1/12 der Länge einer schwingenden Abteilung von ihrem Ende entfernt streicht; für die höheren Töne, wo die schwingenden Abteilungen kleiner werden, muß man etwa 1/4 bis 1/6 ihrer Länge vom Ende entfernt streichen.
Der Grundton ist im Klange der Streichinstrumente verhältnismäßig kräftiger als in den nahe ihren Enden geschlagenen oder gerissenen Saiten des Klaviers und der Gitarre; die ersten Obertöne sind verhältnismäßig schwächer; dagegen sind die höheren Obertöne vom sechsten bis etwa zehnten hin viel deutlicher, und verursachen die Schärfe des Klanges der Streichinstrumente.
Die im Vorigen beschriebene Grundform der Schwingungen von Violinsaiten ist wenigstens in ihren wesentlichen Zügen ziemlich unabhängig von der Stelle, wo die Saite gestrichen wird, wenn nur überhaupt die Saite gut anspricht; sie verändert sich durchaus nicht in der Weise, wie die Schwingungsform einer gerissenen oder geschlagenen Saite nach der Stelle des Anschlags sich ändert. Doch machen sich kleine Unterschiede in der Schwingungsfigur bemerklich, welche von der Stelle des Streichens abhängen. Gewöhnlich zeigen nämlich die Linien der Schwingungsfigur kleine Kräuselungen, wie in Fig. 25, deren Zacken an Breite und Höhe zunehmen, je mehr sich der Bogen vom Ende der Saite entfernt. Wenn man in einem dem Stege benachbarten Knotenpunkte eines der hohen Obertöne die Saite anstreicht, so lassen sich diese Kräuselungen einfach darauf reduzieren, daß von der bisher beschriebenen normalen Saitenbewegung alle diejenigen Töne wegfallen, welche in dem gestrichenen Punkte einen Knotenpunkt haben. Wenn die Beobachtung der Schwingungsform in einem der übrigen zugehörigen Knotenpunkte des tiefsten ausfallenden Tones angestellt wird, sieht man nichts von jenen Kräuselungen. Also wenn man zum Beispiel um 1/7 der Saitenlänge vom Stege entfernt streicht, und in 6/7 oder 5/7 oder 4/7 etc. beobachtet, ist die Schwingungsfigur einfach, wie in Fig. 24; wenn man aber zwischen je zwei Knotenpunkten beobachtet, erscheinen die Kräuselungen wie in Fig. 25. Veränderungen in der Klangfarbe des Tones hängen zum Teil von diesem Umstande ab. Nähert man sich beim Streichen zu sehr dem Griffbrett, dessen Ende um 1/5 der Saitenlänge vom Stege entfernt ist, so fehlt in dem Klange der Saite der 5te oder 6te Ton, welche beide sonst noch deutlich hörbar zu sein pflegen. Der Klang wird dadurch etwas dumpfer. Die gewöhnliche Stelle für das Anstreichen liegt etwa in 1/10 der Saitenlänge, wird im Piano etwas entfernter vom Stege, im Forte etwas näher genommen. Nähert man sich mit dem Bogen dem Stege, indem man ihn nur leicht andrückt, so geht eine andere Veränderung des Klanges vor, die sich in der Schwingungsfigur leicht zu erkennen gibt. Es entsteht nämlich ein Gemisch aus dem Grundton und dem ersten Flageoletton der Saite. Bei leichtem und schnellem Streichen an einer um etwa 1/20 der Saitenlänge vom Stege entfernten Stelle erhält man nämlich zuweilen die höhere Oktave des Grundtons allein, indem in der Mitte der Saite ein Knotenpunkt entsteht; bei fester angedrücktem Bogen erklingt zugleich der Grundton. Dazwischen kann sich nun die höhere Oktave in jedem Verhältnisse einmischen. In der Schwingungsfigur gibt sich dies gleich zu erkennen. Fig. 26 stellt die Reihenfolge der Formen bei dieser Veränderung dar. Man sieht, wie aus der längeren Saite eines Wellenbergs sich eine neue Spitze, zuerst wenig, dann stärker erhebt, bis die neuen Bergspitzen so hoch wie die früheren werden, wobei die Schwingungszahl des Tones sich verdoppelt hat, und seine Höhe in die Oktave übergegangen ist. Die Klangfarbe des tiefsten Klanges der Saite wird durch die beginnende Einmischung des ersten Obertons zarter und heller, aber weniger voll und kräftig. Es ist übrigens ein sehr interessantes Schauspiel, die Schwingungsfigur zu beobachten, während man kleine Veränderungen in der Bogenführung vor sich gehen läßt, und dabei wahrzunehmen, wie leise Veränderungen in der. Klangfarbe sich immer gleich durch sehr merkliche Veränderungen der Schwingungsfigur zu erkennen geben.
Die bisher beschriebenen Schwingungsformen können bei einer recht gleichmäßigen Bogenführung auch gleichmäßig ruhig und unverändert erhalten werden, dabei gibt das Instrument einen ununterbrochenen reinen musikalischen Klang. Jedes Kratzen des Bogens gibt sich dagegen durch plötzliche und sprungweise eintretende Verschiebungen und Veränderungen der Schwingungsform zu erkennen. Ist das Kratzen anhaltend, so hat das Auge gar nicht Zeit, eine regelmäßige Figur aufzufassen. Die kratzenden Geräusche des Violinbogens sind also als unregelmäßige Unterbrechungen der normalen Saitenschwingungen zu betrachten, worauf die letzteren von Neuem und mit neuem Anfangspunkt einsetzen. An der Schwingungsfigur sind übrigens alle kleinsten Anstöße des Bogens, die das Ohr kaum bemerkt, durch schnelle Sprünge bezeichnet. Durch die Häufigkeit solcher kleiner und großer Störungen der regelmäßigen Schwingung scheinen sich nun namentlich die schlechten Streichinstrumente von den guten zu unterscheiden. Auf einer Saite meines Monochords, das eben nur gelegentlich hierbei als Streichinstrument gebraucht wurde, war eine große Sauberkeit des Striches nötig, um nur für so kurze Zeit eine ruhige Schwingungsfigur zu erhalten, daß man sie mit dem Auge eben noch auffassen konnte; der Klang war übrigens rauh und das Kratzen sehr häufig. Bei einer sehr guten neueren Violine von Bausch war es dagegen leichter, die Schwingungsfigur einige Zeit ruhig zu halten, und noch viel besser gelang es mir an einer alten italienischen Violine von Guadanini; erst an dieser hatte ich die Schwingungsfigur so ruhig, daß ich die kleinen Kräuselungen zählen konnte. Diese große Gleichmäßigkeit der Schwingungen ist offenbar der Grund des reineren Tones dieser älteren Instrumente, da jede kleine Unregelmäßigkeit sich sogleich dem Ohr als etwas Rauhes oder Kratzendes des Tones zu erkennen gibt.
Es kommt hierbei wahrscheinlich darauf an, daß der Bau des Instrumentes und eine möglichst vollkommene Elastizität des Holzes sehr regelmäßige Saitenschwingungen ermöglicht; sind solche einmal eingeleitet, so wird auch der Bogen leicht regelmäßig wirken. Dadurch wird der reine, von allen Rauhigkeiten freie Abfluß des Tones bedingt. Andererseits kann aber bei solcher Regelmäßigkeit der Schwingungen die gestrichene Saite mit größerer Kraft in Anspruch genommen werden; die guten Instrumente erlauben deshalb eine kräftigere Bewegung der Saiten, und die ganze Intensität ihres Tones wird ohne Verlust der Luft mitgeteilt, während jede Unvollkommenheit in der Elastizität des Holzes einen Teil der Bewegung durch Reibung verloren gehen läßt. Ein guter Teil der Vorzüge der alten Violinen möchte aber wohl eben auf ihrem Alter und namentlich dem langen Gebrauche beruhen, welche beide auf die Elastizität des Holzes nur günstig einwirken können. Mehr als auf alles Andere kommt es aber offenbar auf die Kunst der Bogenführung an; wie fein diese ausgebildet sein muß, um einen möglichst vollkommenen Klang und dessen verschiedene Abarten sicher zu erhalten, davon kann man sich durch nichts besser überzeugen, als durch Beobachtung der Schwingungsfiguren. Auch ist es bekannt, daß ausgezeichnete Spieler selbst aus mittelmäßigen Instrumenten einen vollen Ton hervorlocken.
Die bisher mitgeteilten Beobachtungen und Schlüsse beziehen sich allein auf die Schwingungen der Saiten des Instruments und die Stärke der Obertöne, insofern sie in der zusammengesetzten Schwingungsbewegung der Saiten enthalten sind. Die Töne verschiedener Höhe gehen aber nicht gleich gut an die Luft über, und treffen also auch das Ohr des Hörers nicht genau in demselben Verhältnis der Stärke, welches ihnen in der Bewegung der Saite zukommt. Die Überleitung an die Luft geschieht durch den resonierenden Körper des Instruments; unmittelbar teilen schwingende Saiten der Luft keinen merklichen Teil ihrer Bewegung mit, wie ich schon vorher bemerkt habe. Die schwingenden Saiten der Violine erschüttern zunächst den Steg, über den sie hingezogen sind. Dieser steht mit zwei Füßchen auf dem zwischen den Schallöchern gelegenen beweglichsten Teil der Decke des Hohlkörpers. Der eine Fuß des Steges ruht auf einer relativ festen Unterlage, nämlich auf dem sogenannten Stimmstocke, einem festen Stäbchen, welches zwischen der oberen und unteren Platte des Körpers eingefügt ist. Der andere Fuß des Steges allein ist es, welcher die elastischen Holzplatten und mittels deren Hilfe die innere Luftmasse des Körpers erschüttert.
Ein Luftraum, welcher, wie der der Violine, Bratsche und des Violoncello, durch elastische Holzplatten abgegrenzt ist, hat gewisse Eigentöne, welche man durch Anblasen der Schallöffnungen des Kastens hervorrufen kann. Die Violine gibt, in dieser Weise angeblasen, den Ton c' nach Savart, welcher Instrumente von Stradivario untersuchte;. denselben Ton fand Zamminer konstant auch bei ziemlich mangelhaften Instrumenten wieder. Für das Violoncell fand Savart durch Anblasen F, Zamminer G. Der Kasten der Bratsche ist nach des Letzteren Rechnung einen Ton tiefer gestimmt, als der der Violine. Wenn man das Ohr fest an die Rückseite des Kastens einer Violine anlegt, und auf einem Klaviere die Tonleiter spielt, findet man ebenfalls, daß einige Töne durch die Resonanz des Instruments verstärkt in das Ohr dringen. Bei einer Violine von Bausch traten auf diese Weise namentlich zwei Töne stärkster Resonanz hervor, nämlich c' cis' und a' b' bei einer Bratsche fand ich übereinstimmend mit Zamminer's Rechnung beide etwa am eine ganze Tonstufe tiefer liegend.
Die Folge dieser eigentümlichen Resonanzverhältnisse ist, daß diejenigen Töne der Saiten, welche den eigenen Tönen der Luftmasse nahe liegen, verhältnismäßig stärker hervortreten müssen. Man bemerkt dies auch sowohl auf der Violine wie auf dem Cello deutlich, wenigstens für den tiefsten Eigenton, wenn man die entsprechenden Noten auf den Saiten hervorbringt. Sie klingen besonders voll, und der Grundton dieser Klänge tritt besonders stark heraus. In schwächerem Grade meine ich dasselbe auch für das a' der Violine, welches ihrem höheren Eigentone entspricht, gehört zu haben.
Da der tiefste Ton der Violine g ist, so können von den Obertönen ihrer Klänge nur die höheren Oktaven ihrer drei tiefsten Noten durch die Resonanz des höheren Eigentons ihres Luftraumes etwas verstärkt werden im Allgemeinen müssen dagegen die Grundtöne, namentlich ihrer höheren Noten, den Obertönen gegenüber begünstigt werden, weil die genannten Grundtöne den eigenen Tönen der Luftmasse näher liegen als die Obertöne. Es wird dadurch eine ähnliche Wirkung wie am Klaviere hervorgebracht, wo ebenfalls durch die Konstruktion der Hämmer die Obertöne der tiefen Noten begünstigt, die der höheren geschwächt sind. Beim Cello, dessen tiefste Saite C gibt, liegt der stärkere Eigenton der Luftmasse ebenso wie bei der Violine, eine Quarte bis Quinte höher als der der tiefsten Saite. Es entsteht dadurch ein ähnliches Verhältnis der begünstigten und nicht begünstigten Töne, aber alles eine Duodecime tiefer. Bei der Bratsche dagegen liegen die am meisten begünstigten Töne, etwa dem h' entsprechend, nicht zwischen denen der ersten und zweiten Saite, sondern zwischen der zweiten und dritten, was mit der veränderten Klangfarbe dieses Instruments zusammenzuhängen scheint. In Ziffern läßt sich dieser Einfluß leider noch nicht ausdrücken. Sehr stark ist das Maximum der Resonanz für die eigenen Töne der Luftmasse nicht gerade ausgesprochen; es würde auch sonst eine viel größere Ungleichartigkeit in der Tonleiter der genannten Streichinstrumente hervorrufen, sobald man den Teil der Skala passierte, in welchem die eigenen Töne ihrer Luftmassen liegen. Demgemäß ist zu vermuten, daß auch der Einfluß auf die relative Stärke der einzelnen Partialtöne der Klänge dieser Instrumente nicht sehr hervortretend ist.
5. Klänge der Flötenpfeifen.
Bei den in diese Klasse gehörigen Instrumenten wird der Ton hervorgebracht dadurch, daß man einen Luftstrom gegen die meist mit scharfen Rändern versehene Öffnung eines mit Luft gefüllten Hohlraumes treibt. Es gehören hierher außer den schon im vorigen Abschnitte erwähnten und in Fig. 20 abgebildeten Flaschen hauptsächlich die Flöten und der größte Teil der Orgelpfeifen. Bei den Flöten ist die tönende Luftmasse in der zylindrischen Bohrung ihres Körpers eingeschlossen; das Anblasen geschieht mit dem Munde gegen die etwas zugeschärften Ränder ihrer Mundöffnung. Die Konstruktion der Orgelpfeifen wird durch die nebenstehenden beiden Figuren versinnlicht. Figur 27 A stellt eine hölzerne viereckige Pfeife der Länge nach durchschnitten dar, B die äußere Ansicht einer runden zinnernen Pfeife. RR bezeichnet in beiden die Röhre, welche die tönende Luftmasse einschließt, ab die nach oben durch eine scharfe Lippe begrenzte Mundöffnung, an welcher die Pfeife angeblasen wird. In Fig. 27 A sieht man bei K die Luftkammer, in welche die Luft aus dem Blasebalge zunächst eingetrieben wird; aus ihr kann die Luft nur durch den engen Spalt cd entweichen, und wird hier gerade gegen die Schärfe der Lippe getrieben. Die dargestellte hölzerne Pfeife A ist oben offen, sie gibt einen Ton, dessen Welle in der Luft doppelt so lang ist, als die Länge des Rohres RR. Die andere Pfeife B ist eine gedackte, d. h. ihr oberes Ende ist geschlossen. Sie gibt einen Ton, dessen Welle viermal so lang ist, als die Länge des Rohres RR, und der deshalb eine Oktave tiefer ist, als der einer gleich langen offenen Pfeife.
Ebenso wie solche Pfeifen, wie die Flöten, die beschriebenen Flaschen, die Luftkästen der Violinen, kann man nun aber auch überhaupt alle mit einer hinreichend engen Öffnung versehenen lufthaltigen Hohlräume zum Tönen bringen, wenn man einen schmalen bandförmigen Luftstrom über ihre Öffnung hingehen läßt, vorausgesetzt, daß diese Öffnung mit einigermaßen hervortretenden und kantigen Rändern versehen ist.
Die Luftbewegung, welche im Innern der Orgelpfeifen eintritt, entspricht einem System ebener Wellen, welche zwischen den beiden Enden der Pfeife hin und her geworfen werden. An dem geschlossenen Ende einer zylindrischen gedackten Pfeife ist die Zurückwerfung jeder gegen dasselbe andringenden Welle eine sehr vollständige, so daß die zurückgeworfene Welle dieselbe Intensität hat, wie vor der Zurückwerfung. Da in jedem nach einer Richtung fortlaufenden Wellenzuge die Geschwindigkeit der oszillierenden Teilchen in den verdichteten Stellen der Welle gleich gerichtet, in den verdünnten Stellen entgegengesetzt gerichtet ist der Richtung der Fortpflanzung der Wellen, und da an dem geschlossenen Ende der Pfeife die Deckplatte keine Bewegung der Luftteilchen in Richtung der Pfeifenlänge zu Stande kommen läßt, so kombinieren sich die ankommende und zurückgeworfene Welle dort so, daß sie beide entgegengesetzte Oszillationsgeschwindigkeit der Luftteilchen hervorrufen und daher bei ihrer Superposition die Geschwindigkeit der Luftteilchen an der Scheidewand gleich Null machen. Daraus folgt, daß die Phasen des Druckes in beiden immer übereinstimmend sind, da entgegengesetzte Oszillationsbewegung und entgegengesetzte Fortpflanzung übereinstimmenden Druck geben.
An geschlossenen Enden also ist keine Bewegung, aber starker Drückwechsel. Die Reflexion der Welle geschieht so, daß die Phase der Verdichtung ungeändert bleibt, aber die Richtung der Oszillationsbewegung umgekehrt wird.
Umgekehrt ist es an den offenen Enden der Pfeifen, zu denen auch die Anblaseöffnungen ihrer Mundstücke zu rechnen sind. An einem offenen Ende, wo die Luft der Röhre frei mit der großen äußeren Luftmasse kommuniziert, kann keine erhebliche Verdichtung eintreten. Bei der gewöhnlich gegebenen Erklärung der Luftbewegung in den Pfeifen setzt man voraus, daß die Verdichtung und Verdünnung an den offenen Enden der Pfeifen gleich Null sei, was annähernd, aber nicht genau richtig ist. Wäre der Dichtigkeitswechsel daselbst genau gleich Null, so würde auch an den offenen Enden eine vollständige Reflexion jeder ankommenden Welle stattfinden, indem eine gleich große zurückgeworfene Welle entstände mit entgegengesetzter Dichtigkeitsänderung, wobei die Oszillationsrichtung der Luftteilchen aber in beiden Wellen übereinstimmend sein würde. Die Superposition einer solchen ankommenden und zurückgeworfenen Welle von entgegengesetzten Dichtigkeitsphasen würde am offenen Ende in der Tat die Dichtigkeit ungeändert lassen, dagegen große Geschwindigkeit der schwingenden Luftteilchen geben.
In der Tat erklärt die gemachte Annahme die wesentlichen Erscheinungen der Orgelpfeifen. Betrachten wir zunächst eine Pfeife mit zwei offenen Enden. Erregen wir an einem Ende derselben eine Verdichtungswelle, so läuft diese vorwärts bis zum anderen Ende, wird hier als Verdünnungswelle reflektiert, läuft zurück zum ersten Ende, wird hier mit wieder gewechselter Phase als Verdichtungswelle reflektiert, und wiederholt nun den eben gemachten Weg in derselben. Weise zum zweiten Male. Diese Wiederholung desselben Vorgangs tritt also ein, nachdem die Welle in der Röhre einmal hin und einmal her, das heißt zweimal durch die ganze Länge der Röhre gelaufen ist. Die Zeit, die dazu gebraucht wird, ist gleich der doppelten Röhrenlänge dividiert durch die Schallgeschwindigkeit. Dies ist die Schwingungsdauer des tiefsten Tons, den die Röhre geben kann.
Wenn nun um die Zeit, wo die Welle ihren zweiten Hin- und Hergang beginnt, ein zweiter gleichgerichteter Anstoß, zum Beispiel durch eine schwingende Stimmgabel, gegeben wird, so erfährt die Luftbewegung dadurch eine Verstärkung, die fortdauernd zunehmen wird, wenn die neuen Anstöße fortdauernd in demselben Rhythmus, wie der Hin- und Hergang der Wellen erfolgen.
Aber auch wenn die zurückgekehrte Welle nicht mit dem ersten folgenden gleichartigen Anstöße der Stimmgabel zusammentrifft, sondern mit dem zweiten oder dritten oder vierten u. s. w., wird die Luftbewegung nach jedem Hin- und Hergang verstärkt werden.
Ein an beiden Enden offenes Rohr wird also als Resonator dienen können für Töne, deren Schwingungszahl gleich ist der Schallgeschwindigkeit (332 Meter) dividiert durch die doppelte Röhrenlänge, oder zweimal oder dreimal so groß, oder überhaupt ein ganzes Vielfache jener Zahl. Das heißt die Töne stärkster Resonanz eines solchen Rohres werden, wie bei den Saiten, die vollständige Reihe der harmonischen Obertöne seines Grundtons darstellen.
Etwas anders stellt es sich bei den an einem Ende gedackten Pfeifen. Erregen wir am offenen Ende, etwa durch eine schwingende Stimmgabel, einen Verdichtungsstoß, der sich in die Röhre hinein fortpflanzt, so läuft dieser gegen das geschlossene Ende, wird hier als Verdichtungsstoß reflektiert, kommt zurück, wird nun am offenen Ende mit geänderter Phase als Verdünnungswelle reflektiert, und erst wenn er nochmals am geschlossenen Ende mit gleicher Phase und dann nochmals am offenen Ende mit wieder geänderter Phase als Verdichtungsstoß reflektiert ist, tritt eine Wiederholung des bisherigen Vorgangs ein, also erst nachdem die Welle viermal die Länge der Pfeife durchlaufen hat. Der Grundton einer gedackten Pfeife hat also eine doppelt so große Schwingungsdauer, als der einer gleich langen offenen Pfeife. Das heißt ersterer ist die tiefere Oktave des letzteren. Wiederholt sich nun nach diesem doppelten Hin- und Hergang der erste Anstoß in gleicher Weise, so entsteht verstärkte Resonanz.
Auch können Obertöne des Grundtons verstärkt werden, aber nur die ungeradzahligen. Da nämlich nach Ablauf der halben Schwingungsdauer des Grundtons die Welle in der Röhre mit entgegengesetzter Dichtigkeitsphase ihren Weg erneuert, so können nur solche Töne verstärkt werden, die nach Ablauf der halben Schwingungsdauer des Grundtons die entgegengesetzte Phase geben. Der zweite Ton hat aber nach dieser Zeit eine ganze Schwingung zurückgelegt, der vierte zwei ganze Schwingungen u. s. w. Diese geben also die gleiche Phase und heben an der entgegengesetzt wiederkehrenden Welle ihre frühere Wirkung auf.
Die Töne starker Resonanz in den gedackten Pfeifen entsprechen also der Reihe der ungeradzahligen Partialtöne des Grundtons. Bezeichnen wir dessen Schwingungszahl mit n, so ist 3 n die Duodecime, das heißt die Quinte der höheren Oktave 2 n, 5 n die große Terz der zweiten Oktave 4 n, 7 n die kleine Septime derselben Oktave u. s. w.
Obgleich nun aber in der Hauptsache die Erscheinungen diesen Regeln folgen, so treten doch gewisse Abweichungen deshalb ein, weil an den offenen Enden der Pfeifen in der Tat der Druckwechsel nicht vollständig gleich Null ist. Von ihnen aus teilt sich nämlich die Schallbewegung der freien Luft mit, und die von der Röhrenmündung aus sich verbreitenden Wellen haben zwar verhältnismäßig geringen Druckwechsel, doch fehlt derselbe nicht ganz. Ein Teil einer jeden im Rohre gegen das offene Ende laufenden Welle wird also nicht reflektiert, sondern läuft hinaus in das Freie, während der größere Rest reflektiert wird und im Rohre zurückläuft. Die Reflexion ist desto vollständiger, je kleiner die Dimensionen der Öffnung im Vergleich zur Wellenlänge des betreffenden Tones sind.
Auch zeigt weiter die Theorie 10) mit dem Versuch übereinstimmend, daß die Phasen des reflektierten Teils der Welle von der Art sind, als wäre die Reflexion nicht an der Fläche der Mündung, sondern an einer etwas davon verschiedenen Ebene geschehen. Die den Tonhöhen entsprechende Pfeifenlänge, welche wir die reduzierte Länge der Pfeife nennen können, ist also von der wahren Länge etwas verschieden, der Unterschied zwischen beiden übrigens von der Form der Mundung abhängig. Die Tonhöhe gewinnt darauf erst Einfluß, wenn die Wellenlängen so kurz werden, daß man im Verhältnis zu ihnen die Dimensionen der Öffnung nicht mehr vernachlässigen kann.
10) Siehe Crelle's Journ. f. Mathem. Bd. LVII; Wiss. Abh. Bd. I. 8. 303.
Bei zylindrischen Röhren von kreisförmigem Querschnitt und rechtwinklig abgeschnittener Grenzkante liegt nach der theoretischen Bestimmung die Reflexionsebene außerhalb der Pfeife um 0,7854 des Radius des Kreises von ihr entfernt. An einer hölzernen Röhre von quadratischem Querschnitt, deren Seitenflächen innen 36 mm breit waren, fand ich die genannte Entfernung zu 14 mm 11).
11) Die Pfeife war eine offene hölzerne, von Marloye konstruiert und mit einem Ansatzstücke von 302mm Länge versehen, dessen Länge genau der halben Wellenlänge der Pfeife entsprach. Bestimmt wurde die Lage der Knotenfläche im Innern der Pfeife dadurch, daß man ein die Höhlung ganz ausfüllendes hölzernes Prisma vom offenen Ende der Pfeife aus so weit hineinschob, bis der Ton der nunmehr gedachten Pfeife genau derselbe war, wie der der offenen ohne den Stempel. Die Knotenfläche lag 137 mm vom Ende der Pfeife entfernt, während eine Viertelwellenlänge 151 mm beträgt. An der Anblaseöffnung dagegen fehlten 83 mm an der theoretischen Länge der Pfeife.
Da nun wegen der unvollkommenen Reflexion der Wellen an den offenen Enden der Orgelpfeifen, beziehlich an deren Anblaseöffnung bei jeder Schwingung ein Teil der Luftbewegung an den Außenraum abgegeben wird, so muß eine oszillierende Bewegung ihrer Luftmasse schnell erschöpft werden, wenn keine Kräfte da sind, die die verlorene Bewegung wieder ersetzen. In der Tat ist ein Nachklingen der Orgelpfeifen, wenn man aufhört zu blasen, kaum zu bemerken. Indessen wird immerhin die Welle so oft in ihnen hin und her geworfen, daß man durch Klopfen gegen die Pfeife die Tonhöhe derselben wahrnehmbar machen kann.
Das gewöhnlich gebrauchte Mittel, sie in dauernder Tönung zu erhalten, ist das Anblasen. Um die Wirkung dieses Verfahrens zu verstehen, muß man berücksichtigen, daß wenn Luft ans einem solchen Spalte, wie er sich unterhalb der Lippe der Pfeife befindet, herausgeblasen wird, sie in einer blattförmigen Schicht die ruhende zunächst vor dem Spalt liegende Luftmasse durchbricht, und dabei im Anfang keinen merklichen Teil der letzteren in ihre Bewegung mit hineinzieht. Erst in der Entfernung von einigen Zentimetern löst sich die strömende Schicht in Wirbel auf, welche eine Vermischung der bewegten und ruhenden Luft bewirken. Man kann diese blattförmige Schicht bewegter Luft sichtbar machen, wenn man durch ein Pfeifenmundstück ohne Pfeife, wie sie sich in physikalischen Sammlungen gewöhnlich vorfinden, einen mit Rauch oder Salmiaknebeln geschwängerten Luftstrom treibt. Jede aus einem Spaltbrenner brennende blattförmige Gasflamme ist übrigens ein Beispiel eines ähnlichen Vorgangs. In ihr werden durch den Verbrennungsprozeß die Grenzen zwischen der hervorströmenden Gasschicht und der atmosphärischen Luft sichtbar gemacht. Nur macht die Flamme nicht auch die Fortsetzung des Stromes sichtbar.
Wie nun eine solche Gasflamme von jedem Luftstrome, der ihre Fläche trifft, fortgeweht und gegen die eine oder andere Seite geneigt wird, so auch der blattförmige Luftstrom an der Mündung einer Orgelpfeife. Die Folge davon ist, daß zur Zeit, wo die Oszillation der in der Pfeife enthaltenen Luftmasse die Luft durch die Enden der Pfeife eintreten macht, auch der blattförmige Luftstrom des Mundstücks nach innen geneigt wird, und nun seine ganze Luftmenge in das Innere der Pfeife treibt. Während der entgegengesetzten Schwingungsphase dagegen, wo die Luft durch die Enden der Pfeife austritt, wird auch das Luftblatt seine ganze Masse nach außen werfen. Dadurch wird nun bewirkt, daß gerade zu den Zeiten, wo die Luft in der Pfeife am meisten verdichtet ist, noch mehr Luft vom Gebläse hineingetrieben und die Verdichtung, also auch das Arbeitsäquivalent der Luftschwingungen vergrößert wird, während in den Zeiten der Verdünnung in der Pfeife der Wind des Gebläses seine Luftmassen in den offenen Raum vor der Pfeife entleert. Es kommt dabei in Betracht, daß der blattförmige Luftstrom Zeit braucht, um die Breite der Mündung der Pfeife zu passieren, während dieser Zeit der Einwirkung der schwingenden Luftsäule ausgesetzt ist, und erst am Ende dieser Zeit an die Lippe gelangt, wo die beiden Wege nach außen und innen sich scheiden. Jedes hinzugeblasene Luftteilchen trifft also im Innern der Pfeife eine etwas spätere Phase der Schwingung, als die war, der es bei seinem Wege über die Öffnung ausgesetzt war. War die letztere Bewegung nach innen, so trifft es im Innern der Pfeife auf die hierauf folgende Verdichtung u. s. w.
Diese Art der Tonerregung bedingt nun auch die besondere Klangfarbe
der Orgelpfeifen. Wir können den blattförmigen Luftstrom als
sehr dünn im Vergleich zur Amplitude der Luftschwingungen betrachten.
Letztere beträgt in der Mundöffnung oft 10 bis 16 Millimeter,
wie man durch kleine Gasflammen, die man dieser Öffnung nähert,
erkennen kann. Es wird deshalb der Wechsel zwischen den Zeitperioden, wo
die ganze hinzugeblasene Luft in das Innere der Pfeife, und denen, wo sie
nach außen entleert wird, ziemlich plötzlich und fast momentan
sein. Daraus folgt dann12), daß die durch Anblasen erzeugten
Oszillationen ähnlicher Art sind, daß nämlich während
eines gewissen Teils jeder Schwingung die Geschwindigkeit der Luftteilchen
in der Mündung und im freien Raume einen konstanten, nach außen
gerichteten Wert habe, während eines zweiten Teils einen konstanten
nach innen gerichteten; und zwar wird bei kräftigem Anblasen im Allgemeinen
die nach innen gerichtete intensiver sein und kürzere Dauer haben;
bei schwächerem Anblasen kann es umgekehrt sein. Ferner wird ebenso
der Druck in der bewegten Luftmasse der Pfeife zwischen zwei konstanten
Werten ziemlich plötzlich wechseln müssen. Die Plötzlichkeit
dieses Übergangs wird nun allerdings dadurch gemäßigt,
daß der blattförmige Luftstrom nicht unendlich dünn ist,
sondern eine kurze Zeit gebraucht, um an der Lippe der Pfeife vorüberzugehen,
und daß zweitens die höheren Obertöne, deren Wellenlängen
den Durchmesser der Pfeife nur in mäßigem Verhältnisse
übertreffen, sich überhaupt unvollkommen ausbilden.
Daß die Wirklichkeit den hier aus der Mechanik des Anblasens gezogenen Schlüssen entspricht, zeigen die Versuche der Herren Toepler und Boltzmann13), die auf optischem Wege mittels der Interferenz des Lichtes, welches durch einen Knoten der schwingenden Luftmasse gegangen war, die Form der Druckoszillation im Innern der Pfeife beobachtbar gemacht haben. Sie fanden bei schwächerem Anblasen nahehin eine einfache Schwingung (je geringer die Oszillation des Luftblatts an der Lippe, desto mehr verwischen sich die Diskontinuitäten), dagegen bei stärkerem Anblasen einen sehr schnell erfolgenden Wechsel zwischen zwei verschiedenen Werten des Druckes, deren jeder während eines Bruchteils der Schwingung fast unverändert blieb.
13) Poggendorff's Annal. Bd. 141, S. 321 bis 352.
Andererseits bestätigen Versuche der Herren Mach und J. Hervert14), bei denen Gasflammen, vor der Öffnung einer offenen Pfeife brennend, die Schwingungen sichtbar machten, daß die beschriebene Bewegungsform an den Enden der Pfeifen vorhanden ist. Die von ihnen aus der Analyse der Flammenformen abgeleiteten Schwingungsformen entsprechen denen der Violinsaite, nur daß aus dem oben bezeichneten Grunde die Ecken abgerundet sind.
14) Poggendorff's Annal. Bd. 147, S. 590 bis 604.
Bei den engeren offenen Prinzipalpfeifen kann man mit Hilfe der Resonatoren deutlich die sechs ersten Partialtöne ihres Klanges hören.
Bei den weiteren offenen Pfeifen dagegen sind die nächstliegenden Eigentöne des Rohres alle etwas höher, als die entsprechenden harmonischen Töne des Grundtons, und deshalb werden die letzteren durch die Resonanz des Rohres viel weniger verstärkt. Die weiten Pfeifen, welche wegen ihrer größeren schwingenden Luftmasse und weil sie stärkeres Anblasen erlauben, ohne in einen Oberton überzuspringen, die Hauptklangmasse der Orgel geben, und deshalb Prinzipalstimmen heißen, bringen aus dem angeführten Grunde allein den Grundton stark und voll, mit schwächerer Begleitung von Nebentönen. Bei hölzernen Prinzipalpfeifen finde ich den ersten Oberton, die Oktave, sehr deutlich, den zweiten, die Duodecime, schon schwach, die höheren nicht mehr deutlich wahrnehmbar. Bei metallenen war auch noch der vierte Partialton wahrnehmbar. Die Klangfarbe dieser Pfeifen ist voller und weicher als die der Geigenprinzipale. Bei schwachem Anblasen in den Flötenregistern der Orgel und auf der Querflöte verlieren die Obertöne ebenfalls verhältnismäßig mehr an Stärke als der Grundton, und der Klang wird schwach und weich.
Eine andere Veränderung bieten die nach oben kegelförmig verengten Pfeifen aus den Registern Salicional, Gemshorn, Spitzflöte. Ihre obere Öffnung hat meist die Hälfte des Durchmessers des unteren Querschnitts; Salicional hat den engsten, Spitzflöte den größten Querschnitt bei gleicher Länge. Diese Pfeifen haben, wie ich finde, das Eigentümliche, daß einige höhere Teiltöne, der 5te bis 7te, verhältnismäßig deutlicher werden als die niederen. Der Klang ist leer, aber eigentümlich hell durch diesen Umstand.
Die gedackten zylindrischen Pfeifen haben bei enger Mensur eigene Töne, welche den ungeradzahligen Teiltönen des Grundtons, also dem 3ten oder der Duodecime, dem 5ten oder der höheren Terz etc. entsprechen. Bei den weiteren gedackten Pfeifen liegen, wie bei den weiten offenen Pfeifen, die nächsten eigenen Töne der Luftmasse merklich höher als die entsprechenden Obertöne des Grundtons, und letztere werden deshalb wenig oder gar nicht verstärkt. Weite gedackte Pfeifen, namentlich wenn sie schwach angeblasen werden, geben deshalb den Grundton fast rein. Wir haben sie schon vorher als Beispiele einfacher Töne angeführt. Engere lassen namentlich noch sehr deutlich die Duodecime mitklingen, was zu dem Namen derselben, Quintaten (quintam tenens), Veranlassung gegeben hat. Übrigens ist auch der 5te Teilton an diesen Pfeifen sehr deutlich, wenigstens wenn sie scharf angeblasen werden. Eine andere Abänderung der Klangfarbe entsteht bei der sogenannten Rohrflöte. Hier ist ein beiderseits offenes Röhrchen in den Deckel einer gedackten Pfeife eingesetzt, dessen Länge in den von mir untersachten Beispielen so groß war, wie eine offene Pfeife sein müßte, die den 5ten Teilton des Klanges geben sollte. Dadurch wird an diesen Pfeifen der 5te Teilton verhältnismäßig stärker als der ziemlich schwache dritte hervorgehoben, wodurch der Klang etwas eigentümlich Helles erhält. Im Vergleich mit dem der offenen Pfeifen hat der Klang der gedackten Pfeifen, dem also die geradzahligen Partialtöne fehlen, etwas Hohles; die weiten gedackten Register klingen dumpf, namentlich in der Tiefe, weich und unkräftig. Sie bilden durch ihre Weichheit aber einen sehr wirksamen Gegensatz gegen die schärferen Klangfarben der engeren offenen und der rauschenden Mixturregister, von denen schon oben die Rede gewesen ist, und welche bekanntlich durch Verbindung mehrerer Pfeifen, die einem Grundtone und seinen Obertönen entsprechen, zu einem Klange gebildet werden.
Die Holzpfeifen geben nicht so scharfes Blasegeräusch wie die metallenen, auch widerstehen ihre Wände nicht so gut der Erschütterung durch die Schallwellen, wobei die höheren Tonschwingungen leichter durch Reibung vernichtet zu werden scheinen. Holz gibt deshalb eine weichere oder dumpfere, weniger scharfe Klangfarbe.
Charakteristisch für alle diese Pfeifen ist weiter, daß ihr Ton leicht anspricht, und sie deshalb eine große Beweglichkeit musikalischer Figuren zulassen, aber die Stärke ihres Klanges erlaubt fast gar keine Abwechselung, da die Tonhöhe durch geringe Verstärkung des Blasens schon merklich gesteigert wird. Auf der Orgel muß deshalb Forte und Piano durch die Registerzüge hervorgebracht werden, indem man bald mehr, bald weniger Pfeifen, bald starke und scharf tönende, bald schwache und weiche ansprechen läßt. Die Mittel des Ausdrucks auf diesem Instrumente sind deshalb allerdings beschränkt, aber andererseits verdankt es offenbar einen Teil seiner großartigen Eigentümlichkeit dem Umstande, daß sein Ton in unveränderlicher Stärke, unberührt von subjektiven Erregungen hinaus strömt.
6. Klänge der Zungenpfeifen.
Der Ton der hierher gehörigen Instrumente wird in ähnlicher Weise wie der der Sirene hervorgebracht dadurch, daß der Weg des Luftstroms sich abwechselnd öffnet und schließt, wodurch denn der Luftstrom selbst in eine Reihe einzelner Luftstöße zerlegt wird.
In der Sirene geschieht dies, wie wir oben auseinander gesetzt haben, mittels der rotierenden durchlöcherten Scheibe; in den Zungenwerken sind es elastische Platten oder Bänder, welche in schwingende Bewegung gesetzt werden, und dabei die Öffnung, in der sie befestigt sind, bald schließen, bald frei lassen. Es gehören hierher:
l. Die Zungenpfeifen der Orgel und das Harmonium. Ihre Zungen, abgebildet perspektivisch in Fig. 28 A, im Durchschnitt Fig. 28 B, sind länglich viereckige Metallblättchen, zz, welche auf einer ebenen Messingplatte aa befestigt sind, in der hinter der Zunge eine Öffnung bb von gleicher Gestalt wie die Zunge angebracht ist. Wenn die Zunge in ihrer Ruhelage sich befindet, schließt sie die Öffnung ganz bis auf einen möglichst feinen Spalt längs ihres Randes. Wenn sie in Schwingung versetzt wird, schwankt sie zwischen den in Fig. 28 B mit z1 und z2 bezeichneten Stellungen hin und her. In der Stellung z1 ist, wie man sieht, eine Öffnung für die einströmende Luft gebildet, deren Richtung durch den Pfeil angedeutet ist; bei der entgegengesetzten Ausbeugung der Zungen nach z2 hin ist dagegen die Öffnung geschlossen. Die dargestellte Zunge ist eine durchschlagende, wie sie gegenwärtig allgemein gebräuchlich sind. Solche Zungen sind etwas kleiner, als die zugehörige Öffnung, so daß sie. sich in diese hineinbiegen können, ohne die Ränder der Öffnung zu berühren. Früher brauchte man auch aufschlagende Zungen, welche bei jeder Schwingung gegen ihren Rahmen schlugen; diese geben aber einen sehr rasselnden Ton und unsichere Tonhöhe.
Die Art, wie die Zungen in den Zungenregistern der Orgel befestigt sind, ist abgebildet in A und B, Fig. 29 (a. f. S.). A trägt oben einen Schallbecher, B ist der Länge nach durchschnitten gedacht; pp ist das Windrohr, in welches von unten der Wind eingetrieben wird; die Zunge l ist in der Rinne r, und diese in dem hölzernen Stopfen s befestigt; d ist der Stimmdraht. Dieser drückt unten gegen die Zunge; wenn man ihn tiefer hineinschiebt, macht man die Zunge kürzer und ihren Ton höher; umgekehrt, wenn man ihn herauszieht. Dadurch kann man leicht kleine Änderungen der Tonhöhe beliebig herbeiführen.
2. Ziemlich ähnlich konstruiert sind die aus elastischen Rohrplatten geschnitzten Zungen der Klarinette, der Oboe und des Fagotts. Die Klarinette hat nur eine breite Zunge, die ähnlich den beschriebenen Metallzangen vor einer entsprechenden Öffnung des Mundstücks befestigt ist und aufschlagen würde, wenn sie weite Exkursionen machte. Ihre Exkursionen sind aber klein, und sie wird durch den Druck der Lippen ihrem Rahmen nur so weit genähert, daß sie die Spalte hinreichend verengt, ohne aufzuschlagen. Bei der Oboe und dem Fagott stehen am Ende des Mundstücks zwei solche Rohrzungen einander gegenüber, welche durch einen schmalen Spalt getrennt sind und ebenfalls beim Blasen so weit an einander gedrängt werden, daß sie den Spalt schließen, so oft sie nach innen schwingen.
3. Membranöse Zungen. Ihre Eigentümlichkeiten studiert man am besten an künstlich verfertigten Zungen dieser Art. Zu dem Ende schneidet man das obere Ende eines hölzernen oder Guttapercha-Rohres von zwei Seiten her schräg so ab, wie Fig. 30 zeigt, daß zwei etwa rechtwinkelige Spitzen zwischen den beiden schrägen Schnittflächen stehen bleiben. Dann legt man mit leichter Spannung Streifchen von vulkanisiertem Kautschuk über die beiden Abdachungsflächen, so daß sie oben einen schmalen Spalt zwischen sich lassen, und umschlingt sie mit einem Faden. Auf solche Weise ist ein Zungenmundstück hergestellt, welches man beliebig mit Röhren oder anderen Lufträumen verbinden kann. Wenn die Membranen sich nach innen biegen, schließen sie den Spalt. Nach außen biegend, öffnen sie ihn. Solche schräg gestellte Membranen sprechen viel leichter an, als wenn man sie nach Johannes Müller's Vorschlag senkrecht gegen die Achse des Rohres stellt. Dann müssen sie erst durch den Luftdruck ausgebogen sein, ehe ihre Schwingung die Spalte abwechselnd zu öffnen und zu schließen beginnen kann. Man kann solche membranöse Zungen sowohl in Richtung der Pfeile anblasen, als in entgegengesetzter Richtung. Im ersten Falle öffnen sie den Spalt, wenn sie sich gegen den Luftbehälter, also nach der Tiefe der Röhrenleitung bewegen. Solche Zungen nenne ich einschlagende; sie geben angeblasen immer tiefere Töne, als wenn man sie frei schwingen läßt ohne Verbindung mit einem Luftraum. Die bisher erwähnten Zungen der Orgelpfeifen, des Harmonium und der Holzblasinstrumente sind ebenfalls stets als einschlagende gestellt. Man kann die membranösen (und auch die metallenen) Zungen aber auch entgegengesetzt gegen den Luftstrom stellen, so daß sie den Weg öffnen, wenn sie sich nach der äußeren Öffnung des Instrumentes hin bewogen. Dann nenne ich sie ausschlagende Zungen. Die Töne der ausschlagenden Zungen sind stets höher als die der isolierten Zunge.
Als musikalische Instrumente kommen nur zwei Arten solcher membranöser Zungen in Betracht, nämlich die menschlichen Lippen beim Anblasen der Blechinstrumente und der menschliche Kehlkopf im Gesange.
Die Lippen sind als sehr schwach elastische, mit vielem wasserhaltigem, unelastischem. Gewebe belastete membranöse Zangen zu betrachten, die deshalb verhältnismäßig sehr langsam schwingen würden, wenn man sie isoliert dazu bringen könnte. Sie bilden in den Blechinstrumenten ausschlagende Zungen, welche nach der eben angegebenen Regel höhere Töne geben müssen, als ihr Eigenton ist. Wegen ihres geringen Widerstandes werden sie aber beim Gebrauch der Blechinstrumente auch leicht durch den wechselnden Druck der schwingenden Luftsäule in Bewegung gesetzt.
Im Kehlkopfe spielen die elastischen Stimmbänder die Rolle membranöser Zungen. Sie sind von vorn nach hinten gespannt, ähnlich den Kautschukbändern der Fig. 30, und lassen zwischen sich einen Spalt, die Stimmritze. Sie haben vor allen künstlich nachgebildeten Zungen den Vorzug voraus, daß die Weite ihres Spalts, ihre Spannung und selbst ihre Form willkürlich außerordentlich schnell und sicher geändert werden kann. Hierzu kommt noch die große Veränderlichkeit des durch die Mundhöhle gebildeten Ansatzrohres. Es kann daher durch die Stimmbänder eine viel größere Mannigfaltigkeit von Klängen hervorgebracht werden, als durch irgend ein künstliches Instrument. Wenn man sie mit dem Kehlkopfspiegel von oben her betrachtet, während ein Ton hervorgebracht wird, so sieht man sie namentlich bei tieferen Brusttönen sehr ausgiebige Schwingungen machen, wobei die Stimmritze ganz eng geschlossen wird, so oft sie nach innen schlagen.
Die Tonhöhe der hier erwähnten verschiedenen Zungenwerke wird mittels sehr verschiedener Verfahrungsweisen geändert. Die metallenen Zungen der Orgel und des Harmonium sind immer nur für die Erzeugung eines einzigen Tones bestimmt. Auf die Bewegung dieser verhältnismäßig schweren und steifen Zungen hat der Druck der schwingenden Luft einen sehr geringen Einfluß, so daß auch ihre Tonhöhe innerhalb des Instrumentes sich nur wenig von derjenigen zu unterscheiden pflegt, welche die freie Zunge für sich gibt. Für jede Note müssen diese Instrumente mindestens eine Zunge haben.
In den Holzblasinstrumenten haben wir nur eine einzige Zunge,
welche für die ganze Notenreihe dienen muß. Die Zungen dieser
Instrumente sind aber aus leichtem, elastischem Holze gebildet, welches
durch den wechselnden Druck der schwingenden Luftmasse leicht in Bewegung
gesetzt wird und die Schwingungen der Luft mitmacht. Es können die
genannten Instrumente deshalb außer solchen sehr hohen Tönen,
die der eigenen Tonhöhe ihrer Zungen nahe entsprechen würden,
wie Theorie und Erfahrung übereinstimmend zeigen15), auch
noch andere, von dieser Tonhöhe weit entfernte tiefere Töne hervorbringen.
Nur müssen die in dem Rohre des Instrumentes entstehenden Luftwellen
noch im Stande sein, in dessen Tiefe, wo sich die Zunge befindet, einen
so starken Wechsel des Luftdrucks hervorzubringen, daß die Zunge
merklich bewegt wird. Der Druckwechsel in einer schwingenden Luftsäule
ist aber da am größten, wo die Geschwindigkeit der Luftteilchen
am kleinsten ist. Er ist folglich ein Maximum am Ende eines geschlossenen
Rohres, wie das der gedackten Orgelpfeifen ist, wo die Geschwindigkeit
immer gleich Null, also ein Minimum ist. Dadurch aber läßt sich
die Tonhöhe der besprochenen Töne der Zungenpfeife bestimmen.
Diese sind nämlich gleich denen, welche das Ansatzrohr allein hervorbringen
würde, wenn es am Orte der Zunge verschlossen wäre und als gedackte
Pfeife angeblasen würde. In der musikalischen Anwendung werden nun
diejenigen Töne dieser Instrumente, welche dem eigenen Tone der Zunge
entsprechen, gar nicht gebraucht, weil sie sehr hoch und kreischend sind,
auch ihre Tonhöhe nicht hinreichend unveränderlich sein kann,
wenn die Zunge feucht wird; es werden vielmehr nur solche Töne hervorgebracht,
welche viel tiefer als der Ton der Zunge sind, und deren Tonhöhe von
der Länge der Luftsäule abhängt, indem sie den eigenen Tönen
des gedackten Rohres entsprechen.
15) Siehe Helmholtz, Verhandlungen des naturhistorischen medizinischen Vereins zu Heidelberg vom 26. Juli 1861, in den Heidelberger Jahrbüchern. Poggendorff's Annalen 1861. [Wiss. Abh. Bd. I. S. 388.]
Die Klarinette hat ein zylindrisches Rohr, dessen Eigentöne dem dritten, fünften, siebenten etc. Teiltone des Grundtones entsprechen. Durch verändertes Anblasen kann man vom Grundtone auf die Duodecime oder die höhere Terz übergehen; außerdem läßt sich die akustische Länge des Rohres verändern, wenn man die Seitenlöcher der Klarinette öffnet, indem dann hauptsächlich nur die Luftsäule zwischen dem Mundstück und dem obersten geöffneten Seitenloch schwingt.
Die Oboe und das Fagott haben kegelförmige Röhren. Kegelförmige Röhren, welche bis zur Spitze ihres Kegels hin geschlossen sind, haben Eigentöne, welche denen von gleich langen offenen Röhren gleich sind. Dem entsprechend sind denn auch die Töne der beiden genannten Instrumente nahehin entsprechend denen von offenen Pfeifen. Durch Überblasung geben sie die Oktave, Duodecime, zweite Oktave etc. des Grundtones. Die Töne dazwischen werden durch Öffnung der Seitenlöcher gewonnen.
Die älteren Hörner und Trompeten bestehen aus einem langen kegelförmigen gewundenen Rohre ohne Klappen oder Ventile; sie können nur solche Töne geben, welche den eigenen Tönen des Rohres entsprechen, die hier wieder den natürlichen harmonischen Obertönen des Grundtones gleich sind. Da der Grundton eines so langen Rohres aber sehr tief ist, liegen die Obertöne in den mittleren Gegenden der Skala ziemlich nahe zusammen, namentlich bei dem sehr langen Rohre des Horns 16), so daß dadurch die meisten Stufen der Skala gegeben sind. Die Trompete war auf diese natürlichen Töne beschränkt, beim Horn konnte man mit der Faust, die den Schallbecher verengert, bei der Posaune durch den Auszug des Rohres die fehlenden Töne einigermaßen ergänzen, die unpassenden verbessern. In neuerer Zeit hat man Trompeten und Hörner vielfältig mit Klappen versehen, um die fehlenden Töne zu ergänzen, wobei aber die Kraft des Tones und der Glanz der Klangfarbe einigermaßen leidet. Die Schwingungen der Luft in diesen Instrumenten sind ungemein mächtig, und nur feste, glatte und undurchbrochene Röhren können ihnen vollen Widerstand leisten, so daß nichts von ihrer Kraft verloren geht. Beim Gebrauch der Blechinstrumente kommt die verschiedene Form und Spannung der Lippen des Bläsers nur insoweit in Betracht, als dadurch bestimmt wird, welcher von den eigenen Tönen des Rohres anspricht, während die Höhe der einzelnen Töne so gut wie unabhängig von der Spannung der Lippen ist.
16) Das Rohr des Waldhorns ist nach Zamminer 27 Fuß
lang, sein eigentlicher Grundton Es - 1; dieser
und der nächste, Es, werden nicht gebraucht, wohl aber die
weiteren Töne B, es, g, b, des' ,
es', f', g', as' a', b' etc.
Im menschlichen Kehlkopfe dagegen wird die Spannung der Stimmbänder, welche hier die membranösen Zungen bilden, selbst verändert und bestimmt die Höhe des Tones. Die mit dem Kehlkopfe verbundenen Lufthöhlen sind nicht geeignet, den Ton der Stimmbänder beträchtlich zu verändern; namentlich haben sie zu nachgiebige Wände, als daß in ihnen Luftschwingungen zu Stande kommen könnten, stark genug um den Stimmbändern eine Schwingungsperiode aufzudrängen, die nicht der von ihrer eigenen Elastizität geforderten sich anpaßt. Auch ist die Mundhöhle ein zu kurzes und meist zu weit geöffnetes Ansatzrohr, als daß ihre Luftmasse wesentlichen Einfluß auf die Tonhöhe haben könnte.
Außer der veränderten Spannung der Stimmbänder, welche nicht bloß durch Entfernung ihrer Ansatzpunkte an den Knorpeln des Kehlkopfes von einander vergrößert werden kann, sondern auch durch willkürliche Spannung der in ihnen gelegenen Muskelfasern, scheint auch die Dicke der Stimmbänder sich verändern zu können. Es liegt nach unten von den eigentlich elastischen Faserzügen und Muskelfasern der Stimmbänder noch viel weiches, mit Wasser getränktes, unelastisches Gewebe, welches bei der Bruststimme wahrscheinlich als Belastung der elastischen Bänder eine Rolle spielt und ihre Schwingungen verlangsamt. Die Fistelstimme entsteht wahrscheinlich dadurch, daß die unter den Bändern gelegene Schleimhautmasse nach der Seite gezogen wird, und so der Rand der Bänder schärfer, das Gewicht ihres schwingenden Teils vermindert wird, während ihre Elastizität dieselbe bleibt.
Wir kommen jetzt zur Erörterung der Klangfarbe der Zungenpfeifen, unserem eigentlichen Gegenstande. Der Schall wird in diesen Pfeifen erregt durch die intermittierenden Luftstöße, welche durch die von der Zunge begrenzte Öffnung während jeder einzelnen Schwingung hervorbrechen. Eine frei schwingende Zunge hat eine viel zu kleine Oberfläche, als daß sie eine irgend in Betracht kommende Quantität von Schallbewegung an die Luft abgeben könnte; ebenso wenig geschieht dies in den Pfeifen. Der Schall entsteht vielmehr ganz so, wie in der Sirene, deren Metallscheibe gar keine Schallschwingungen ausführt, nur durch die Luftstöße. Durch die wechselnde Öffnung und Verschließung des Kanals wird der kontinuierliche Fluß des Luftstroms in eine periodisch wiederkehrende Bewegung verwandelt, welche das Ohr zu affizieren vermag. Wie jede periodische Bewegung der Luft kann auch diese in eine Reihe von einfachen Schwingungen zerlegt werden. Schon früher ist bemerkt worden, daß die Zahl der Glieder einer solchen Reihe desto größer ist, je diskontinuierlicher die zu zerlegende Bewegung ist. Das ist nun die Bewegung der durch eine Sirene oder an einer Zunge vorbeiströmenden Luft in hohem Grade, da die einzelnen Luftstöße während der Zeiträume, wo die Öffnung geschlossen ist, meist durch vollständige Pausen von einander getrennt sein müssen. Freie Zungen ohne Ansatzrohr, bei denen alle die einzelnen einfachen Töne der von ihnen erregten Luftbewegung unmittelbar und frei an die umgebende Luftmasse übergehen, haben deshalb immer einen sehr scharfen, schneidenden oder schnarrenden Klang, und man hört in der Tat mit bewaffnetem oder unbewaffnetem Ohre eine lange Reihe von Obertönen bis zum sechzehnten oder zwanzigsten stark und deutlich, und selbst noch höhere Obertöne sind offenbar vorhanden, wenn auch schwer oder gar nicht von einander zu scheiden, da sie einander näher liegen als halbe Tonstufen. Dieses Gewirr dissonierender Töne macht die Klänge freier Zungen sehr unangenehm. Eine solche Art des Klanges zeigt ebenfalls, daß die Luftstöße die Quelle des Tones sind. Ich habe die schwingende Zunge einer Zungenpfeife, wie Fig. 30, während sie angeblasen wurde, nach Lissajous' Methode mit dem Vibrationsmikroskop beobachtet, um die Schwingungsform der Zunge zu ermitteln, und habe gefunden, daß die Zunge ganz regelmäßige einfache Schwingungen ausführt. Sie würde deshalb auch an die Luft nur einen einfachen Ton abgeben können, nicht einen zusammengesetzten Klang, wenn der erzeugte Schall wirklich direkt durch ihre Schwingungen hervorgebracht würde.
Übrigens ist nun die Stärke der Obertöne, welche eine Zunge ohne Ansatzrohr gibt, und ihr Verhältnis zum Grundton sehr abhängig von der Beschaffenheit der Zunge, von ihrer Stellung zum Rahmen, von der Dichtigkeit, mit der sie schließt etc. Aufschlagende Zungen, welche die am meisten diskontinuierlichen Luftstöße geben, geben auch den schärfsten Klang. Je kürzer die Luftstöße, je plötzlicher sie eintreten, desto mehr hohe Obertöne werden wir erwarten dürfen, ganz wie es bei der Sirene nach Seebeck's Untersuchungen der Fall ist. Hartes unnachgiebiges Material, wie das der Messingzungen, wird die Luftstöße viel abgerissener hervortreten lassen, als weiches nachgiebiges. Hierin haben wir wahrscheinlich hauptsächlich den Grund zu suchen, warum unter allen Klängen von Zungenpfeifen die menschlichen Gesangstöne gut gebildeter Kehlen sich durch Weichheit auszeichnen. Indessen ist auch an den menschlichen Stimmen, namentlich wenn sie in angestrengtem Forte gebraucht werden, die Zahl der hohen Obertöne sehr groß, sie reichen noch sehr deutlich und kräftig bis in die viergestrichene Oktave hinauf, worauf wir gleich nachher zurückkommen werden.
Wesentlich verändert sich nun der Klang der Zungen durch die Ansatzröhren, indem nämlich diejenigen Obertöne, welche eigenen Tönen des Ansatzrohres entsprechen, beträchtlich verstärkt werden und hervortreten, ähnlich wie das bei den Orgelpfeifen mit den Tönen des Luftgeräusches geschah. Die Ansatzröhren müssen dabei als an der Stelle der Zunge geschlossen betrachtet werden 17).
Wenn man statt der Glaskugel andere Aufsatzröhren anwendet, welche eine größere Anzahl von eigenen Tönen haben, so erhält man auch zusammengesetztere Klänge. An der Klarinette haben wir ein zylindrisches Rohr, welches durch seine Resonanz die ungeradzahligen Obertöne des Klanges verstärkt. Die kegelförmigen Röhren der Oboen, Fagotte, Trompeten und Hörner verstärken dagegen sämtliche harmonische Obertöne des Klanges bis zu einer gewissen Höhe hinauf. Für Tonwellen nämlich, deren Länge die Weite der Öffnungen nicht bedeutend übertrifft, geben die Röhren keine Resonanz mehr. So habe ich denn in der Tat in dem Klange der Klarinetten nur ungerade Obertöne gefunden, deutlich bis zum siebenten hinauf, während die Klänge der übrigen genannten Instrumente, deren Röhren kegelförmig sind, auch die geradzahligen enthalten. Über die weiteren Unterschiede des Klanges der einzelnen Instrumente mit kegelförmigen Röhren hatte ich aber bis jetzt keine Gelegenheit Beobachtungen zu machen. Es ist dies ein ziemlich weitläufiges Feld der Untersuchung, da die Klangfarbe auch durch die Art des Anblasens sich vielfältig verändert und selbst an demselben Instrumente die verschiedenen Teile der Skala, wenn sie die Eröffnung von Seitenlöchern erfordern, ziemlich verschiedene Klangfarbe haben. Namentlich sind an den Holzblasinstrumenten diese Unterschiede auffallend. Die Eröffnung von Seitenlöchern ist kein ganz vollständiger Ersatz für die Verkürzung des Rohres, und die Reflexion der Schallwellen geschieht dort nicht wie an einem freien offenen Ende des Rohres. Die Obertöne eines solchen Rohres, welches durch ein geöffnetes Seitenloch abgegrenzt ist, werden meist beträchtlich abweichen müssen von der harmonischen Reinheit, und dies wird auf ihre Resonanz merklichen Einfluß haben.
7. Klänge der Vokale.
Wir haben bisher diejenigen Fälle von Resonanz des Ansatzrohres besprochen, wo dasselbe im Stande war zunächst den Grundton und außer diesem noch eine gewisse Anzahl von den harmonischen Obertönen des betreffenden Klanges zu verstärken. Es kann nun auch der Fall vorkommen, daß der tiefste Ton des Ansatzrohres nicht dem Grundton, sondern einem der Obertöne des Klanges entspricht, und in solchen Fällen finden wir den bisher entwickelten Grundsätzen gemäß, daß in der Tat der betreffende Oberton auch mehr als der Grundton und die übrigen Obertöne durch die Resonanz des Ansatzrohres verstärkt wird und sich deshalb aus der Reihe der übrigen Obertöne besonders stark heraushebt. Der Klang bekommt dadurch einen besonderen Charakter, er wird nämlich einem der Vokale der menschlichen Stimme mehr oder weniger ähnlich. Denn in der Tat sind die Vokale der menschlichen Stimme Töne membranöser Zungen, nämlich der Stimmbänder, deren Ansatzrohr, die Mundhöhle, verschiedene Weite, Länge und Stimmung erhalten kann, so daß dadurch bald dieser, bald jener Teilton des Klanges verstärkt wird18).
18) Die Theorie der Vokaltöne ist zuerst von Wheatstone in einer leider wenig bekannt gewordenen Kritik über die Versuche von Willis aufgestellt worden. Diese Versuche sind beschrieben in Transact. of Cambridge Phil. Soc. T. III. p. 231. Poggend. Annalen der Physik. Bd. XXIV. S. 897. Wheatstone's Bericht darüber in London and Westminster Review 1837 Oktober.
Um die Zusammensetzung der Vokalklänge zu begreifen, muß man zunächst berücksichtigen, daß der Ursprung ihres Schalles in den Stimmbändern liegt. Diese wirken bei laut tönender Stimme als membranöse Zungen und bringen wie alle Zungen zunächst eine Reihe entschieden diskontinuierlicher und schart getrennter Luftstöße hervor, die, wenn sie als eine Summe einfacher Schwingungen dargestellt werden sollen, einer sehr großen Anzahl von solchen Schwingungen entsprechen und deshalb im Ohre als ein aus einer ziemlich langen Reihe von Obertönen zusammengesetzter Klang erscheinen. Mit Hilfe der Resonanzröhren kann man in tiefen, kräftig gesungenen Baßnoten bei den helleren Vokalen sehr hohe Obertöne, selbst bis zum sechszehnten hin, erkennen, und bei etwas angestrengtem Forte der höheren Noten jeder menschlichen Stimme erscheinen deutlicher als bei allen anderen Tonwerkzeugen hohe Obertöne aus der Mitte der viergestrichenen Oktave (der obersten Oktave der neuen Klaviere), von deren besonderer Beziehung zum Ohre wir später noch sprechen werden. Die Stärke der Obertöne, namentlich der ganz hohen, ist übrigens ziemlich großen individuellen Verschiedenheiten unterworfen. Sie ist bei scharfen und hellen Stimmen größer als bei weichen und dumpfen. Bei scharfen Stimmen mag der Grund ihrer Klangfarbe vielleicht darin zu suchen sein, daß die Ränder der Stimmbänder nicht glatt oder gerade genug sind, um sich zu einem engen geradlinigen Spalte zusammenlegen zu können, ohne dabei aneinander zu stoßen, und daß dadurch der Kehlkopf sich mehr den aufschlagenden Zungenwerken nähert, die eine viel schärfere Klangfarbe haben, während die normalen Stimmbänder durchschlagende Zangen sind. Bei heiseren Stimmen kann vielleicht der Grund darin gesucht werden, daß kein ganz vollkommener Schluß der Stimmritze zu Stande kommt, während die Bänder schwingen. Wenigstens erhält man von künstlichen membranösen Zungen ähnliche Abänderungen des Klanges, wenn man entsprechende Änderungen ihrer Stellung ausführt. Zu einem starken und doch weichen Klange der Stimme ist es nötig, daß die Stimmbänder auch bei den stärksten Schwingungen in den Augenblicken, wo sie sich einander nähern, sich geradlinig ganz eng an einander stellen, so daß sie momentan die Stimmritze vollständig schließen, ohne doch auf einander zu schlagen. Wenn sie nicht vollständig schließen, wird der Luftstrom nicht vollständig unterbrochen, und der Ton kann nicht stark werden. Wenn sie aneinanderschlagen, muß, wie schon bemerkt ist, der Klang scharf werden, wie von aufschlagenden Zungen. Wenn man durch den Kehlkopfspiegel die tönenden Stimmbänder betrachtet, ist es auffallend, mit welcher Genauigkeit sie schließen bei Schwingungen, deren Breite fast der ganzen Breite der Bänder gleich ist.
Übrigens findet beim Sprechen und beim Singen eine gewisse Verschiedenheit im Ansatz der Stimme statt. Beim Sprechen bringen wir einen viel schärferen Klang, namentlich der offenen Vokale, hervor und fühlen im Kehlkopf einen stärkeren Druck. Ich vermute, daß beim Sprechen die Stimmbänder als aufschlagende Zungen gestellt werden.
Wenn die Schleimhaut des Kehlkopfes catarrhalisch ist, sieht man durch den Kehlkopfspiegel zuweilen kleine Schleimflöckchen in die Stimmritze eintreten. Diese stören, wenn sie zu groß sind, die Bewegung der schwingenden Bänder und machen sie unregelmäßig, wobei auch der Klang unregelmäßig, knarrend oder heiser wird. Übrigens ist merkwürdig, wie verhältnismäßig große Schleimflöckchen in der Stimmritze liegen können, ohne eine gerade sehr auffallende Verschlechterung des Klanges hervorzubringen.
Es ist schon erwähnt worden, daß es meist viel schwerer ist, die Obertöne der menschlichen Stimme mit unbewaffnetem Ohre zu erkennen, als die Obertöne anderer Tonwerkzeuge; die Resonatoren sind für diese Untersuchung notwendiger, als für die Analyse irgend eines anderen Klanges. Doch sind sie zuweilen von aufmerksamen Beobachtern gehört worden; schon Rameau hat sie im Anfang des vorigen Jahrhunderts gekannt, und später erwähnt Seiler in Leipzig, daß er in schlaflosen Nächten, auf den Gesang des Nachtwächters lauschend, zuweilen anfangs aus der Ferne die Duodecime des Gesanges gehört habe, und später erst den Grundton. Der Grand dieser Schwierigkeit ist wohl darin zu suchen, daß wir die Klänge der menschlichen Stimme mehr, als irgend welche andere, unser Leben hindurch immer nur in der Absicht, sie als ein Ganzes aufzufassen und die mannigfachen Abänderungen ihrer Klangfarbe genau kennen zu lernen und wahrzunehmen, verfolgt und beobachtet haben.
Wir dürfen wohl annehmen, daß bei den Klängen des menschlichen Kehlkopfes, wie bei denen anderer Zungenwerke, die Obertöne mit steigender Höhe an Stärke kontinuierlich abnehmen würden, wenn wir sie ohne die Resonanz der Mundhöhle beobachten könnten. In der Tat entsprechen sie dieser Annahme ziemlich gut bei denjenigen Vokalen, welche mit trichterförmig weit geöffneter Mundhöhle gesprochen werden, nämlich beim scharfen A oder A. Dieses Verhältnis wird nun aber sehr wesentlich verändert durch die Resonanz in der Mundhöhle. Je mehr die Mundhöhle verengert ist durch die Lippen, die Zähne oder die Zunge, desto entschiedener kommt ihre Resonanz für Töne von ganz bestimmter Höhe zum Vorschein, und desto mehr verstärkt sie dann auch in dem Klange der Stimmbänder diejenigen Obertöne, welche sich den bevorzugten Graden der Tonhöhe nähern; desto mehr werden dagegen die übrigen gedämpft. Bei der Untersuchung des Klanges der menschlichen Stimme mittels der Resonatoren findet man deshalb wohl ziemlich regelmäßig die ersten sechs bis acht Obertöne zwar deutlich wahrnehmbar, aber je nach den verschiedenen Stellungen der Mundhöhle in sehr verschiedener Stärke, bald mächtig in das Ohr hineinschmetternd, bald kaum vernehmbar.
Unter diesen Verhältnissen ist die Untersuchung der Resonanz in der Mundhöhle von großer Wichtigkeit. Das sicherste und leichteste Verfahren, diejenigen Töne zu finden, auf welche die Luftmasse der Mundhöhle in den verschiedenen Stellungen abgestimmt ist, die sie zur Hervorbringung der verschiedenen Vokale annimmt, ist dasselbe, welches man für Glasflaschen und andere Lufträume anwendet. Man nimmt nämlich angeschlagene Stimmgabeln von verschiedener Höhe und bringt sie vor die Mündung des Luftraumes, in unserem Falle vor den geöffneten Mund, wobei man dann den Ton der Stimmgabel um so stärker hört, je genauer er einem der eigenen Töne der in der Mundhöhle eingeschlossenen Luftmasse entspricht. Da man die Stellung der Mundhöhle willkürlich verändern kann, so läßt sie sich denn auch stets dem Tone einer gegebenen Stimmgabel anpassen, und man ermittelt also auf diese Weise leicht, welche Stellungen man der Mundhöhle geben müsse, damit ihre Luftmasse auf eine bestimmte Tonhöhe abgestimmt sei.
Es stand mir eine Reihe von Stimmgabeln zu Gebot, mit denen ich bei einer solchen Untersuchung folgende Resultate gefunden habe.
Die Tonhöhen stärkster Resonanz der Mundhöhle hängen nur ab von dem Vokale, für dessen Bildung man die Mundteile zurecht gestellt hat, und ändern sich ziemlich beträchtlich selbst bei kleinen Abänderungen in der Klangfarbe des Vokals, wie sie etwa in verschiedenen Dialekten derselben Sprache vorkommen. Dagegen sind die Eigentöne der Mundhöhle fast unabhängig von Alter und Geschlecht. Ich habe im Allgemeinen dieselben Resonanzen bei Männern, Frauen und Kindern gefunden. Was der kindlichen und weiblichen Mundhöhle an Geräumigkeit abgeht, kann durch engeren Verschluß der Öffnung leicht ersetzt werden, so daß die Resonanz doch eben so tief werden kann, wie in der größeren männlichen Mundhöhle.
Die Vokale zerfallen in drei Reihen nach der Stellung der Mundteile, welche wir mit dem älteren du Bois-Reymond19) folgendermaßen hinschreiben können:
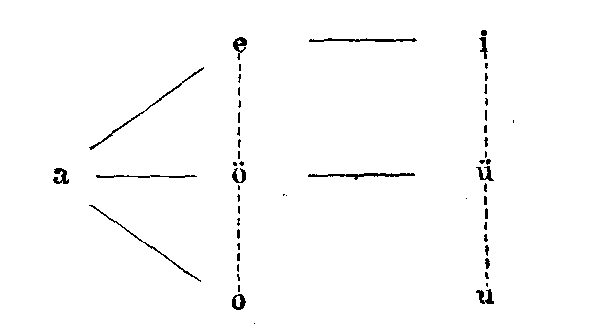
19) Norddeutsche Zeitschrift, redigiert von de la Motte Fonqué 1812. Kadmus oder allgemeine Alphabetik von F. H. du Bois-Reymond, Berlin 1862, S. 152.
Der Vokal A bildet den gemeinsamen Ausgangspunkt für alle drei Reihen. Ihm entspricht eine sich vom Kehlkopf ab ziemlich gleichmäßig trichterförmig erweiternde Gestalt der Mundhöhle. Bei den Vokalen der untersten Reihe O und U wird die Mundhöhle vorn mittels der Lippen verengert, so daß sie beim U vorn am engsten ist, während sie durch Herabziehen der Zunge in ihrer Mitte möglichst erweitert wird, im Ganzen also die Gestalt einer Flasche ohne Hals erhält, deren Öffnung, der Mund, ziemlich eng ist, deren innere Höhlung aber nach allen Richtungen hin ohne weitere Scheidung zusammenhängt. Die Tonhöhe solcher flaschenförmigen Räume ist desto tiefer, je weiter der Hohlraum und je enger seine Mündung ist. Gewöhnlich läßt sich nur ein Eigenton mit starker Resonanz deutlich erkennen; wenn andere eigene Töne existieren, so sind sie verhältnismäßig sehr hoch und haben nur schwache Resonanz. Diesen an Glasflaschen gemachten Erfahrungen entsprechend findet man, daß bei einem ganz dumpfen U, wo die Mundhöhle am weitesten und der Mund am engsten ist, die Resonanz am tiefsten ausfällt, nämlich dem ungestrichenen f entspricht. Wenn man das U in O überführt, steigt die Resonanz allmählich, so daß bei einem vollklingenden reinen O die Stimmung der Mundhöhle gleich V ist. Die Stellung des Mundes beim O ist besonders günstig für die Resonanz; die Öffnung des Mundes ist weder zu groß noch zu klein, und die Höhle hinreichend geräumig. Wenn man daher eine auf V gestimmte Gabel angeschlagen vor die Mundöffnung bringt, während man O leise spricht, oder auch nur die Mundteile in die Stellung bringt, als wollte man O sprechen, so hört man den Ton der Stimmgabel sehr voll und laut wiederklingen, so daß ein ganzes Auditorium ihn hören kann. Man kann auch die gewöhnlich von den Musikern gebrauchten, auf a' gestimmten Gabeln für denselben Zweck benutzen, nur muß man dann das O schon ein wenig dumpfer aussprechen, um die volle Resonanz zu erhalten.
Führt man die Mundhöhle aus der Stellung des O durch die des O und A allmählich über in die des A, so steigt dem entsprechend die Resonanz allmählich um eine Oktave bis b''. Dieser Ton entspricht dem norddeutschen A; das etwas schärfere A der Engländer und Italiener steigt bis zur Tonhöhe d'", also noch eine Terz höher. Übrigens ist es gerade beim A besonders auffallend, wie kleine Verschiedenheiten in der Tonhöhe beträchtlichen Abänderungen in dem Klange des Vokals entsprechen, und ich möchte deshalb Sprachgelehrten für die Definition der Vokale verschiedener Sprachen besonders empfehlen, die Tonhöhe stärkster Resonanz für die Mundhöhle festzustellen.
Bei den bisher genannten Vokalen habe ich keinen zweiten Eigenton auffinden können, auch ist es nach der Analogie der Erscheinungen, welche ähnliche künstlich hergestellte Lufträume zeigen, kaum zu erwarten, daß ein solcher in merklicher Stärke existiert. Später zu beschreibende Versuche werden zeigen, daß die Resonanz dieses einen Tones in der Tat genügt, die genannten Vokale zu charakterisieren.
Die zweite Reihe der Vokale, zu der wir uns wenden, enthält die Folge A, Ä, E, I. Die Lippen werden so weit zurückgezogen, daß sie den Luftstrom nicht mehr beengen, dagegen entsteht eine neue Verengerung zwischen dem vorderen Teile der Zunge und dem harten Gaumen, während der Raum unmittelbar über dem Kehlkopfe sich dadurch erweitert, daß die Zungenwurzel eingezogen wird, wobei gleichzeitig der Kehlkopf emporsteigt. Die Form der Mundhöhle nähert sich dabei derjenigen einer Flasche mit einem engen Halse. Der Bauch der Flasche liegt hinten im Schlunde, der Hals ist der enge Kanal zwischen der oberen Fläche der Zunge und dem harten Gaumen. In der angegebenen Reihenfolge dieser Buchstaben A, E, I nehmen diese Veränderungen zu, so daß beim I der Hohlraum der Flasche am größten, der Hals am engsten ist. Beim Ä ist der ganze Kanal dagegen noch ziemlich weit, so daß man mit dem Kehlkopfspiegel sehr gut bis in den Kehlkopf hineinsehen kann. Ja dieser Vokal gibt sogar für die Anwendung dieses Instruments die allerbeste Mundstellung, weil die Zungenwurzel, welche beim A die Einsicht noch hindert, eingezogen ist, und man an ihr vorbeigehen kann.
Wenn man eine mit einem engen Halse versehene Flasche als Resonanzraum anwendet, findet man leicht zwei Töne, von denen der eine angesehen werden kann als Eigenton des Bauches, der andere als ein solcher des Halses der Flasche. Allerdings kann die Luft des Bauches nicht ganz unabhängig von der des Halses schwingen, und die betreffenden eigenen Töne beider Teile müssen deshalb etwas anders, und zwar tiefer ausfallen, als waren Bauch und Hals von einander getrennt und würden einzeln auf ihre Resonanz geprüft. Der Hals bildet annähernd eine kurze an beiden Enden offene Pfeife. Zwar mündet sein inneres Ende nicht frei in den offenen Luftraum ans, sondern nur in den Hohlraum der Flasche, aber wenn der Hals nur recht eng, der Bauch der Flasche recht weit ist, kann letzterer einigermaßen als offener Raum angesehen werden im Verhältnis zu den Schwingungen der im Halse eingeschlossenen Luft. Diese Bedingung trifft am meisten beim I zu; die Länge des Kanals zwischen Zunge und Gaumen von den Oberzähnen bis zum hinteren Rande des knöchernen Gaumens gemessen beträgt etwa 6 Zentimeter. Eine offene Pfeife von dieser Länge angeblasen würde den Ton e"" geben, während die Beobachtungen für den verstärkten Ton des I ungefähr d"" ergeben, was so weit übereinstimmt, als man bei der Berechnung der Tonhöhe einer so unregelmäßig gebildeten Pfeife, wie die zwischen Zunge und Gaumen nur irgend erwarten kann.
Die Vokale Ä, E und I haben dem entsprechend einen höheren und einen tieferen Resonanzton. Die höheren Töne setzen die aufsteigende Reihe von Eigentönen der Vokale U, O, A fort. Mit Stimmgabeln habe ich für A den Ton g'" bis as'" gefunden, für E den Ton b'". Für I hatte ich keine passende Gabel mehr; man kann sich aber hier helfen mittels des Luftgeräusches, welches ich gleich nachher besprechen werde, und dieses ergibt ziemlich bestimmt d"".
Die tieferen Eigentöne, welche der hinteren Abteilung der Mundhöhle angehören, sind etwas schwerer zu bestimmen. Man kann dazu Stimmgabeln anwenden; doch ist die Resonanz verhältnismäßig schwach, weil sie eben durch den langen engen Hals des Luftraumes hindurchgeleitet werden muß. Es ist ferner darauf zu achten, daß diese Resonanz nur eintritt, so lange man den betreffenden Vokal mit der Flüsterstimme leise angibt, und schwindet, wenn man schweigt, weil sich im letzteren Falle sogleich die Gestalt der Höhle ändert, von der diese Resonanz abhängt. Man muß auch die angeschlagene Stimmgabel möglichst nahe an die hinter den Oberzähnen gelegene Öffnung des Luftraumes bringen. So fand ich für das Ä d'", für das E f'. Für I konnte ich sie nicht direkt mit den Stimmgabeln beobachten; doch schließe ich aus den Obertönen, daß sie etwa so tief wie die des U bei f liegt. Wenn man also vom A zum I übergeht, steigen diese tieferen Eigentöne der Mundhöhle herab, während die höheren aufsteigen.
Bei der dritten Reihe von Vokalen, welche von A durch Ö nach Ü übergeht, haben wir im Innern des Mundes dieselbe Stellung der Zunge wie für die vorhergehende Reihe. Für das Ü nämlich ungefähr dieselbe wie für einen zwischen E und I in der Mitte gelegenen Vokal, für das Ö dagegen dieselbe wie für ein E, welches ein wenig nach A zieht. Außer der Verengerung, welche hier wie bei der zweiten Reihe zwischen Zunge und Gaumen besteht, verengern sich aber auch die Lippen wieder, und zwar so, daß sie sich ebenfalls so gut sie können zu einer Röhre formen und somit eine vordere Verlängerung der zwischen Zunge und Gaumen liegenden Röhre bilden. Der Luftraum der Mundhöhle im Ganzen ist also auch bei diesen Vokalen einer mit einem Halse versehenen Flasche ähnlich geformt, deren Hals aber länger ist als bei den Vokalen der zweiten Reihe. Beim I fand ich diesen Hals 6 Zentimeter lang, beim U beträgt seine Länge, von dem vorderen Rande der Oberlippe bis zum Anfang des weichen Gaumens gemessen, 8 Zentimeter. Die Tonhöhe des höheren Eigentons, welcher der Resonanz des Halses entspricht, muß dadurch ungefähr um eine Quarte tiefer werden als beim I. Der Rechnung nach müßte diese Pfeife h'" geben, wenn ihre beiden Enden frei Wären; in Wirklichkeit resoniert sie durch eine Stimmgabel, deren Ton zwischen g"' und as'" liegt, wie wir denn auch beim I eine solche Abweichung gefunden haben, welche in diesem wie in jenem Falle wohl dadurch zu erklären ist, daß das hintere Ende dieser Röhre zwar in einen erweiterten, aber doch nicht ganz freien Raum ausmündet. Die Resonanz des hinteren Raumes ist nach denselben Regeln zu beobachten, wie bei den Vokalen der I-Reihe. Sie findet sich bei Ö gleich der von E, nämlich f', bei Ü gleich der von I, nämlich f.
Die Tatsache, daß die Mundhöhle bei verschiedenen Vokalen auf verschiedene Tonhöhen abgestimmt sei, ist zuerst von Donders20) aufgefunden worden, und zwar nicht mit Hilfe von Stimmgabeln, sondern mittels des Geräusches, welches beim Flüstern der Luftstrom im Munde hervorbringt. Die Mundhöhle wird dabei gleichsam wie eine Orgelpfeife angeblasen und verstärkt durch ihre Resonanz die entsprechenden Töne des Luftgeräusches, welches teils in der verengerten Stimmritze21), teils in den vorderen verengten Stellen des Mundes, wenn solche vorhanden sind, hervorgebracht wird. Dabei kommt es allerdings gemeiniglich nicht zu einem vollen Ton; nur beim V und O kann das Luftgeräusch ohne merkliche Änderung des Vokals zu einem solchen gesteigert werden, indem man mit dem Munde zu pfeifen beginnt. Beim Sprechen wäre dies aber ein Fehler. Vielmehr tritt gewöhnlich nur dieselbe Art der Verstärkung des Luftgeräusches ein, wie bei einer Orgelpfeife, welche wegen falscher Stellung der Lippe oder ungenügender Windstärke nicht gut anspricht. Doch zeigt ein solches Geräusch, wenn es auch nicht zum vollen musikalischen Tone wird, schon eine ziemlich eng begrenzte Tonhöhe, welche sich durch ein geübtes Ohr bestimmen läßt. Nur irrt man sich, wie in allen solchen Fällen, wo Töne von sehr verschiedener Klangfarbe zu vergleichen sind, leicht in der Oktave. Hat man aber einige von den Tonhöhen, auf die es ankommt, mittels der Resonanz von Stimmgabeln bestimmt, andere, wie Ü und Ö, dadurch, daß man sie in regelmäßiges Pfeifen überführt, so sind die übrigen leicht zu bestimmen, indem man sie mit den ersteren in melodischer Folge zusammenfügt. So gibt die Folge:
Scharfes A, Ä, E, I
d'" g'" b'" d""
einen aufsteigenden Quartsextenakkord des g-Moll-Dreiklanges, und läßt
sich leicht mit der entsprechenden Tonfolge auf dem Klavier vergleichen.
Die Lage des A, A und E konnte ich noch mittels
der Stimmgabeln bestimmen, und dadurch auch die des I festsetzen22).
20) Archiv für die Holländischen Beiträge für Natur- und Heilkunde von Donders und Berlin. Bd. I, 8. 157. Ältere unvollständige Wahrnehmungen über denselben Gegenstand bei Samuel Reyher Mathesis mosaica, Kiel 1619. Chr. Hellwag de formatione loquelae Diss. Tubingae 1780. Flörke, Neue Berliner Monatsschrift, Septbr. 1803, Febr. 1804. Olivier, Ortho-epo-graphisches Elementarwerk 1804, Thl. III, S. 21.
21) Es ist der hinterste Teil der Stimmritze zwischen den Gießbeckenknorpeln, welcher beim Flüstern als dreieckige Öffnung offen bleibt und die Luft passieren läßt, während die Stimmbänder aneinander gelegt werden.
22) Die Angaben von Donders differieren etwas von
den meinigen, teils weil sie sich auf die holländische Aussprache
beziehen, meine auf die norddeutsche, teils weil Donders, nicht
unterstützt durch Stimmgabeln, die Oktave nicht sicher finden konnte,
in welche die gehörten Geräusche zu legen sind. Folgende Tafel
zeigt diese Abweichungen:
| Vokal | Tonhöhe nach Donders. | Tonhöhe nach Helmholtz. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Für das U ist es ebenfalls nicht ganz leicht, die Resonanzhöhe mittels der Stimmgabel zu finden; die Resonanz ist wegen der kleinen Öffnung des Mundes ziemlich schwach. Hier hat mich ein anderes Phänomen geleitet. Wenn ich von c die Skala aufwärts auf den Vokal U singe, fühle ich, wie die Erschütterung der Luft im Munde und selbst an den Trommelfellen beider Ohren, wo sie Kitzel erregt, am heftigsten wird, wenn ich bis f gelangt bin, vorausgesetzt, daß ich mich bemühe, ein dumpfes U festzuhalten, ohne es in O übergehen zu lassen. Sobald ich f überschreite, ändert sich die Klangfarbe, die starke Erzitterung im Munde und das Kitzeln in den Ohren hört auf. Es ist hier bei der Note f ganz dieselbe Erscheinung, als wenn man eine Zunge mit einer kugelförmigen Ansatzröhre verbindet, deren eigener Ton dem der Zunge nahehin entspricht. Auch dann erhält man eine ungemein kräftige Erschütterung der Luft im Innern der Kugel, und einen plötzlichen Sprung in der Klangfarbe, wenn man von einer tieferen Tonhöhe der Luftmasse durch die Tonhöhe des Zungentons hindurch zu einer höheren übergeht. Dadurch bestimmt sich die Resonanz der Mundhöhle für das dumpfe U auf die Höhe von f noch sicherer als mittels der Stimmgabeln. Aber vielfach wird auch ein U mit hellerer Resonanz, dem O ähnlicher, gebildet, welches ich mit der französischen Bezeichnung Ou versehen will. Dessen Eigenton kann bis f' steigen.

Es lassen sich diese Unterschiede in den Obertönen der verschiedenen Vokallaute mittels der Resonatoren sehr leicht und deutlich erkennen, wenigstens soweit es sich um Töne der eingestrichenen und zweigestrichenen Oktave handelt. Man setze zum Beispiel einen Resonator, der auf b' abgestimmt ist, an das Ohr und lasse nun eine Baßstimme, welche geübt ist, die Tonhöhe gut festzuhalten und die Vokale richtig zu bilden, auf einen der harmonischen Untertöne des b', sei es b oder es oder B, Ges, Es, der Reihe nach die Vokale in gleichmäßiger Stärke singen. Man wird finden, daß bei einem reinen volltönenden O das b' des Resonators mächtig in das Ohr hineinschmettert. Demnächst ist derselbe Oberton in einem scharfen A und einem Mittelton von A und Ö noch sehr kräftig, schwächer bei A, E, Ö, am schwächsten bei U und I. Auch findet man leicht, daß die Resonanz des O sich merklich schwächt, wenn man es entweder dumpfer macht und dem U nähert, oder wenn man es offener bildet, daß es A wird. Nimmt man dagegen den Resonator eine Oktave höher, b", so ist es nun der Vokal A, welcher den Resonator am kräftigsten mittönen läßt, während das beim ersten Resonator kräftig wirkende O hier eine geringe Wirkung hat.
Für die hohen Obertöne des A, E, I lassen sich nun allerdings keine Resonatoren beschaffen, welche eine erhebliche Verstärkung der betreffenden Obertöne zu geben im Stande sind. Hier ist man also doch wieder hauptsächlich auf die Beobachtungen des unbewaffneten Ohres angewiesen. Diese Verstärkungstöne in dem Klange der Stimme zu entdecken, hat mir deshalb viel Mühe gekostet, und ich habe sie bei meinen früheren Veröffentlichungen23) über diesen Gegenstand noch nicht gekannt. Zu ihrer Beobachtung ist es besser, hohe Töne weiblicher Stimmen oder männlicher Fistelstimmen singen zu lassen. Die Obertöne hoher Noten liegen in der betreffenden Gegend der Skala nicht so nahe aneinander, wie die von tiefen Noten, und man unterscheidet sie deshalb leichter von einander. Auf dem b' zum Beispiel können weibliche Stimmen noch bequem alle Vokale volltönend herausbringen, höher hinauf ist die Auswahl beschränkter. Dann hört man die Duodecime f'" bei einem breiten Ä, die Doppeloktave b'" bei E, und die hohe Terz d"" bei I deutlich, letztere oft sogar recht durchdringend, hervortreten.
23) Gelehrte Anzeigen der Bayerischen Akademie der Wissenschaften. 18. Juni 1859. Wiss. Abh. Bd. I. S. 397.
Ich bemerke noch, daß die auf der vorigen Seite gegebene Zusammenstellung von Noten sich auf diejenigen Arten der Vokale erstreckt, welche mir den am meisten charakteristischen Klang zu haben scheinen, daß aber auch alle kontinuierlich in einander übergehenden Zwischenstufen möglich sind, und teils in Dialekten, teils von einzelnen Individuen, teils in besonderen Tonlagen beim Singen oder zur besseren Charakteristik beim Flüstern gebraucht werden.
Daß man die eintönigen Vokale vom U durch O bis zum scharfen A in kontinuierlicher Folge verändern kann, ist leicht zu erkennen und hinreichend bekannt. Ich bemerke dabei noch, da die von mir angegebene tiefe Lage des U in Zweifel gezogen ist, daß, wenn ich einen auf f' ansprechenden Resonator an das Ohr setze, und auf f oder B als Grundton singend mir denjenigen U-ähnlichen Vokal suche, der die stärkste Resonanz gibt, dies nicht einem dumpfen U, sondern einem O-ähnlichen U entspricht.
Dann sind aber auch Übergänge möglich zwischen den Vokalen der A-O-U-Reihe und denen der A-Ö-Ü-Reihe, sowie zwischen denen der letzteren und der A-E-I-Reihe. Ich kann bei der Stellung für U anfangen und den schon verengerten Mund allmählich in die Röhrenform für das Ö oder Ü überführen, wobei die hohe Resonanz immer deutlicher und zugleich höher wird, je enger die Röhre sich bildet. Macht man diesen Übergang, während man einen Resonator zwischen b' und b" am Ohre hat, so hört man in einem bestimmten Stadium des Übergangs den Ton schwellen, nachher wieder verlöschen. Je höher der Resonator ist, desto mehr muß man sich dem Ö oder Ü nähern. Bei der betreffenden Mundstellung kann man es dann auch wohl zum Pfeifen auf dem verstärkten Tone bringen. Auch beim ganz leisen Flüstern, wo das Luftgeräusch im Kehlkopf sehr schwach gehalten wird, und bei den Vokalen mit enger Mundöffnung kaum noch hörbar ist, braucht man oft ein verstärktes Reibegeräusch in der Mundöffnung, um den Vokal hörbar zu machen. Das heißt, man macht dann U und I den verwandten Konsonanten W (englisch) und J ähnlicher.
Überhaupt erlauben nun die zweitönigen Konsonanten mannigfache Abänderungen, da man jede Höbe des oberen Resonanztones mit jeder Höhe des unteren verbinden kann. Man verfolgt dies am besten, indem man einen Resonator an das Ohr setzt, die entsprechenden Vokalstufen der drei Reihen sucht, die seinen Ton verstärken, und diese nun in einander überzuführen sucht in der Weise, daß der Resonator fortdauernd verstärkten Ton behält.
So antwortet der Resonator b' auf O, auf ein A ö und auf ein Ä-ähnliches E, und diese lassen sich kontinuierlich in einander überführen.
Der Resonator f' antwortet auf den Übergang Ou-Ö-E. Der Resonator d" antwortet auf Oa-Äö-Ä. Ähnlich kann auch jeder der höheren Töne mit verschiedenen tieferen verbunden werden. So kann man bei einer Mundstellung, welche e"' pfeifend angeben kann, mit unveränderter Tonhöhe des Reibegeräusches in der Öffnung einen mehr Ö-ähnlichen oder mehr Ü-ähnlichen Laut flüstern, je nachdem man dem Reibegeräusch des Kehlkopfes dabei höhere oder tiefere Resonanz im hinteren Teile der Mundhöhle gibt24).
24) In dieser Weise, scheint mir, erledigen sich einige Einwände, welche Herr G. Engel (in Reichart's u. du Bois Reymond's Archiv 1869, S. 317 bis 319) gemacht hat. Herr J. Stockhausen hat mich darauf aufmerksam gemacht, daß in kurz gesprochenen Silben solche abweichende Vokalfarben gebraucht werden.
Noch ist bei der Vergleichung der Stärke der Obertöne verschiedener Vokale mittels der Resonatoren zu erwähnen, daß die Verstärkung durch die Resonanz des Mundes ebenso wie für die Obertöne auch für den Grundton der von der Stimme angegebenen Note gilt. Und da es nun vorzugsweise die Schwingungen des Grundtons sind, welche durch ihre Rückwirkung auf die Stimmbänder diese in regelmäßig schwingender Bewegung erhalten, so spricht die Stimme überhaupt viel kräftiger an, wenn der Grundton einen solchen verstärkenden Einfluß empfängt, was besonders in denjenigen Gegenden der Skala bemerklich wird, welche für die Stimme des Singenden schwer zu erreichen sind. Man bemerkt dasselbe auch bei Zungenpfeifen mit metallenen Zungen. Wenn man solchen ein Ansatzrohr gibt, dessen Resonanz mit dem Tone der Zunge zusammenstimmt, oder ein wenig höher liegt, so bekommt man außerordentlich kräftige, vollklingende Töne, zu deren Hervorbringung man starken Druck, aber wenig Luft gebraucht, und wobei die Zunge in großen Exkursionen hin- und herschwingt. Die Tonhöhe der Metallzunge wird in Verbindung mit einem solchen Ansatzrohre ein wenig tiefer als vorher, was bei der menschlichen Stimme nicht zu bemerken ist, da der Singende die Spannung seiner Stimmbänder entsprechend regulieren kann. So finde ich namentlich deutlich bei Anwendung eines passenden Resonators, daß ich an der Grenze meiner Fistelstimme auf b die Vokale O, Ä und ein nach A ziehendes Ö, die dort ihre Resonanz finden, kräftig singen kann, während U, wenn es nicht stark nach O gezogen wird, und I nur matt und unsicher ansprechen, und dabei doch viel mehr Luft verbrauchen, als die erstgenannten. Bei den Versuchen über die Stärke der Obertöne muß man hierauf Rücksicht nehmen, da die Obertöne eines stark ansprechenden Vokales verhältnismäßig zu stark ausfallen können, denen eines schwach ansprechenden gegenüber. So habe ich gefunden, daß die hohen Soprantöne, welche in das Verstärkungsbereich des Vokals A an der oberen Grenze der zweigestrichenen Oktave fallen, auf diesen Vokal gesungen, ihre höhere Oktave stärker hervortreten lassen, als die weniger gut ansprechenden Vokale E und I es tun, obgleich die letzteren am oberen Ende der dreigestrichenen Oktave ihre starke Resonanz finden.
Es ist schon oben (S. 67) der Einfluß erwähnt worden, den die Masse und Abgrenzung des mittönenden Körpers auf die Stärke und Breite des Mitschwingens hat. Ein Körper von erheblicher Masse, der seine Schwingungen möglichst frei von allen Hemmungen durch die benachbarten Körper ausführen kann, und dessen Bewegung auch nicht durch innere Reibung seiner Teile gedämpft wird, kann, einmal erregt, lange nachschwingen und fordert deshalb, wenn er in den höchsten Grad des Mitschwingens versetzt werden soll, daß während verhältnismäßig langer Zeit die Oszillationen des erregenden Tones mit denen der in ihm erregten Eigenschwingungen zusammenfallen. Das heißt, der höchste Grad des Mitschwingens ist nur durch zugeleitete Töne von sehr eng begrenzter Tonhöhe zu erreichen. So ist es bei Stimmgabeln und Glocken. Die Luftmasse der Mundhöhle hat nun im Gegenteil geringe Dichtigkeit und Masse, ihre Wände sind, so weit sie von Weichteilen gebildet sind, nicht sehr widerstandsfähig und unvollkommen elastisch, haben bei Erschütterungen viel innere Reibung, wodurch sie Bewegung vernichten. Außerdem kommuniziert die erschütterte Luftmasse der Mundhöhle durch die Mundöffnung mit der äußeren Luft, und gibt dieser schnell große Teile ihrer empfangenen Bewegung ab. Eben deshalb erlischt eine einmal erregte schwingende Bewegung in der Luft der Mundhöhle sehr schnell, wie man leicht beobachten kann, wenn man bei verschiedenen Vokalstellungen des Mundes einen Finger gegen die Backe schnellen läßt. Man unterscheidet dann die Tonhöhe der Resonanz recht gut für die verschiedenen Übergangsstufen des O einerseits nach U und andererseits nach A hin. Aber der Ton ist sehr kurz verklingend. Auch durch Klappern an den Zähnen kann man die verschiedene Resonanz der Mundhöhle hörbar machen. Eben deshalb kann auch ein Ton, der nur für die wenigen Schwingungen eines solchen kurzen Resonanztones nahehin übereinstimmend oszilliert, eine Verstärkung durch Mittönen finden, die nicht viel geringer ausfällt als für einen genau übereinstimmenden Ton; und die Breite in der Skala, deren Töne durch eine gegebene Stellung des Mundes merklich verstärkt werden können, ist eine ziemlich erhebliche 25). Dies wird durch den Versuch bestätigt. Wenn ich einen Resonator für b' an das rechte und einen für f" an das linke Ohr setze, und auf B den Vokal O singe, so ist nicht bloß der vierte Partialton b', der dem Eigenton der Mundhöhle entspricht, verstärkt, sondern ganz merklich, wenn auch bedeutend weniger als der genannte auch der sechste f". Wenn ich dann das O in ein Å verwandle, bis das f" seine stärkste Resonanz findet, so schwindet dabei doch auch die Verstärkung des b' nicht ganz, wenn sie auch viel geringer wird.
25) Siehe hierfür auch Beilage X. und die dazu gehörigen Erörterungen im Text der Abthl. I, Abschn. 6.
Die Stellung der Mundhöhle beim O bis Oa scheint diejenige zu sein, welche für die Andauer ihres Eigentons und die Entstehung einer auf enge Grenzen der Tonhöhe beschränkten Resonanz verhältnismäßig am günstigsten erscheint. Wenigstens ist hierbei, wie ich schon oben bemerkte, die Verstärkung eines passenden Stimmgabeltons am kräftigsten, und Klopfen gegen die Backe oder die Lippen gibt den deutlichsten Ton. Wenn also beim 0 die verstärkende Resonanz noch bis zur Entfernung einer Quinte sich merklich macht, so wird für die übrigen Vokale dasselbe noch in höherem Grade der Fall sein. In der Tat ergeben dies auch die Versuche. Wenn man irgend einen Resonator an das Ohr setzt, einen passenden harmonischen Unterton desselben sucht, und dann die verschiedenen Vokale auf diesen singt, indem man einen in den anderen übergehen läßt, so findet man die größten Verstärkungen der Resonanz für denjenigen oder diejenigen Vokale, für welche einer der charakteristischen Töne nach der oben gegebenen Tabelle mit dem Eigentone des Resonators zusammenfällt. Aber man bemerkt mehr oder weniger erhebliche Verstärkung auch für solche Vokale, deren charakteristische Töne mäßige Höhenunterschiede von dem Eigentone des Resonators haben, desto geringere, je größer die Differenz dieser Tonhöhen ist.
Dadurch wird es nun möglich, im Allgemeinen die Vokale von einander zu scheiden, auch wenn die Höhe des Stimmtons nicht gerade einem harmonischen Untertone des Vokals entspricht. Vom zweiten Partialtone ab sind die Intervalle derselben enge genug, daß einer oder zwei derselben eine deutliche Verstärkung durch die Resonanz des Mundes finden müssen. Nur wenn der Eigenton der Mundhöhle in die Mitte des Intervalls zwischen Grundton der Stimme und dessen höhere Oktave fällt, oder um mehr als eine Quinte tiefer, als jener Grundton ist, wird die charakteristische Resonanz schwach werden müssen.
Beim Sprechen wählen nun beide Geschlechter eine der tiefsten Lagen ihrer Stimme. Die Männer brauchen in der Regel die obere Hälfte der großen Oktave, die Frauen die obere Hälfte der kleinen. Mit Ausnahme des U, dessen Klangfarbe Schwankungen des Eigentons fast in Breite einer Oktave zuläßt, fallen für die genannten Lagen der Sprechstimme alle Eigentöne der Mundhöhle zwischen hinreichend enge Intervalle der Obertöne des Sprechtons, um merkliche Resonanz von einem oder mehreren dieser Obertöne zu erzeugen und den Vokal zu charakterisieren. Dazu kommt, daß der Sprechstimme wahrscheinlich durch stärkeren Druck der Stimmbänder gegen einander, wobei sie aufschlagende Zungen bilden, eine knarrendere Klangfarbe, das heißt stärkere Obertöne gegeben werden, als der Singstimme.
Beim Singen dagegen, und namentlich beim Singen in höheren Lagen werden die Verhältnisse ungünstiger für die Charakterisierung der Vokale. Jedermann weiß übrigens, daß es im Allgemeinen viel schwerer ist, gesungene Worte zu verstehen, als gesprochene, und daß die Schwierigkeit bei Männerstimmen geringer ist, als bei Frauenstimmen, gleich gute Schulung der Stimme vorausgesetzt. Man würde zu Opern und Oratorien nicht Textbücher verkaufen, wenn es anders wäre. Oberhalb des f wird die Charakterisierung des U, selbst wenn es dem O stark verähnlicht wird, unvollkommen werden. So lange es aber der einzige unbestimmt klingende Vokal ist, und die anderen noch merkliche Verstärkung gewisser Regionen ihrer Obertonreihe hören lassen, wird dieser negative Charakter das U auszeichnen. Für Soprane wird dagegen in der Gegend des f" die Unterscheidung des U, O und A undeutlich werden müssen, was meiner Erfahrung nach in der Tat der Fall ist. Singt man die drei Vokale in unmittelbarer Folge neben einander, so wird sich die Resonanz des f'" beim A in der auf b gestimmten Mundhöhle immer noch etwas mehr geltend machen können, als bei der Stimmung b für O. Auch wird die Sängerin in diesem Falle das A heller machen können, indem sie die Stimmung der Mundhöhle gegen d'" steigert und dadurch dem f'" nähert. Das O wird sich dagegen durch Annäherung an das Oa vom b scheiden lassen, indem dabei der Grundton entschiedenere Verstärkung erhalten wird. Aber immerhin werden diese Vokale, wenn sie nicht unmittelbar neben einander gestellt sind, für einen Hörer, der die Art der Vokalbildung der betreffenden Sängerin noch nicht kennt, nicht sehr deutlich unterschieden sein.
Ein weiteres dabei in Betracht kommendes Hilfsmittel liegt übrigens
noch in einem kräftigen ersten Einsatz des betreffenden Vokals. Dies
beruht auf einem allgemeinen Verhalten der zum Mittönen erregten Körper.
Wenn man nämlich das Mitschwingen eines dazu fähigen Körpers
durch einen von seinem Eigenton etwas abweichenden Ton so erregt, daß
man diesen Ton plötzlich mit voller Stärke einsetzen läßt,
so hört man anfangs neben dem durch die Resonanz verstärkten,
erregenden Tone auch den Eigenton des mittönenden Körpers26).
Aber der letztere verklingt bald, während der erstere stehen bleibt.
Bei Stimmgabeln mit großen Resonatoren hört man sogar Schwebungen
zwischen beiden Tönen. Bringt man nun einen Resonator an das Ohr etwa
für b' und setzt den Vokal O kräftig auf g
ein, dessen Obertöne g' und d" nur schwache dauernde
Resonanz in der Mundhöhle finden, so hört man unmittelbar beim
Einsatz doch das b' der Mundhöhle und des Resonators als einen
kurzen Tonstoß aufblitzen. Wählt man einen anderen Vokal, so
schwindet dieses b', woraus folgt, daß die Abstimmung der
Mundhöhle bei seiner Erzeugung mitwirkt. Also auch hier erregt der
plötzliche Einsatz der dem Stimmklange angehörigen Töne
g' und d" schnell verklingend den dazwischen liegenden Eigenton
der Mundhöhle b'. Dasselbe kann man bei anderen Tonhöhen
des angesetzten Resonators beobachten, wenn man Noten, kräftig einsetzend,
singt, deren Obertöne nicht durch den Resonator verstärkt werden,
sobald man einen Vokal wählt, dessen charakteristische Tonhöhe
der des Resonators entspricht. Daraus ergibt sich, daß bei scharfem
Einsatz jedes Vokals in jeder Tonhöhe der charakteristische Ton desselben
als kurzer Tonstoß hörbar wird. Dadurch wird der Vokal im Moment
des Einsetzens deutlich charakterisiert werden können, selbst wenn
er beim längeren Forttönen unbestimmt werden sollte. Nur ist
hierzu, wie bemerkt, ein präziser und energischer Einsatz nötig.
Wie sehr übrigens ein solcher für die Verständlichkeit der
Worte eines Singenden vorteilhaft ist, ist bekannt. Eben deshalb ist auch
wohl die Vokalisation der kurz angegebenen Worte des recitativischen Pariando
deutlicher, als die des getragenen Gesanges27).
26) Siehe die mathematische Darstellung dieses Vorgangs in Beilage IX. in den Bemerkungen zu Gleichung 4 bis 4b.
27) Durch die hier besprochenen Tatsachen sind, wie ich
glaube, die von Herrn E. v. Qvanten (Poggendorff's Annal.
Bd. 154, S. 272 und 522) gegen die Theorie der Vokale vorgebrachten Bedenken
erledigt, soweit dieselben nicht auf Mißverständnissen beruhen.
Übrigens erlauben die Vokale noch anderweitige Abänderungen ihrer Klangfarbe außer den vorher schon besprochenen, durch Veränderungen ihrer charakteristischen Töne innerhalb gewisser Breite bedingten. Es kann nämlich die Resonanzfähigkeit der Mundhöhle überhaupt Abänderungen ihrer Stärke und Bestimmtheit erleiden, und dadurch der Charakter der verschiedenen Vokale, ihr Unterschied von einander überhaupt mehr hervorgehoben oder mehr verwischt werden. Im Allgemeinen sind schlaffe weiche Wände eines Kanals mit tönenden Luftmassen nachtheilig für die Kraft der Schwingungen. Teils wird durch die weichen Massen zu viel von der Bewegung nach außen hin abgegeben, teils in ihrem Innern durch Reibung vernichtet. Haben doch selbst hölzerne Orgelpfeifen einen weniger energischen Klang als metallene, und solche von Pappe einen noch stumpferen, selbst wenn das Mundstück unverändert bleibt. Die Wandungen des menschlichen Halses und die Wangen sind aber noch viel nachgiebiger als Pappe. Soll also der Stimmton mit allen seinen Obertönen kräftige Resonanz finden und möglichst ungeschwächt nach außen dringen, so müssen diese schlaffsten Teile unseres Stimmkanals möglichst außer Spiel gesetzt oder durch Spannung elastisch gemacht, und andererseits der Kanal möglichst kurz und weit gebildet werden. Dies letztere geschieht durch Hebung des Kehlkopfes. Die schlaffe Wand der Wangen kann fast ganz beseitigt werden, wenn die Zahnreihen nicht zu weit von einander entfernt werden. Die Lippen können, wenn sie nicht notwendig mitwirken müssen, wie für Ö und Ü, so weit zurückgezogen werden, daß die scharfen festen Zahnränder den Ausgang der Mundhöhle begrenzen. Zugleich können die Mundwinkel beim A ganz zur Seite gezogen werden, beim O durch Spannung der von oben und unten an sie tretenden Muskeln (Levator anguli oris und Triangularis menti), die man alsdann beim Betasten als gespannte Stränge fühlt, fest gespannt und an die Zahnreihen angedrückt werden, so daß auch dieser Teil des Randes der Mundöffnung scharf und widerstandsfähig wird.
Bei dem Versuche, einen klaren und energischen Stimmton hervorzubringen, fühlt man aber auch Spannung einer großen Anzahl der vorn am Halse gelegenen Muskeln, sowohl derjenigen (Mylohyoideus, Geniohyoideus und vielleicht auch Biventer), welche zwischen Unterkiefer und Zungenbein liegen und den unteren Schluß der Mundhöhle bilden helfen, als derer, welche neben Kehlkopf und Luftröhre hinablaufen und das Zungenbein nach unten ziehen (Sternohyoideus, Sternothyreoideus und Thyreohyoideus). Ohne die Gegenwirkung der letzteren wäre nämlich eine erhebliche Spannung der ersteren nicht möglich. Außerdem deutet eine beim Stimmansatz entstehende Einziehung der Haut an beiden Seiten des Kehlkopfes an, daß auch der vom Zungenbein schräg abwärts nach hinten zum Schulterblatt laufende Omohyoideus gespannt wird. Ohne seine Mitwirkung würden die vom Unterkiefer und Brustbein kommenden Muskeln den Kehlkopf zu sehr nach vorn ziehen. Nun gehen die meisten dieser Muskeln gar nicht an den Kehlkopf, sondern an das Zungenbein, an welchem der Kehlkopf aufgehängt ist. Sie können also auch die Stimmbildung selbst nicht direkt unterstützen, so weit diese von der Aktion des Kehlkopfs abhängt. Die Aktion dieser Muskeln, so weit ich sie an mir selbst beobachten kann, ist auch viel geringer, wenn ich ein dumpfes gutturales A hervorbringe, als wenn ich dieses in ein etwas schmetterndes, scharf und kräftig hervordringendes zu verwandeln suche. Schmetternder, scharfer Klang heißt Klang mit vielen und starken Obertönen; je stärker diese überhaupt sind, desto deutlicher treten natürlich auch die durch ihre Differenzen bedingten Unterschiede der Vokale hervor. Ein Sänger und Declamator wird neben der ausgiebigen hellen Stimmbildung gelegentlich auch die dumpfere als Gegensatz benutzen können. Scharfe Charakterisierung des Klanges paßt für energische, freudige oder tatkräftige Stimmungen, indifferentere, dumpfere Klangbildung für trübe, in sich verschlossene. Im letzteren Falle ändert man auch gern die Eigentöne der Vokale, indem man die extrem gelegenen mehr einem mittleren Äö (etwa dem kurzen E der Deutschen entsprechend) nähert, also namentlich die hohen Töne des A, E, I etwas tiefer wählt.
Einen eigentümlichen Umstand muß ich hier noch erwähnen,
durch welchen die menschliche Stimme sich vor anderen musikalischen Instrumenten
auszeichnet und eine eigentümliche Beziehung zum menschlichen Ohre
zeigt. Oberhalb der hohen Verstärkungstöne für das I
in der Gegend des e"" bis g"" klingen die Töne der Klaviere
eigentümlich scharf, und man wird leicht zu dem Glauben verleitet,
daß diese hohen Töne zu harte Hämmer haben, oder in ihrer
Mechanik von ihren Nachbarn irgendwie abweichen. Indessen ist die Sache
bei allen Klavieren die gleiche, und wenn man eine ganz kleine Glasröhre
oder Glaskugel an das Ohr setzt, so werden die früher scharfen Töne
der Skala mild und schwach wie die anderen, während eine andere tiefer
gelegene Reihe von Tönen jetzt stärker und schärfer hervortritt.
Daraus folgt, daß das menschliche Ohr selbst durch seine Resonanz
die Töne zwischen e"" und g"" begünstigt, daß
es selbst für einen dieser Töne abgestimmt ist28).
Empfindlichen Ohren erregen jene Töne auch wohl Schmerz. Dadurch treten
nun die Obertöne dieser Lage, wenn sie so hoch hinaufreichen, besonders
kräftig hervor und affizieren das Ohr sehr stark. Das geschieht bei
der menschlichen Stimme im Allgemeinen, wenn sie mit Anstrengung gebraucht
wird, so daß sie einen schmetternden Charakter bekommt. Bei kräftigen
Männerstimmen, welche forte singen, hört man jene Töne gleichsam
wie ein helles Schellengerassel mitklingen, am deutlichsten aber bei Chören,
wenn die Stimmen etwas schreien. Es gibt jede einzelne Männerstimme
in solcher Höhe schon dissonierende Obertöne. Wenn Bässe
ihr hohes e' singen, so ist d"" der siebente, e""
der achte, fis"" der neunte, gis"" der zehnte Oberton. Wenn
nun gleichzeitig e"" und fis"" stark, d"" und gis""
schwächer hörbar werden, so gibt das natürlich eine scharfe
Dissonanz. Kommen gar viele Stimmen zusammen, welche diese Töne mit
kleinen Höhenunterschieden angeben, so gibt es eine eigentümliche
Art von Gerassel, was man sehr leicht immer wieder wahrnimmt, wenn man
erst einmal darauf aufmerksam geworden ist. Einen Unterschied der Vokale
habe ich dabei nicht wahrgenommen, wohl aber hört das Rasseln auf,
wenn die Stimmen piano gebraucht werden, obgleich dabei die Tonstärke
eines Chors immer noch eine ziemlich bedeutende sein kann. Es ist diese
Art von Rasseln eine Eigentümlichkeit der menschlichen Stimmen, die
Orchesterinstrumente bringen es nicht in derselben Weise so deutlich und
stark hervor. Ich habe es überhaupt von keinem anderen Tonwerkzeuge
je so deutlich gehört, wie von menschlichen Stimmen.
28) Neuerdings finde ich, daß mein rechtes Ohr am
meisten für f"" und das linke für c"" empfindlich
ist. Wenn ich Luft in die Trommelhöhle eintreibe, geht die Resonanz
herab auf cis"" und gis'". Der Ton der Grillen entspricht
gerade dem höheren Resonanzton, und wenn ich nur ein kurzes Papierröhrchen
an den Gehörgang anfüge, wird das Zirpen der Grillen auffallend
schwächer gehört.
Auch in den Sopranstimmen, wenn sie forte singen, hört man dieselben Obertöne; bei scharfen und unsicheren Stimmen sind sie tremulierend und bekommen dadurch etwas Ähnlichkeit mit dem Gerassel, welches sie in den Klängen der Männerstimmen bilden. Von recht sicheren und wohlklingenden Frauenstimmen und von einigen ausgezeichneten Tenorstimmen habe ich sie aber auch schon ganz rein und ruhig fortklingend gehört. Beim melodischen Fortschritte der Singstimme höre ich dann diese hohen Töne der viergestrichenen Oktave bald etwas abwärts, bald aufwärts schreitend innerhalb des Umfanges einer kleinen Terz, je nachdem verschiedene Obertöne der gesungenen Noten in das Gebiet einrücken, für welches unser Ohr so empfindlich ist. Auffallend ist es aber, daß gerade die menschliche Stimme so reich ist an Obertönen, für welche das menschliche Ohr so empfindlich ist. Übrigens bemerkt Frau E. Seiler, daß auch Hunde gegen das hohe e der Violine sehr empfindlich sind.
Diese erwähnte Verstärkung der in der Mitte der viergestrichenen Oktave gelegenen Töne hat übrigens mit der Charakteristik der Vokale nichts zu tun; ich habe sie hier nur deshalb erwähnt, weil man die genannten hohen Töne bei Untersuchungen über die Klangfarbe der Vokale und der menschlichen Stimmen leicht bemerkt und man sich nicht verleiten lassen darf, in ihnen eine besondere Charakteristik einzelner Vokale zu suchen. Sie sind nur eine Charakteristik der angestrengten Stimme.
An das U schließt sich noch an der brummende Ton, der entsteht, wenn man mit geschlossenem Munde singt. Dieser brummende Ton wird beim Ansatz der Konsonanten M, N und N G gebraucht. Die Nasenhöhle, welche hierbei für den Ausgang des Luftstroms dient, hat im Verhältnis zur Größe ihrer Höhlung eine noch engere Öffnung, als die Mundhöhle beim Vokal U. Beim Brummen eines Tones treten deshalb die Eigentümlichkeiten des U in noch gesteigertem Maße auf. Nämlich obgleich noch Obertöne da sind, und sogar ziemlich hoch hinaufreichen, so nehmen sie nach der Höhe hin noch viel schneller an Stärke ab als beim U. Die höhere Oktave des Grundtons hat beim Brummen noch ziemliche Stärke, alle höheren Partialtöne sind aber schwach. Das Brummen in der Mundstellung für M und N unterscheidet sich noch ein wenig in der Klangfarbe, indem beim N die Obertöne weniger gedämpft sind als heim M. Aber ein deutlicher Unterschied dieser Konsonanten entsteht doch erst im Moment, wo die Mundhöhle geöffnet oder geschlossen wird. Auf die Zusammensetzung des Schalls der übrigen Konsonanten können wir hier nicht näher eingehen, weil sie Geräusche ohne konstante Tonhöhe geben, nicht musikalische Klänge, und wir uns hier zunächst auf die letzteren beschränken müssen.
Die hier auseinandergesetzte Theorie der Vokallaute läßt
sich bestätigen durch Versuche mit künstlichen Zungenpfeifen,
an welche man passende Ansatzröhren anbringt. Es geschah dies zuerst
durch Willis, welcher Zungenpfeifen mit zylindrischen Ansatzröhren
von veränderlicher Länge verband, und durch Verlängerung
des Ansatzrohres verschiedene Töne hervorbrachte. Die kürzesten
Röhren gaben ihm I, dann E, A, O, schließlich
U, bis die Röhre die Länge einer Viertel-Wellenlänge
überschritt. Bei weiterer Verlängerung kehrten die Vokale in
umgekehrter Ordnung wieder. Seine Bestimmung der Tonhöhe der resonierenden
Pfeifen stimmt für die tieferen Vokale gut mit der meinigen überein.
Für die höheren Vokale hat Willis aber wohl relativ zu
hohe Töne gefunden, weil dann die Wellenlängen kleiner als der
Durchmesser der Röhre wurden, und deshalb die gewöhnliche Berechnung
der Tonhöhe nach der Länge der Röhre allein nicht mehr anwendbar
war. Auch waren notwendig die Vokale E und I
denen des Mundes ziemlich unähnlich, wegen Mangels der zweiten Resonanz
und deshalb, wie Willis selbst angibt, nicht eben gut von einander
abzugrenzen.
| Vokal | im Worte | Tonhöhe nach Willis | Tonhöhe nach Helmholtz |
| 0 | No | c" | c" |
| AO | Nought | es" | es" |
| Paw | g" | g" | |
| A | Part | des"' | des"' |
| Paa | f"' | ||
| E | Pay | d"" | b"' |
| Pet | c'"" | c"" | |
| I | See | g'"" | d"" |
Noch besser und deutlicher als mit zylindrischen Röhren erhält man die Vokale, wenn man abgestimmte kugelförmige Hohlräume anwendet. Wenn ich auf eine Zungenpfeife, welche b gab, die gläserne Resonanzkugel für b aufsetzte, so erhielt ich den Vokal U, mit der Kugel b erhielt ich O, mit der Kugel b" dagegen A, ein wenig geschlossen, mit d'" ein scharfes A. Bei gleicher Abstimmung der angesetzten Hohlräume erhalten wir daher auch dieselben Vokale ganz unabhängig von ihrer Form und Wandung. Auch ist es mir gelungen, mit derselben Zungenpfeife verschiedene Abstufungen von Ä, Ö, E und I hervorzubringen, indem ich gläserne Hohlkugeln aufsetzte, in deren äußere Öffnung noch ein 6 bis 10 Zentimeter langes Glasröhrchen eingefügt war, um die doppelte Resonanz der Mundhöhle bei diesen Vokalen nachzubilden.
Willis hat noch eine andere interessante Methode angegeben, Vokale hervorzubringen. Wenn man ein Zahnrad mit vielen Zähnen schnell umdreht und an seinem gezahnten Rande eine Feder schleifen läßt, so wird die Feder von jedem Zahn gehoben, und man erhält dadurch einen Ton, dessen Schwingungszahl gleich der Zahl der vorübergehenden Zähne ist Nun gibt aber die Feder selbst, wenn sie an ihrem einen Ende gut befestigt ist und in Schwingung versetzt wird, einen Ton, der desto höher steigt, je kürzer die Feder gemacht wird. Läßt man nun die Feder schleifen, während das Rad mit gleichbleibender Geschwindigkeit gedreht wird, und verändert dann die Länge der Feder, so erhält man bei langer Feder einen U-ähnlichen Klang, bei kürzerer O, A, E, I, indem der Ton der Uhrfeder hierbei die Rolle des verstärkten Vokaltones spielt. Doch ist diese Nachahmung der Vokale allerdings viel unvollkommener als die mittels der Zungenpfeifen. Aber der Sinn auch dieses Verfahrens beruht offenbar darin, daß Klänge hervorgebracht werden, in denen gewisse Obertöne, die nämlich, welche dem eigenen Tone der anschlagenden Feder entsprechen, verstärkt werden.
Willis selbst hat eine andere Theorie von der Natur der Vokalklänge aufgestellt, als wir es hier dem Zusammenhange aller übrigen akustischen Erscheinungen entsprechend getan haben. Willis stellt sich vor, daß die Luftstöße, welche den Klang der Vokale hervorbringen, selbst schon schnell verhallende Töne sind, entsprechend dem Eigentone der Feder in seinem letzten Versuch oder dem kürzen Widerhall, welchen ein Stoß oder eine kleine Luftexplosion in der Mundhöhle, beziehlich im Ansatzrohre einer Zungenpfeife, hervorbringt. In der Tat hört man etwas dem Vokalklange Ähnliches, wenn man auch nur mit einem Stäbchen an den Zähnen klappert, während man die Mundhöhle in die Stellung der verschiedenen Vokale formt. Willis' Beschreibung der Schaubewegung bei den Vokalen trifft jedenfalls mit der Wirklichkeit ziemlich nahe zusammen; aber sie gibt nur die Art und Weise an, wie die Bewegung in der Luft geschieht, und nicht die entsprechende Reaktion des Ohres gegen diese Bewegung. Daß auch diese Art der Bewegung vom Ohre nach den Gesetzen des Mittönens in eine Reihe von Obertönen zerlegt wird, zeigt sich in der übereinstimmenden Analyse des Vokalklanges, wie sie vom unbewaffneten Ohre und von den Resonatoren ausgeführt wird. Dasselbe wird sich noch deutlicher im nächsten Abschnitte bei der Beschreibung derjenigen Versuche zeigen, in welchen Vokalklänge direkt aus ihren Obertönen zusammengesetzt werden.
Die Vokalklänge unterscheiden sich von den Klängen der meisten anderen musikalischen Instrumente also wesentlich dadurch, daß die Stärke ihrer Obertöne nicht nur von der Ordnungszahl derselben, sondern überwiegend von deren absoluter Tonhöhe abhängt. Wenn ich z. B. den Vokal A auf die Note Es singe, ist der verstärkte Ton b" der zwölfte des Klanges, und wenn ich denselben Vokal auf die Note b singe, ist es der zweite Ton des Klanges, welcher verstärkt wird.
Wir können aus den angeführten Beispielen über die Abhängigkeit der Klangfarbe von der Zusammensetzung des Klanges im Allgemeinen folgende Regeln ziehen:
1. Einfache Töne, wie die der Stimmgabeln mit Resonanzröhren, der weiten gedackten Orgelpfeifen, klingen sehr weich und angenehm, ohne alle Rauhigkeit, aber unkräftig und in der Tiefe dumpf.
2. Klänge, welche von einer Reihe ihrer niederen Obertöne bis etwa zum sechsten hinauf in mäßiger Stärke begleitet sind, sind klangvoller, musikalischer. Sie haben, mit den einfachen Tönen verglichen, etwas Reicheres und Prächtigeres, sind aber vollkommen wohllautend und weich, so lange die höheren Obertöne fehlen. Hierher gehören die Klänge des Klaviers, der offenen Orgelpfeifen, die weicheren Pianotöne der menschlichen Stimme und des Horns, welche letzteren den Übergang zu den Klängen mit hohen Obertönen bilden, während die Flöten und schwach angeblasenen Flötenregister der Orgel sich den einfachen Tönen nähern.
3. Wenn nur die ungeradzahligen Obertöne da sind, wie bei den engen gedackten Orgelpfeifen, den in der Mitte angeschlagenen Klaviersaiten und der Klarinette, so bekommt der Klang einen hohlen oder bei einer größeren Zahl von Obertönen einen näselnden Charakter. Wenn der Grundton an Stärke überwiegt, ist der Klang voll; leer dagegen, wenn jener an Stärke den Obertönen nicht hinreichend überlegen ist. So ist der Klang weiter offener Orgelpfeifen voller als der von engeren, der Klang der Saiten voller, wenn sie mit den Hämmern des Pianoforte angeschlagen werden, als wenn es mit einem Stöckchen geschieht oder wenn sie mit den Fingern gerissen werden, der Ton von Zungenpfeifen mit passendem Ansatz voller als von solchen ohne Ansatzrohr.
4. Wenn die höheren Obertöne jenseits des sechsten oder siebenten sehr deutlich sind, wird der Klang scharf und rauh. Den Grund davon werden wir später in den Dissonanzen nachweisen, welche die höheren Obertöne mit einander bilden. Der Grad der Schärfe kann verschieden sein; bei geringerer Stärke beeinträchtigen die hohen Obertöne die musikalische Brauchbarkeit nicht wesentlich, sind im Gegenteil günstig für die Charakteristik und Ausdrucksfähigkeit der Musik. Von dieser Art sind besonders wichtig die Klänge der Streichinstrumente, ferner die meisten Zungenpfeifen, Oboe, Fagott, Physharmonica, menschliche Stimme. Die rauheren, schmetternden Klänge der Blechinstrumente sind außerordentlich durchdringend, und machen deshalb mehr den Eindruck großer Kraft als ähnliche Klänge von weicherer Klangfarbe. Sie sind deshalb für sich allein wenig geeignet zur künstlerischen Musik, aber von großer Wirkung im Orchester. In welcher Weise die hohen dissonierenden Obertöne den Klang durchdringender machen können, wird sich später ergeben.