![]()
Gehörsvorstellungen.
Vor andern Vorstellungen zeichnen sich die des Gehörssinnes durch die Eigenschaft aus, daß sie aus einer außerordentlich reichen, aber gleichartigen sinnlichen Grundlage entspringen. Das einzige Material für ihren Aufbau bilden nämlich die Ton- und Geräuschempfindungen. Innervationsgefühle oder andere Sinneseindrücke, die dem Gebiet der Geräusche und Klänge fremd sind, wirken nicht oder doch nur in höchst sekundärer Weise bei ihrer Bildung mit. Durch die Bewegungen des Halses und des äußeren Ohres, welchem einigermaßen die Rolle eines Schallbechers zukommt, wird zwar die Verlegung des Schalls nach bestimmten Richtungen des Raumes vermittelt1). Aber dieser Vorgang ist von keiner wesentlichen Bedeutung für die Schallvorstellung. Alle räumliche Beziehung ist hier nicht selbständig entwickelt, sondern von den andern raumauffassenden Sinnen, dem Gesicht und Getast, erst entliehen. Man darf wohl vermuten, daß gerade in der Gleichartigkeit ihrer sinnlichen Grundlage die Unmöglichkeit einer räumlichen Ordnung der Gehörsvorstellungen mitbegründet liege. Sie verhalten sich in dieser Hinsicht ähnlich den zwei anderen Sinnen, deren Empfin-dungen ebenfalls auf die Form intensiver Qualitäten beschränkt bleiben, dem Geruch und Geschmack. Aber es unterscheidet sie wieder der Reichtum ihrer qualitativen Mannigfaltigkeit, die genaue Anpassung der Empfindung an den äußeren Eindruck in Bezug auf den zeitlichen Wechsel desselben, und endlich vor allem die Möglichkeit, die regelmäßigeren Schalleindrücke der Klänge und Zusammenklänge in der Empfindung zu analysieren und auf diese Weise jedes Element einer komplexen Empfindung in die stetige Tonreihe einzuordnen. Auf diesen Verhältnissen beruht die Eigenschaft der Gehörsvorstellungen, daß sie das wesent-lichste Hilfsmittel der Zeitanschauung abgeben, die zwar in der Bewegungsvorstellung bereits angelegt, deren höhere Ausbildung aber ganz und gar an den Gehörssinn gebunden ist.
1) Die wesentlichste Rolle bei dieser, übrigens stets sehr unvollkommenen Lokalisation der Schalleindrücke spielt wahrscheinlich der Spannmuskel des Trommelfells (musc. tensor tympani). Derselbe wird, sobald Schallwellen das Ohr treffen, unwillkürlich in Kontraktion versetzt. Durch das Trommelfell werden aber nur solche Schalleindrücke dem Gehörlabyrinth zugeleitet, welche zunächst durch die Luft sich fortgepflanzt haben, während jene, die im Gehörorgane selbst oder dessen Nachbarschaft entstehen, durch die Kopfknochen zu den Enden des Hörnerven gelangen. Füllt man daher den äußern Gehörgang mit Wasser, wobei das Trommelfell nicht mehr gespannt werden kann, so werden, wie ed. weber zuerst beobachtet hat, starke Schalleindrücke so gehört, als wenn sie im Ohre selber entstünden. Auch darüber, ob der Schall von rechts oder von links kommt, erhalten wir wahrscheinlich durch die Tätigkeit des Trommelfellspanners Aufschluß, indem wir durch seine unwillkürliche Accommodation an die Schallstärke wahrnehmen, ob vorzugsweise das rechte oder das linke Trommelfell in Schwingungen versetzt wurde. Als weiteres Hilfsmittel zur Orientierung über die Richtung des Schalls dient dann die Ohrmuschel, welche aber beim Menschen meist ihre Beweglichkeit eingebüßt hat, so daß nur noch die verschiedene Stärke des von vorn oder von hinten kommenden Schalls einen Anhaltspunkt für die Beurteilung seiner Richtung bietet. Den von vorn kommenden Schall hören wir nämlich im allgemeinen deutlicher, weil er durch Reflexion an der Ohrmuschel vollständiger im Gehörgang gesammelt wird. ed. WEBER veranschaulichte diese Wirkung, indem er eine künstliche Ohrmuschel umgekehrt vorsetzte, wo dann der von hinten kommende Schall irrtümlich nach vorn verlegt wurde. (ed. weber, Berichte der kgl. sächs. Ges. zu Leipzig 1851. S. 29.) E. mach hat die Vermutung ausgesprochen, es möchte der Trommelfellspanner durch das seine Tätigkeit begleitende Innervationsgefühl noch eine fundamentalere Aufgabe haben, indem er, der Tonhöhe sich accommodirend, wesentlich die quantitative Feststellung der Tonreihe vermittle. (Sitzungsber. der Wiener Akademie Bd. 48 S. 283.) Aber nach der von helmholtz gelieferten Analyse der Funktion des Trommelfells ist die physiologische Grundlage dieser Hypothese zweifelhaft. Der Trommelfellspanner verstärkt nämlich die Wölbung des Trommelfells und vermittelt dadurch eine intensivere Wirkung der Erschütterungen desselben auf die Flüssigkeiten des Labyrinths, dagegen scheinen keine Spannungsänderungen für die Anpassung an verschiedene Tonhöhen erforderlich zu sein. (Vgl. helmholtz, PFLÜGER'S Arch. l. S. 24.) Ich habe deshalb in Kap. IX. die Annahme bevorzugt, daß die Empfindung der Tonverhältnisse eine unmittelbare, nicht durch begleitende Empfindungen vermittelte sei.
Die in der unmittelbaren Empfindung geschehende Klanganalyse, durch welche wir den einfachen von dem zusammengesetzten Gehörseindruck unterscheiden, befähigt uns, Klänge, die gleichzeitig oder in zeitlicher Folge gegeben werden, nach ihrer Verwandtschaft in eine gewisse Ordnung zu bringen. Es wiederholt sich hier auf einem zusammengesetzteren Gebiete derselbe Vorgang wie bei der Ordnung der einfachen Tonempfindungen2): Aber während die Tonreihe aus der unmittelbaren Auffassung gleicher Höhenverhältnisse der Töne hervorgeht und daher der reinen Empfindung angehört, setzt die Ordnung der Klänge die Tonreihe voraus. Sie bringt nämlich solche Klänge zusammen, für die gewisse Glieder der Tonreihe identisch sind: hierin besteht die Klangverwandtschaft. Die Tätigkeit, welche diese Zusammenstellung bewirkt, wird in dem Maße verwickelter, als die Zahl der neben und nach einander gegebenen teils übereinstimmenden teils aus einander fallenden Klangbestandteile zunimmt. Der Einklang, die Identität zweier Klänge, liegt schon in der Empfindung, da die Ordnung der Tonreihe die unmittelbare Wiedererkennung übereinstimmender Klänge voraussetzt. Erst bei verschiedenen Klängen fängt die Verwandtschaft an, die ihrem Begriff nach ein Zusammentreffen teils verschiedener teils gleicher Elemente erfordert. Hiermit beginnt denn auch erst das Gebiet der Vorstellung, deren eigentliches Wesen wir in der gesetzmäßigen Verbindung einer Mehrheit von Empfindungen erkannt haben3).
2)Vergl. Kap. IX.
3) Kap. XI.
Die Klangverwandtschaft ist doppelter Art. Sie besteht
entweder darin, daß gewisse Partialtöne bei einer bestimmten
Klasse von Klängen immer wiederkehren, wie auch die Höhe des
Grundtons und der von dem letzteren abhängigen Obertöne sich
ändern mag; hier erscheinen daher gewisse Partialtöne als die
konstanten Begleiter der mit einander verglichenen Klänge. Oder es
können die zusammenfallenden Partialtöne mit dem Schwingungsverhältnis
der Grundtöne wechseln, so daß die Höhe der letzteren die
Verwandtschaft bestimmt. Wir wollen das erste die konstante, das
letztere die variable Klangverwandtschaft nennen.
Die konstante Klangverwandtschaft bildet
das allgemeinste Hilfsmittel zur Erkennung des Ursprungs solcher Klänge,
die uns aus früherer Erfahrung bekannt sind. Sie ist es, die der Klangfärbung
musikalischer Instrumente und anderer Klangquellen zu Grunde liegt. Doch
muß hierbei der Begriff der Klangverwandtschaft etwas weiter als
auf die Identität einzelner Partialtöne ausgedehnt werden.
Es können nämlich Klänge auch dann verwandt erscheinen,
wenn bestimmte Ordnungszahlen der Partialtöne fehlen oder im Gegenteil
stark vertreten sind. Hier sind also in Wahrheit die Partialtöne veränderlich;
aber da sie ein konstantes, charakteristisches Verhältnis beibehalten,
so muß dieser Fall doch dem Gebiet der konstanten Klangverwandtschaft
zugerechnet werden. Die Klangähnlichkeit musikalischer Instrumente
beruht zum größten Teile auf Momenten, die hierher gehören,
wie auf dem Fehlen der gerad- und ungeradzahligen Partialtöne, der
Heraushebung oder Beseitigung von Obertönen bestimmter Ordnung4).
Hierzu kommen dann aber in der Regel auch noch konstante Obertöne,
meistens von sehr bedeutender Tonhöhe, welche aus gleichförmigen
Bedingungen der Klangerzeugung entspringen, und zu denen im weiteren Sinne
auch gewisse begleitende Geräusche gerechnet werden können, welche
in einzelnen Fällen, z. B. bei den Streichinstrumenten, zur Kennzeichnung
des Klanges nicht unwesentlich beitragen. Während aber bei den musikalischen
Klängen solche wirklich konstante Partialtöne nur eine untergeordnete
Bedeutung gewinnen, sind sie es, die einer andern sehr wichtigen Klasse
von Klängen und Geräuschen wesentlich zu Grunde liegen, den Sprachlauten.
wheatstone hat zuerst bemerkt, daß die Vokalklänge
auf der Hervorhebung bestimmter, für jeden Vokal charakteristischer
Partialtöne beruhen5). Von DONDERS
wurde gezeigt, daß die Mundhöhle als resonanzgebender Raum jene
charakteristischen Partialtöne der Vokale verstärkt6),
und helmholtz hat endlich durch die künstliche
Komposition der Vokale aus einfachen Stimmgabelklängen für die
akustische Seite dieser Theorie den Beweis geliefert7).
Da die Konsonanten nicht mehr eigentliche Klänge sondern Geräusche
sind, die ebendeshalb eine Analyse schwerer zulassen, so sind für
sie die charakteristischen Partialtöne meistens nicht unmittelbar
zu bestimmen. Wahrscheinlich sind oft viele, die sich zu einer unregelmäßigen
Luftbewegung zusammensetzen, also selbst schon Geräusche bilden, an
ihrer Entstehung beteiligt. Doch scheinen bei einigen Konsonanten, welche
unabhängig von mitgesprochenen Vokalen einen gewissen Klangcharakter
an sich tragen, wie dem P, K, R u. s. w., auch einzelne
charakteristische Partialtöne nachweisbar zu sein8).
Indem das menschliche Sprachorgan auf diese Weise Klang- und Geräuschformen
von konstanter Beschaffenheit erzeugt, wird es gerade geeignet für
bestimmte innere Vorgänge immer wieder dieselben Lautzeichen hervorzubringen
und auf diese Weise jene Vorgänge in dem Fluß der Vorstellungen
zu fixieren. An den außer uns hervorgebrachten Schalleindrücken
lehrt die konstante Klangverwandtschaft höchstens gewisse Klangquellen
unterscheiden, bei den Sprachlauten ist jede konstante Klang- und Geräuschfärbung
zu einem Element mannigfacher Vorstellungs- und Gefühlszeichen geworden.
Sie gibt nun nicht mehr bloß über den eigenen Ursprung des Klangs;
sondern über alles Auskunft, was der sprechende Mensch, aus welchem
der Laut entspringt, damit ausdrücken will9).
4) Vgl. Kap. IX.
5) WHEATSTONE, Westminster Review Oct. 1837.
6) DONDERS, Archiv f. die holländ. Beiträge
für Natur- und Heilkunde I, S. 157.
7) Helmholtz, Lehre von den Tonempfindungen. 3te Aufl.
S. 162 f.
8) Wolff, Sprache und Ohr. Braunschweig 1871. S. 23 f.
9) Über die Erzeugung der einzelnen Sprachlaute
und ihre akustischen Bestandteile vergl. mein Lehrbuch der Physiologie.
3. Aufl., S. 694 f.
Unter der variabeln Klangverwandtschaft verstehen wir die Tatsache, daß verschiedne Klänge je nach dem Verhältnis ihrer Tonhöhe in wechselndem Grade mit einander übereinstimmen können, während der allgemeine Charakter derselben ungeändert bleibt. Die variable und die konstante Klangverwandtschaft sind natürlich nicht ganz unabhängig von einander. Namentlich muß der Umstand, ob ein Klang dem starken Mitklingen der Partialtöne oder dem Mangel derselben, ob er den geradzahligen oder ungeradzahligen Partiallönen seine charakteristische Färbung verdankt, auch die variable Klangverwandtschaft beeinflussen. Es würde uns zu weit führen, die mannigfachen Modifikationen zu untersuchen, welche die von der Tonhöhe abhängige Verwandtschaft in Folge dieser Verhältnisse des konstanten Klangcharakters erfahren kann: Es mag daher an dem allgemeinsten Fall genügen, der für die Feststellung der variabeln Klangverwandtschaft, wie sie sich in den Gesetzen der musikalischen Harmonie ausgeprägt hat, vorzugsweise bestimmend gewesen ist. Dies ist jene Verwandtschaftsbeziehung, welche die Klänge darbieten, wenn in ihnen der Grundton von höheren Obertönen begleitet wird, deren Schwingungszahlen das 2-, 3-, 4fache u. s. w. der Schwingungszahl des Grundtons betragen, und deren Intensität rasch abnimmt, so daß sie im allgemeinen höchstens bis zum zehnten Partialton zu berücksichtigen sind. Ein Klang von der hier vorausgesetzten Beschaffenheit entspricht nach früheren Erörterungen dem allgemeinsten Schwingungsgesetz tönender Körper, indem die letzteren in der Regel, während sie als ganze schwingen, zugleich in ihren einzelnen Teilen Schwingungen ausführen, die sich wie die Reihe der einfachen ganzen Zahlen verhalten10). Wo vermöge besonderer Bedingungen der Klangerzeugung einzelne Glieder dieser Reihe ausfallen, da werden doch in größeren Zusammenklängen solche Lücken regelmäßig ergänzt, wie dies namentlich das Beispiel unserer modernen Harmoniemusik zeigt. Einen in der angegebenen Weise von gerad- und ungeradzahligen Obertönen mit rasch abnehmender Intensität begleiteten Klang können wir darum einen vollständigen Klang nennen. In der Tat ist ein solcher, während sein eigener Charakter unverändert bleibt, am besten geeignet, die von der Tonhöhe abhängige Klangverwandtschaft hervorzuheben. Da auf der letzteren die Gesetze der musikalischen Klangverbindung beruhen, so kann sie auch die musikalische Verwandtschaft der Klänge genannt werden. Wir müssen übrigens zwei Falle derselben unterscheiden: es sind nämlich entweder verschiedene Klänge direkt mit einander verwandt; oder sie haben nur gewisse Bestandteile mit einem und demselben dritten Klang gemein: letzteres wollen wir als indirekte Verwandtschaft bezeichnen. Beide Formen sind hauptsächlich an der Hand der im oben bezeichneten Sinne vollständigen Klänge festgestellt worden. Bei einfachen, der Obertöne entbehrenden Klängen kann von direkter Verwandtschaft streng genommen nicht mehr die Rede sein. Wenn trotzdem auch hier bestimmte Intervalle als harmonische, andere als disharmonische empfunden werden, so beruht dies zum Teil vielleicht auf Assoziationen, indem durch Erinnerung an vollständige Klänge die unvollständigen ergänzt oder die fast niemals ganz fehlenden Obertöne in der Vorstellung verstärkt werden, hauptsachlich aber darauf, daß solchen einfachen Klängen die indirekte Verwandtschaft nicht fehlt, indem die beim Zusammenklang derselben entstehenden Kombinationstöne in der unten zu erörternden Weise gemeinsame Grundklänge abgeben. In diesen Verhältnissen liegt es begründet, daß bei den einfachen Klängen, wie helmholtz11) bemerkt, das Harmoniegefühl unvollständiger ist. Doch gilt dies aus der oben angegebenen Ursache mehr für die melodische Aufeinanderfolge als für den harmonischen Zusammenklang.
10) Vergl. Kap. IX.
11) Lehre von den Tonempfindungen. 3. Aufl. S. 321.
Der Grad der direkten Verwandtschaft der Klänge wird durch die Partialtöne derselben bestimmt. Zwei Klänge müssen um so näher verwandt sein, je größer die Zahl und Stärke der Partialtöne ist, welche sie mit einander gemein haben. Die Stärke der Partialtöne ist aber von ihrer Ordnungszahl abhängig, indem sie im allgemeinen mit steigender Ordnungszahl abnimmt. Aus dieser Regel folgt unmittelbar, daß nur solche Klänge merklich verwandt sein können, bei welchen die Schwingungsverhältnisse der Grundtöne durch kleine ganze Zahlen ausgedrückt werden. Denn nur wenn diese Bedingung zutrifft, stimmen Partialtöne von niedriger Ordnungszahl überein12).
12) Stehen z. B. die Grundtöne in dem Verhältnis der Quinte 2 : 3, so hat der erste Ton die Partialtöne 2, 4, 6, 8, 10, 12 . . . ., der zweite die Partialtöne 3, 6, 9, 12 . . .. Hier fällt der 3te Partialton des ersten mit dem 2ten des zweiten Klangs, ebenso der 6te mit dem 4ten, der 9te mit dem 6ten, der 12te mit dem 8ten u. s. w. zusammen. Beiden Klängen sind demnach mehrere Partialtöne von niedriger Ordnungszahl gemeinsam, deren Stärke hinreicht, sie sogleich als verwandte Klänge erscheinen zu lassen. Anders ist dies z. B. mit dem Verhältnis der Sekunde 8 : 9. Hier stimmt erst der 8te Partialton des ersten mit dem 9ten des zweiten Klangs überein, dann wieder der 16te mit dem 18ten u. s. w. Schon die nächsten Partialtöne, die identisch sind, und noch mehr die späteren, besitzen also eine so hohe Ordnungszahl, daß sie jenseits der Grenzen noch empfindbarer Klangbestandteile liegen.
Man hat den Grund für die bevorzugte Stellung bestimmter Tonintervalle zuweilen unmittelbar in dieser Einfachheit der Schwingungsverhältnisse zu finden geglaubt. Für unsere Empfindung existieren aber nicht die Schwingungszahlen, sondern nur die von ihnen abhängigen Beziehungen der Partialtöne. Insofern jedoch die übereinstimmenden Bestandteile zweier Klänge zunehmen, wenn das Verhältnis der Schwingungszahlen einfacher wird, kann das letztere allerdings einen gewissen Maßstab der Klangverwandtschaft abgeben. In der Tat geben die Zahlen, welche die Intervalle der Grundtöne messen, immer zugleich an, welche unter den Partialtönen der beiden Klänge identisch sind. Wir gewinnen so, wenn wir uns auf diejenigen Klangverhältnisse beschränken, bei denen die Ordnungszahlen der coincidirenden Partialtöne hinreichend niedrig sind, daß die Grenzen merklicher Klangverwandtschaft nicht erheblich überschritten werden, folgende Reihe 13).
Ordnungszahlen der zusammen-
Intervalle
Verhältnis der
fallenden Partialtöne
(Grundton C)
Schwingungszahlen
des tieferen
des höheren Tons
Oktave c . . . . .
1 : 2
2, 4, 6,||8 etc.
1, 2, 3,||4 etc.
Doppeloktave c1 . . . .
1 : 4
4,||8,|12,16
1,||2,|3, 4
Duodecime g. . . . . .
1 : 3
3, 6,||9,|12
1, 2,||3,|4
Quinte G . . . . . .
2 : 3
3, 6,||9,|12
2, 4,||6, |8
Quarte F . . . . . .
3 : 4
4,||8,|12,16
3,||6,|9,12
Große Sexte A . . . . .
3 : 5
5,||10,|15, 20
3,||6,|9,12
Große Terz E . . . . .
4 : 5
5,||10,|15, 20
4,||8,|12,16
Kleine Terz Es . . . . .
5 : 6
6,||12,18, 24
5,||10,15, 30
Verminderte Septime B—
4 : 7
7,|14, 21, 28
4,|8,12,16
Verminderte Quinte Ges—
5 : 7
7,|14, 21, 28
5,|10,15, 20
Verminderte Terz Es—
6 : 7
7,|14, 21, 28
6,|12,18, 24
Kleine Sexte As . . . .
5 : 8
8,|16, 24, 32
5,|10,15, 20
Kleine Septime B . . . .
5 : 9
9,|18, 27, 36
5,|10,15, 20
Übermäßige Secunde D+
7 : 8
8,|16, 24, 32
7,|14, 21, 28
Übermäßige Terz E+ .
7 : 9
9,|18, 27, 36
7,|14, 21, 28
Secunde D . . . . . .
8 : 9
9,|18, 27, 36
8,|16, 24, 32
Große Septime H . . . .
8 : 15
15, 30, 45, 60
8,16, 24, 32
13) Wegen der Stimmung unserer musikalischen Instrumente nach gleichschwebender Temperatur entsprechen an denselben die Intervalle nur bei den Oktaven vollständig dem angegebenen Schwingungsverhältnis. Die hierdurch bedingten Abweichungen des Klangs sind aber so wenig merklich, daß sie die Auffassung der Klangverwandtschaft nicht sehr beeinträchtigen; nur können unter Umständen die in Folge der Abweichung von der reinen Stimmung entstehenden Schwebungen der Obertöne, falls die Klänge gleichzeitig angegeben werden, störend werden. Vergl. hierüber Kap. IX. Um solche Schwebungen zu vermeiden, bedient man sich am besten rein abgestimmter Zungenpfeifen, deren Klangfarbe durch die deutlich ausgeprägten Obertöne vorzugsweise zur Bestimmung der Klangverwandtschaft sich eignet. Die verminderte Septime, Terz und Quinte, sowie die übermäßige Secunde und Terz können auf Instrumenten von konstanter Stimmung überhaupt nicht angegeben werden; sie haben in der musikalischen Tonskala keine Stelle gefunden und konnten daher auch in der Tabelle nur durch ein + und — angedeutet werden, welches der ihnen nächstkommenden Note beigefügt ist. Die musikalische Praxis unterscheidet außer den angegebenen noch andere Intervalle, wie die übermäßige Quarte (25/18), die übermäßige Secunde (35/32) u. a., aber dieselben liegen so weit jenseits der Grenze der Klangverwandtschaft, daß sie für uns ganz außer Rücksicht bleiben können.
In dieser Reihe sind die zusammenfallenden Partialtöne überall bis zum vierten aufgeführt. Um die Ordnung, in welcher die Klänge nach ihrer Verwandtschaft einander folgen, deutlicher übersehen zu lassen, sind diejenigen übereinstimmenden Klangbestandteile, die vor dem 10ten Partialton des tieferen Klangs liegen, durch einen einfachen Vertikalstrich, die vor dem 6ten Partialton kommenden durch einen Doppelstrich abgesondert. Im allgemeinen läßt sich voraussetzen, daß die Partialtöne bis zum 6ten verhältnismäßig leicht wahrnehmbar sind. Wo vor diesem übereinstimmende Klangbestandteile vorkommen, ist daher eine mehr oder weniger deutliche Verwandtschaft anzunehmen. Die Partialtöne vom 6ten bis zum 10ten dagegen sind so schwach, daß sie für sich allein keine Klangverwandtschaft begründen können, doch mögen dieselben immerhin, wenn eine solche schon vorbanden ist, auf den Grad derselben von einigem Einfluß sein14). Die aufgeführten Intervalle trennen sich in folgende Gruppen:
1) Oktave, Doppeloktave, Duodecime. Sie sind vor allen andern Intervallen dadurch ausgezeichnet, daß die Partialtöne des zweiten Klangs sämtlich mit Partialtönen des ersten zusammenfallen. Der höhere Klang ist also hier eine einfache Wiederholung gewisser Bestandteile des tieferen; er fügt zu diesem nichts neues hinzu. Ebenso verhält es sich mit allen weiteren Intervallen, bei denen der Zähler des Schwingungsverhältnisses der Einheit gleich ist, wie 1 : 5, 1 : 6 u. s. w. Indem hier überall der höhere Klang lediglich nur die Obertonreihe des tieferen von einer bestimmten Stelle an reproduziert, liegt ein unvollständiger Einklang, nicht eigentlich ein Fall von Klangverwandtschaft vor. Je höher bei dem unvollständigen Einklang der zweite im Verhältnis zum ersten Klange liegt, um so kleiner wird übrigens die Reihe deutlich wahrnehmbarer Partialtöne, die zusammenfallen, um so unvollständiger erscheint daher der Einklang. Dieser ist bei der Doppeloktave schon viel schwächer als bei der Duodecime und vermindert sich noch viel mehr bei den weiter gegriffenen Intervallen, bei denen schließlich gar keine Partialtöne mehr wirklich zusammenfallen, weil die des höheren Tons erst da beginnen, wo die des tieferen bereits aufgehört haben.
14) So wird z. B. der kleinen Terz möglicher Weise nicht bloß deshalb ein geringerer Verwandtschaftsgrad zukommen als der großen, weil der erste der identischen Partialtöne bei dieser um eine Stufe tiefer liegt, sondern weil außerdem auch noch der zweite innerhalb der zehn ersten Partialtöne gelegen ist, während er bei der kleinen Terz diese Grenze überschreitet.
2) Duodecime und Quinte würden Intervalle von gleichem Verwandtschaftsgrad sein, wenn sich der letztere bloß nach den übereinstimmenden Partialtönen und ihrer Ordnungszahl bestimmen ließe. Bei beiden sind bis zur 6ten Stufe des tieferen Klangs zwei, bis zur 10ten drei identische Partialtöne vorhanden. Aber diese Intervalle geben zugleich augenfällige Beispiele für die Verschiedenheit des unvollständigen Einklangs und der Klangverwandtschaft. Die Duodecime ist eine höhere Wiederholung der Quinte, bei der alle nicht übereinstimmenden Partialtöne des zweiten Klangs weggeblieben sind. Unter denjenigen Klangverhältnissen, welche im eigentlichen Sinne verwandt genannt werden können, nimmt somit die Quinte die erste Stelle ein. Sie ist das einzige Intervall, welches auf zwei verschiedene Partialtöne des ersten und auf einen verschiedenen des zweiten Klangs je einen übereinstimmenden hat15).
15) Die Reihe der Partialtöne der beiden Klänge
wird nämlich bei der Quinte dargestellt durch die Zahlen:
I (C) 2 4
6 8 10
12 14 16
II (G) 3
6 9
12 15 u. s. w.
3) Quarte, große Sexte und große Terz bilden zusammen eine Gruppe von annähernd gleichem Verwandtschaftsgrad. Bei jedem dieser Intervalle ist ein übereinstimmender Partialton innerhalb der fünf ersten, ein zweiter innerhalb der fünf folgenden Stufen der Obertonreihe des Grundklangs enthalten. Das Verhältnis der übereinstimmenden zu den verschiedenen Partialtönen begründet die angegebene Reihenfolge der drei Intervalle. Bei der Quarte kommt nämlich auf 3 auseinanderfallende Partialtöne des ersten und auf 2 des zweiten Klangs, bei der großen Sexte auf 4 und 2, bei der großen Terz auf 4 und 3 je ein identischer Partialton. Die kleine Terz aber unterscheidet sich von jenen drei Intervallen nicht nur durch die höhere Ordnungszahl der zusammenfallenden Partialtöne, sondern auch durch die größere Zahl disparater Klangbestandteile, indem sie erst auf 5 verschiedene Partialtöne des ersten und auf 4 des zweiten Klangs einen übereinstimmenden enthält16).
16) Die Reihenfolge der Partialtöne ist bei den genannten
vier Intervallen die folgende:
Quarte 3 : 4
Große Sexte 3 : 5
I (C) 3 6
9 12 15
18 21 24
I (C) 3 6
9 12 15
18 21 24
II (F) 4 8
12 16
20 24
II (A) 5
10 15
20
25
Große Terz 4 : 5
Kleine Terz 5 : 6
I (C) 4 8
12 16 20
24 28
I (C) 5 10
15 20 25
30 35 40
II (E) 5 10
15 20
25 30
II (Es) 6
12 18 24
30 36
Bei allen weiteren Intervallen, welche in der obigen
Tabelle noch enthalten sind, kann die Klangverwandtschaft als verschwindend
klein angesehen werden, da die ersten zusammenfallenden Partialtöne
zwischen dem 6ten und 10ten gelegen sind; bei der großen Septime
überschreiten sie sogar diese Grenze. Man sieht aber sogleich, daß
diejenigen Intervalle, die wir als verwandte kennen gelernt haben, in der
Musik als mehr oder weniger harmonische Intervalle Geltung haben,
und daß sie nach dem übereinstimmenden Harmoniegefühl aller
Zeiten genau in die nämliche Reihenfolge gebracht worden sind, in
die sie nach ihrer Verwandtschaft sich ordnen. Unter den Intervallen, welche
erst durch Partialtöne, die über dem 6ten liegen, verwandt sind,
wird noch die kleine Sexte als nahe gleichwertig der kleinen Terz betrachtet,
in der Tat wird bei ihr die höhere Lage des coincidirenden Partialtons
des ersten Klangs durch die tiefere des zweiten etwas ausgeglichen. Noch
näher steht an und für sich die verminderte Septime einer deutlichen
Verwandtschaft; sie hat aber, weil sie sich zu mehrstimmigen Akkorden weniger
eignet, in der harmonischen Musik keine Verwendung gefunden.
Wie die Quinte ihren Charakter ändert, wenn
sie, um eine Oktave höher gelegt, zur Duodecime wird, so tritt dies
auch bei allen andern Intervallen ein. Aber keines derselben wird dabei
mehr, wie die Quinte, zu einem unvollständigen Einklang, sondern
alle andern bleiben innerhalb der Grenzen eigentlicher Verwandtschaft,
wobei der Grad der letzteren entweder vermindert oder vergrößert
wird. Die Verwandtschaft vermindert sich, wenn die Schwingungszahl des
tieferen Klangs eine ungerade, sie vergrößert sich, wenn dieselbe
eine gerade Zahl ist. Diese Regel folgt unmittelbar aus der Beziehung
der zusammenfallenden Partialtöne zu den Schwingungszahlen. Ist nämlich
die kleinere Schwingungszahl geradzahlig, so wird durch Halbierung derselben
das Schwingungsverhältnis der Oktave gewonnen. Nun ist aber, wie wir
gesehen haben, die Schwingungszahl des ersten Klangs zugleich Ordnungszahl
für den identischen Partialton des zweiten, die Schwingungszahl des
zweiten Klangs Ordnungszahl für den identischen Partialton des ersten.
Demnach wird in diesem Fall auch die Ordnungszahl der identischen Partialtöne
des zweiten Klangs auf die Hälfte herabgesetzt, während die des
ersten ungeändert bleibt. Ist dagegen die kleinere Schwingungszahl
ungeradzahlig, so kann das Schwingungsverhältnis der Oktave nur durch
Verdoppelung der größeren Schwingungzahl erhalten werden. Jetzt
bleibt daher die Ordnungszahl der Partialtöne des zweiten Klangs ungeändert,
während die des ersten verdoppelt wird. Von allen Intervallen mit
deutlicher Klangverwandtschaft wird demnach nur bei der Quinte und großen
Terz durch den Übergang zur Oktave die Verwandtschaft verstärkt.
Die Quinte entfernt sich durch den Übergang zur Duodecime sogar aus
dem Bereich der eigentlichen Klangverwandtschaft, indem sie zu einer der
Oktave analogen Klangwiederholung wird. Die große Terz wird zur großen
Decime mit dem Schwingungsverhältnis 2 : 5, wobei schon der
2te Partialton des zweiten Klangs mit dem 5ten des ersten zusammenfällt.
Bei allen andern harmonischen Intervallen vermindert sich die Klangverwandtschaft:
so beim Übergang der Quarte zur Undecime (3 : 8), der großen
Sexte zur Tredecime (3 : 10), der kleinen Terz zur kleinen Decime
(8 : 12)17).
17) Als Beispiele für das verschiedene Verhalten
dieser beiderlei Intervalle seien hier nur die Partialtöne der großen
Terz und Quarte mit ihren Oktavversetzungen angeführt.
Große Terz
Große Decime
I (C) 4 8
12 16 20
I (C) 2 4
6 8 10
II (E) 5
10 15
20
II (e) 5
10
Quarte
Undecime
I (C) 3 6
9 12 15
I (C) 3 6
9 12 15
18 21 24
II (F) 4 8
12 16
II (f)
8
16
24
Von der bisher betrachteten direkten Verwandtschaft verschiedener Klänge läßt sich die indirekte Verwandtschaft als diejenige unterscheiden, welche in der Beziehung zu einem gemeinsamen Grundklang begründet ist. Indirekt verwandt nennen wir nämlich solche Klänge, in denen Bestandteile enthalten sind, welche einem und demselben dritten Klang angehören (s. o.). Nun läßt eine indirekte sowohl ohne jede direkte, als auch mit gleichzeitig bestehender direkter Verwandtschaft sich denken18). In der Tat ist aber das letztere die ausnahmslose Regel, und zwar in der Weise, daß diejenigen Elemente, durch welche die Klänge direkt verwandt sind, immer auch ihre indirekte Verwandtschaft begründen. Nach den allgemeinen Gesetzen der Klangerzeugung und Klangempfindung bilden nämlich die übereinstimmenden Bestandteile verwandter Klänge zugleich Bestandteile eines dritten Klangs, welcher demnach als ihr gemeinsamer Grundklang betrachtet werden kann. Dieser Satz wird unmittelbar einleuchtend, wenn man erwägt, daß direkte Verwandtschaft nur existiert, wenn das Schwingungsverhältnis der Klänge durch kleine ganze Zahlen ausgedrückt werden kann, und daß die Schwingungszahlen der in einem Klang enthaltenen Partialtöne die Reihe der ganzen Zahlen bilden, wobei durch die Einheit die Schwingungszahl des Grundtons ausgedrückt wird. In der Quinte 2 : 3 sind also zunächst die Grundtöne eines jeden Klanges die nächsten Obertöne eines tieferen Klanges von der Schwingungszahl 1. Weiterhin sind aber auch die höheren Partialtöne 4, 6, 8. . . . und 3, 6, 9 . . . . Obertöne des nämlichen Grundklanges. Ebenso hat für alle andern Intervalle, sobald man dieselben in den einfachsten ganzen Zahlen ausdrückt, der Grundklang, in welchem alle Partialtöne der beiden Klänge als höhere Obertöne enthalten sind, die Schwingungszahl 1.
18) Es könnten z. B. zwei völlig verschiedene Klänge A = a, b, c . . . und B = m, n, o, p . . . indirekt verwandt sein, wenn ein dritter Klang C = a, m, b, o . . . existierte. Aber es können auch die direkt verwandten Klänge A = a, a , b, b . . . und B = m, a , n, b . . . außerdem indirekt verwandt sein, weil ein Klang C = x, a , b . . . existiert.
Man bemerkt nun sogleich, daß der Grad der indirekten zu dem der direkten Verwandtschaft in einer höchst einfachen Beziehung steht. Es wird nämlich die indirekte Verwandtschaft um so größer sein, je näher der Grundklang den beiden Klängen, die als seine Bestandteile angesehen werden können, liegt. Denn da die Stärke der Partialtöne im allgemeinen mit steigender Ordnungszahl abnimmt, so werden die Klänge um so vollständiger als Bestandteile eines solchen gemeinsamen Grundklanges aufgefaßt werden, je nähere Partialtöne desselben sie sind. Hiernach ist die indirekte Verwandtschaft bei Oktave, Duodecime, Doppeloktave u. s. w. am größten, indem bei allen diesen Intervallen, bei denen die Schwingungszahl des tieferen Klangs der Einheit gleich ist, die Entfernung des Grundklangs gleich null wird. Der letztere fällt hier unmittelbar mit dem tieferen Klang zusammen. Ebendeshalb kann aber in diesem Fall auch von indirekter Verwandtschaft nicht eigentlich die Rede sein. Der höhere Klang ist hier ein Bestandteil des tieferen, beide sind nicht erst in einem und demselben dritten Klange enthalten. Die im engeren Sinne verwandten Intervalle ordnen sich dann in derselben Reihenfolge an einander, wie nach ihrer direkten Verwandtschaft, wie die folgende kleine Tabelle zeigt, welche zu jedem der Intervalle den Grundklang und dessen Entfernung angibt.
Entfernung desselben nach unten
Intervall
Grundklang
vom tieferen
vom höheren Klang
Quinte (C : G) . . .
C1
Oktave
Duodecime
Quarte (C : F) . . .
F2
Duodecime
Doppeloktave
Große Sexte (C : A) . F2
Duodecime
Doppeloktave und Terz
Große Terz (C : E). C2
Doppeloktave
Doppeloktave und Terz
Kleine Terz (C : Es) . As3
Doppeloktave und Terz
Doppeloktave u. Quinte
So lange uns verschiedene Klänge nur in ihrer Aufeinanderfolge gegeben werden, ist die Beziehung durch direkte Verwandtschaft natürlich eine innigere als die durch indirekte. Aber dies wird anders, sobald dieselben einen Zusammenklang bilden. In diesem Falle entstehen nämlich, wie wir früher erfahren haben, Kombinationstöne19), unter denen der erste Differenzton, derjenige, dessen Schwingungszahl der Differenz der beiden Klänge entspricht, am stärksten ist. Dieser Kombinationston fällt nun bei allen Intervallen, deren Schwingungszahlen um eine Einheit verschieden sind, mit dem Grundton des Grundklangs zusammen: der letztere wird also beim Zusammenklang selbst gehört, so daß die Bestandteile der beiden Klänge unmittelbar als dessen höhere Partialtöne aufgefaßt werden können. Je näher dann der Kombinationston den direkt angegebenen Klängen liegt, um so mehr gleicht er im Verein mit dem Zusammenklang einem vollständigen Klang, dessen Partialtöne in großer Stärke erklingen. Entfernt er sich weiter, so bleibt zwischen ihm und dem angestimmten Intervall ein größerer Zwischenraum unausgefüllt, welcher gerade solchen Partialtönen entspricht, die in einem vollständigen Klang sehr deutlich zu hören sind; hier bildet daher der Kombinationston mit den direkt angegebenen Klängen eine unvollkommenere Klangeinheit. So hat die Quinte 2 : 3 den Kombinationston 1, sie bildet also mit ihm zusammen die drei tiefsten Partialtöne eines voll-standigen Klanges. Dagegen fällt schon bei der Quarte, welche mit ihrem Kombinationston den Dreiklang 1 : 3 : 4 bildet, der 2te Partialton aus; bei der großen Terz (1 : 4 : 5) ist dasselbe mit dem 2ten und 3ten, bei der kleinen Terz (1 : 5 : 6) sogar mit dem 2ten, 3ten und 4ten Partialton der Fall. Demnach ist bei der Quinte die indirekte Klangverwandtschaft am größten: im Zusammenklang ist sie die getreue Nachbildung eines vollständigen Klangs, nur dadurch von diesem verschieden, daß der Grundton geschwächt, und daß die zwei ersten Partialtöne verstärkt sind. Dagegen wird bei der Quarte, der großen und kleinen Terz die Verwandtschaft eine immer unvollkommnere. In der Musik hat daher auch die große Terz hauptsachlich die Bedeutung, daß sie die Quinte ergänzt, indem sie, wie wir unten sehen werden, mit ihr zusammen eine vollkommenere Nachbildung des vollständigen Klangs erzeugt. Die Quarte und kleine Terz dagegen sind bloße Umkehrungen der Quinte und großen Terz. Nimmt man nämlich statt des tieferen Tons der Quarte dessen höhere Oktave, so bildet das neu entstehende Intervall F : C eine Quinte: man kann daher auch die Quarte als eine Quinte betrachten, deren höherer Ton um eine Oktave vertieft ist. Sieht man ferner, wie oben schon angedeutet, die große Terz als Ergänzung der Quinte an, so entsprechen dem hierdurch entstehenden Dreiklang die Schwingungsverhältnisse 4 : 5 : 6, indem 4 : 6 die Quinte, 4 : 5 aber die große Terz bildet; das übrig bleibende Intervall 5 : 6 ist eine kleine Terz. Die letztere ergänzt somit in ähnlicher Weise die große Terz zur Quinte, wie diese durch die Quarte zur Oktave ergänzt wird.
19) Vergl. Kap. IX.
Von diesen Intervallen, welche beim Zusammenklingen unmittelbar ihren gemeinsamen Grundton erzeugen, unterscheiden sich wesentlich diejenigen, deren einfachste Schwingungszahlen um mehr als eine Einheit verschieden sind. Bei ihnen entspricht der Kombinationston nicht dem gemeinsamen Grundklang, sondern irgend einem Oberton des letzteren. Hierher gehört die Duodecime (1 : 3), welche die Oktave 2 des tieferen Tons zum Kombinationston hat. Sie enthält daher mit dem letzteren zusammen, gleich der Quinte, die drei tiefsten Partialtöne eines vollständigen Klanges; sie unterscheidet sich von der Quinte dadurch, daß nicht der tiefste, sondern der mittlere dieser Partialtöne schwächer mitklingt. Ferner gehören hierher die große Sexte (3 : 5), die kleine Sexte (5 : 8), kleine Septime (8 : 9) u. s. w. Bei der großen Sexte ist der Kombinationston die tiefere Quinte, bei der kleinen Septime die große Terz, bei der kleinen Sexte ist er die tiefere große Sexte des ersten Klangs. In allen diesen Fällen ist die Verwandtschaft der zusammenklingenden Töne eine weniger vollkommene, indem hier immer erst ein Differenzton höherer Ordnung gemeinsamer Grundton ist20).
20) Bei der großen Sexte und kleinen Septime ist dies z. B. der Differenzton zweiter Ordnung, weil hier Kombinationstöne erster Ordnung Quinte und große Terz sind; bei der kleinen Sexte, deren Differenzton die große Sexte ist, stimmt aber erst ein Differenzton dritter Ordnung mit dem gemeinsamen Grundklang überein.
Direkte und indirekte Klangverwandtschaft treffen
nicht nur immer zusammen, sondern es sind auch je zwei Klänge sowohl
direkt als indirekt immer im gleichen Grade verwandt. Offenbar nämlich
werden wir als Maß der direkten Verwandtschaft die Entfernung
des ersten gemeinsamen Obertons, als Maß der indirekten die
Entfernung des gemeinsamen Grundtons, der beim Zusammenklang als Differenzton
erster oder höherer Ordnung zu hören ist, benutzen können.
Nun ergibt sich aus der vorstehend mitgeteilten Tabelle, daß z. B.
bei der Quinte der nächste zusammenfallende Oberton der 3te Partialton,
also die Duodecime, des ersten, und der 2te, also die Oktave, des zweiten
Klangs ist. Nach der kleinen Tafel liegt aber der Grundklang der Quinte
eine Oktave unter dem tieferen, eine Duodecime unter dem höheren Ton.
Das ähnliche Verhältnis stellt sich in Bezug auf die übrigen
Intervalle heraus. Der gemeinsame Grundton liegt bei allen Intervallen
ebenso weit von dem tieferen wie der gemeinsame Oberton von dem höheren
der beiden Klange entfernt. Aber während der letztere immer gehört
wird, ob man nun die Klänge gleichzeitig oder sukzessiv angibt, kann
der erstere nur beim Zusammenklang zu einem wirklichen Bestandteil der
Empfindung werden.
Weniger einfach gestaltet sich die Beziehung der
beiden Arten der Klangverwandtschaft, wenn statt zweier Klänge drei
oder mehrere mit einander in Verbindung treten, was abermals entweder
in der Form der Aufeinanderfolge oder des Zusammenklangs geschehen kann.
Der Grad der direkten Verwandtschaft wird auch in diesem Fall durch diejenigen
Partialtöne bestimmt, welche den mit einander verbundenen Klängen
gemeinsam sind. Die Zahl dieser für alle Klänge identischen Partialtöne
nimmt natürlich mit der Zahl der verbundenen Klänge ab, dagegen
werden dieselben durch ihre mehrfache Häufung weit stärker gehoben.
Ähnlich verhält es sich mit dem gemeinsamen Grundton. Dieser
drängt sich bei mehrfachen Klängen intensiver zur Auffassung
und erscheint darum deutlicher als Grundton der ganzen Klangmasse. Hierzu
bildet jedoch eine wesentliche Bedingung, daß der Grundton den zusammenwirkenden
Klängen hinreichend nahe liege, um mit ihnen eine Klangeinheit bilden
zu können. Diese Bedeutung des Grundtons tritt ganz besonders dann
hervor, wenn derselbe beim Zusammenklang zugleich gemeinsamer Kombinationston
ist, weil er nur im letzteren Fall unmittelbar selbst in dem Zusammenklang
gehört wird.
Die mehrfachen Klangverbindungen unterscheiden sich
von dem Zweiklang wesentlich dadurch, daß bei ihnen der gemeinsame
Grundton und Oberton nicht mehr gleich weit von den direkt angegebenen
Klängen entfernt sind. Bei den einen ist der erste, bei den andern
der zweite der nähere. Dies ist der wesentliche Unterschied der Dur-
und Mollakkorde in der Musik. Zugleich klingt bei den Durakkorden
der gemeinsame Grundton selbst als Kombinationston mit: er bildet zusammen
mit den Haupttönen des Akkords eine deutliche Klangeinheit. Bei den
Mollakkorden muß derselbe hinzugedacht werden; er tritt in
dem Zusammenklang nur als ein Differenzton höherer Ordnung auf, der
wegen seiner verschwindenden Intensität für die unmittelbare
Auffassung nicht in Rücksicht kommt. Wir wollen beispielsweise den
C-Dur- und den C-Moll-Akkord in seine Klangbestandteile zergliedern.
Die Haupttöne des ersteren sind c : e :
g mit den Schwingungszahlen 4 : 5 : 6. Der gemeinsame
Grundton 1 ist das 2 Oktaven unter c liegende C1,
welches als gleichzeizeitiger Differenzton von c : e
und e : g deutlich den Akkord begleitet; nebenbei
wird schwächer der Differenzton C gehört, welcher der
Quinte (4 : 6) entspricht. Da die Obertöne eines jeden Tons
durch Vielfache seiner Schwingungszahl ausgedrückt werden, so muß
ferner der erste gemeinsame Oberton einem Vielfachen der Schwingungszahl
eines jeden der drei Töne entsprechen, d. h. diese Zahl muß
durch 4, 8 und 6 teilbar sein. Hieraus folgt, daß der übereinstimmende
Oberton die Schwingungszahl 60 hat. Es ist dies der 10te Partialton des
g, das um 3 Oktaven und eine Terz von demselben entfernte h'".
Für den Mollakkord c : es : g ist
10 : 12 : 15 das einfachste Verhältnis der Schwingungszahlen.
Sein gemeinsamer Grundton ist wieder 1, d. h. derjenige tiefere Ton, dessen
10ter Partialton c ist. Dies ist das 3 Oktaven und eine Terz unter
c liegende As3, welches zu keinem
der Intervalle Kombinationston erster Ordnung ist, also auch beim Anstimmen
des Akkords nicht merklich gehört wird. Die hörbaren Kombinationstöne
haben die Zahlen 2, 3 und 5, sie sind As2,
D1 und C; aber diese Kombinationstöne
coincidiren nicht, keiner ist daher als gemeinsamer Bestandteil der ganzen
Klangverbindung ausgezeichnet, und nur der dritte wiederholt sich im Akkord
als höhere Oktave. Der erste übereinstimmende Oberton des Mollakkords
hat wieder die Schwingungszahl 60, er ist der 4te Partialton oder die 2te
Oktave des Tones g, das g". In der Tat hört man beim
Anschlagen des C-Mollakkords dieses g" deutlich mitklingen,
während der identische Partialton des C-Durakkords wegen seiner
hohen Ordnungszahl nicht mehr wahrgenommen werden kann. Beide Zusammenklänge
unterscheiden sich also dadurch, daß die Töne des Durakkords
als Bestandteile eines einzigen Grundklangs erscheinen, die des Mollakkords
dagegen einen hohen Partialton gemeinsam haben. Beide Zusammenklänge
ergänzen sich außerdem, indem der gemeinsame Grundton des Durakkords
ebenso weit unter dem tiefsten Hauptton wie der gemeinsame Oberton des
Mollakkords über dem höchsten Hauptton des Zusammenklangs liegt.
Jene Gleichheit der Distanz von Grund- und Oberton, welche den einzelnen
Zweiklang auszeichnet, verteilt sich also auf zweierlei Dreiklänge.
Hierin liegt zugleich die bestimmte Hindeutung, daß die Unterschiede
von Dur und Moll nicht willkürlich erfunden, sondern in der Beschaffenheit
unserer Klangauffassung naturgesetzlich begründet sind.
Aus den Stammakkorden der Dur- und Molltonart entspringen abgeleitete Dreiklänge, wenn man zuerst die Reihenfolge der drei Klänge verändert und dann die so entstandenen zwei Intervalle wieder auf den nämlichen Grundton zurückbezieht. Durch solche Umlagerung werden aus den Dreiklängen c : e : g und c : es : g die folgenden vier weiteren Akkorde gewonnen:
![]()
Die obere Grenze der gebräuchlicheren Taktformen bilden dagegen der 3/4- und 4/4-Takt, in denen alle drei Grade der Hebung vertreten sind, nämlich:
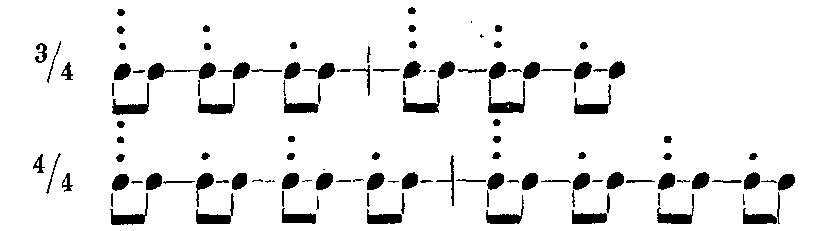
Eine mittlere Stellung nimmt der 2/4-Takt ein, in welchem sich zwei Grade der Hebung unterscheiden lassen:
![]()
Mehrere andere Taktformen, die noch angenommen werden, lassen sich auf die vier hier aufgezählten vollständig zurückführen, so der 2/1 und 2/16 auf den 2/8, der 3/2 auf den 3/4, der 2/2 und 4/8 auf den 2/4 Takt; andere sind Erweiterungen derselben, bei welchen die Zahl der Senkungen, die einer Hebung folgen, um eine oder einige vermehrt ist. Auf diese Weise entspringt aus dem 2/8 der 3/8, aus dem 3/4 der 9/8, aus dem 4/4 der 6/4 und 12/8, aus dem 2/4 der 5/8 Takt22). Endlich können zwei einfachere Taktformen in regelmäßigem Wechsel eine zusammengesetztere bilden: so ist der 5/4 Takt nur eine Kombination des 3/4 und 2/4 Taktes23).
21) Im poetischen Metrum den Fuß, nach der Sitte
der Alten, welche den Fuß zum Takttreten benützten.
22) Die eben genannten Takte lassen sich nämlich
in folgender Weise symbolisieren:
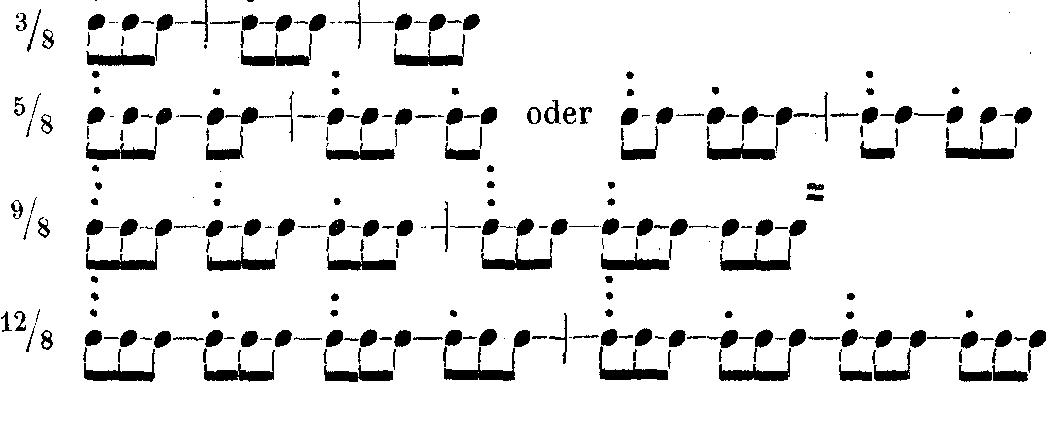
![]()
Die letztere Taktform nähert sich schon der Grenze
der Übersichtlichkeit und kommt daher selten vor. Zuweilen hat man
auch einen 9/4
Takt angewandt, dieser müßte aber, wenn er
keine bloße Wiederholung des 7/8 Taktes sein
sollte, folgende Accentuation besitzen:
23) Nämlich
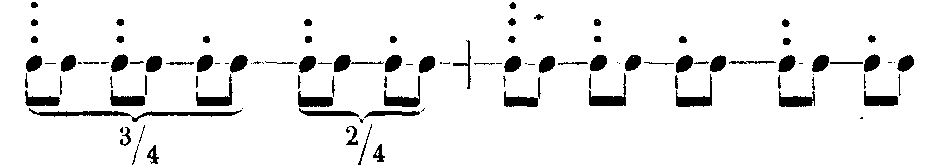
Alle hier aufgezahlten Taktformen können in zwei- und in dreigliedrige, sowie in gemischte, die gleichzeitig aus zwei- und dreigliedrigen Elementen aufgebaut sind, gesondert werden24). Für die ersteren bildet der einfache Wechsel von Hebung und Senkung, wie er im 2/8 Takte gegeben ist, den Grundtypus. Die dreigliedrigen Takte aber haben offenbar ihren Ursprung darin, daß ein gehobener Klang nicht bloß durch den regelmäßigen Wechsel mit einer Senkung, sondern auch dadurch, daß er immer zwischen zwei Senkungen eingeschlossen ist, für unsere Auffassung abgesondert werden kann. Die Grundform aller ungeradzahligen Takte ist daher der 3/8 Takt in folgender Gestalt:
![]()
Daß man alle Takte mit dem schweren Taktteil, und zwar bei den zusammengesetzteren Taktformen immer mit der stärksten Hebung, beginnen läßt, um, wenn das Ganze in Wirklichkeit mit einer Senkung anhebt, diese als sogenannten Auftakt voranzustellen, ist nur eine Sache der Übereinkunft. In Wirklichkeit kann jeder Takt ebensowohl mit der Arsis wie mit der Thesis beginnen, und für die Bildung der zweigliedrigen Takte müssen in der Tat die beiden Formen
![]()
als gleich möglich gelten. Anders verhält sich dies mit den dreigliedrigen Takten. Hier zeigt die Praxis sowohl der modernen wie der antiken Rhythmik, daß der schwere Taktteil immer zwischen zwei leichteren eingeschlossen ist, die entweder die gleiche Betonung haben oder wieder unter sich von verschiedener Schwere sein können; niemals aber ist der leichte Taktteil von zwei gleich schweren umfaßt. Es sind also hier nur die Grundformen
![]()
möglich, nicht aber
![]()
1) Es könnte scheinen, als wenn die antike Rhythmik diesem Gesetz widerspräche, da die Alten bei den dreiteilig ungeraden Takten häufig zwei Hebungen auf eine Senkung unterscheiden. Dies beruht aber, wie westphal bemerkt, lediglich darauf, daß die Alten da, wo ein mittelschwerer Taktteil vorkommt, diesen ebenfalls als Hebung zu bezeichnen pflegen. Vergl. westphal, System der antiken Rhythmik, Breslau 1865. S. 39.
Hieraus geht hervor, daß die dreigliedrigen Takte, wenn sie ihrer Bildung gemäß dargestellt werden sollten, durchweg mit der Senkung beginnen müßten25).
24) Die gewöhnliche Unterscheidung in geradzahlige
und ungeradzahlige Taktformen ist eine rein äußerliche, die
über den wirklichen Aufbau des Rhythmus keine Rechenschaft gibt. HAUPTMANN
unterscheidet ein zwei-, drei- und vierzeitiges Metrum: davon zerfällt
aber das letztere immer in zwei Glieder. Vergl. HAUPTMANN, die Natur der
Harmonik und Metrik. Leipzig 1853. S. 226 f.
25) Darnach würde die auf o.g. gebrauchte gewöhnliche
Schreibweise in folgende umzuändern sein:
Eine gewisse Anzahl von Takten vereinigt sich zur rhythmischen Reihe26); aus einer Anzahl von Reihen baut die rhythmische Periode sich auf. Auch diese zusammengesetzteren Bestandteile des Rhythmus sind eingeschlossen zwischen einer unteren und einer oberen Grenze. Die untere Grenze entspricht der kleinsten Anzahl einfacherer rhythmischer Gebilde, welche zusammengefaßt werden können, die obere entspringt auch hier aus dem Umfang unserer zeitlichen Auffassung. So besteht die kleinste rhythmische Reihe aus zwei Takten, die größte wird, wie die musikalische und die poetische Metrik übereinstimmend zeigen, durch sechs Takte gebildet. In der Musik ist das Mittel zwischen diesen Extremen, die geradzahlige Reihe aus vier Takten, die gewöhnliche Form. Rhythmische Reihen, welche über den Sechstakt (die Hexapodie) hinausgehen, lassen sich kaum mehr übersehen. Auch für die Periode (oder Strophe) ist wieder zwei die kleinste Zahl Reihen, aus denen sie sich zusammensetzt, und sie ist zugleich die gewöhnliche: die erste Reihe bildet den Vorder-, die zweite den Nachsatz. Verhältnismäßig seltener, und fast nur in der poetischen Rhythmik, die in dieser Beziehung wegen ihrer sonstigen Einförmigkeit einen größeren Umfang zuläßt, können drei, vier und selbst fünf Reihen mit einander verbunden werden27). Die Zahl einfacherer, rhythmischer Gebilde, die in zusammengesetztere vereinigt werden können, nimmt demnach mit steigender Komplikation immer mehr ab. Während der Takt sehr wohl 12 Intensitätswechsel des Klanges enthalten kann (wie im 12/8 Takt), erreicht die Reihe höchstens 6 Takte, die Periode 4, nur ausnahmsweise noch 5 Reihen. In der Musik wird das in Takte, Reihen und Perioden gegliederte Ganze häufig mehrmals in größere Abschnitte oder Sätze gefügt. Aber diesen Abschnitten fehlt die rhythmische Übersichtlichkeit. Sie finden ihren Zusammenhang nicht in rhythmischen Motiven, sondern in der Melodie: hier ist daher auch die Verbindung eine weit entferntere, wobei nur im allgemeinen die Erinnerung an das früher gehörte vorausgesetzt wird, ohne daß jedoch bestimmte Grenzen des Umfangs, innerhalb deren dies noch geschehen kann, nachzuweisen wären.
26) Sie wird in der musikalischen Metrik gewöhnlich als Absatz, in der poetischen als Verszeile bezeichnet.
27) Als Beispiel einer fünfgliedrigen Periode vergl. Goethe's Kophthisches Lied ("Geh', gehorche meinen Winken" u. s. w. Werke Bd. 1, S. 144), s. a. Westphal, Theorie der neuhochdeutschen Metrik. Jena 1870. S. 77. Eine fünfgliedrige Periode steht, wie dieses Beispiel zeigt, schon sehr hart an der Grenze, wo die Übersichtlichkeit aufhört.
Erst die systematische, von Takten zu Reihen, von
diesen zu Perioden fortschreitende rhythmische Einteilung eines Ganzen
sukzessiver Klangvorstellungen ermöglicht die zeitliche Übersicht
und Zusammenfassung desselben. Die Reihe wird durch Takte, die Periode
durch Reihen zusammengehalten: für sich würde jedes dieser größeren
rhythmischen Gebilde aus einander fallen; und wie jedes nur eine begrenzte
Größe erreichen kann, bis zu der es allein von unserer Zeitauffassung
zu bewältigen ist, so findet der ganze rhythmische Aufbau seine Grenze
hinwiederum in der Periode. Das rhythmische Element aber, auf welches alle
zusammengesetzten Bildungen zurückführen, ist der Takt. Indem
dieser eine konstante Anzahl von Hebungen und Senkungen in sich enthält,
nimmt er eine bestimmte Zeitdauer in Anspruch. Die Vorstellung der
Zeitdauer und ihrer Einteilung findet daher nicht nur ihren Ausdruck im
Rhythmus, sondern sie vervollkommnet sich auch wesentlich mittelst desselben.
Von den Zeitverhältnissen eines Ereignisses haben wir nur dann eine
einigermaßen genaue Vorstellung, wenn dasselbe in rhythmischer Form
abläuft. Ursprünglich aber ist außer unserer eigenen Bewegung
nur den Klangvorstellungen das rhythmische Maß eigen. Der Gesichtssinn
nimmt erst, indem er die Bewegung objektiv auffassen lernt, daran Teil.
Von unserer Bewegung her, in der wir das Rhythmische am frühesten
finden, nennen wir daher den Rhythmus überhaupt eine nach genau bestimmtem
Maß fortschreitende Bewegung. Aber in der Feinheit, mit der es die
Schritte der rhythmischen Bewegung auffaßt, übertrifft dann
unser Ohr weit die ursprünglichen Bewegungsgefühle. Es unterscheidet
einerseits Zeitteile, die bei der eigenen Bewegung nicht entfernt mehr
wahrnehmbar sind, noch deutlich als Bruchteile eines Taktes, und es vermag
anderseits in Rhythmen sich zu vertiefen, deren langsamer Fortschritt in
der Bewegung unseres Körpers nicht mehr nachgebildet werden kann.
Verbindet sich mit der Intensitätsänderung
zugleich ein Wechsel in der Qualität der Klänge, so ist damit
die Grundlage der Melodie gegeben. Die melodische Bewegung, die
immer innerhalb der rhythmischen geschehen muß, kann aber entweder
dem Gebiet der konstanten oder demjenigen der variabeln Klangverwandtschaft
angehören. Nur die letztere umfaßt die Melodie im musikalischen
Sinne, die erstere liegt der poetischen Kunstform zu Grunde. Nach der Metrik
der neueren Dichter muß die betonte Silbe mit einer Hebung, die unbetonte
mit einer Senkung zusammenfallen, während Reihe und Periode einzig
und allein durch die logische Zusammengehörigkeit des Satzes sich
absondern. Dies begründet eine gewisse Armut der rhythmischen Gliederung,
welche die neuere Metrik insgemein dadurch verbessert, daß sie entweder
an das Ende oder an den Anfang der zusammengehörigen rhythmischen
Reihen, die eine Periode oder einen Teil einer solchen bilden, Klänge
von konstanter Verwandtschaft setzt. So entstehen Reim und Assonanz, von
denen uns der erstere als das natürlichere Hilfsmittel der Gliederung
erscheint, weil verschiedene Reihen am sichersten durch ihre Schlußklänge
sich sondern. Die antike Rhythmik, welche kurze und lange Silben unterscheidet,
von denen eine der letzteren zweien der ersteren äquivalent ist, gewinnt
damit ein strengeres Zeitmaß, zugleich aber, wegen der wechselseitigen
Ersetzung der Kürzen und Längen nach ihrem Zeitwert, eine freiere
Bewegung innerhalb der einzelnen Takte. Hierdurch wird die antike Metrik
dem Zeitmaß der eigentlichen Melodie näher gerückt. In
der letzteren erreicht, vermöge der freieren Bewegung der musikalischen
Klänge, die Vertretung derselben nach ihrem Zeitwert den weitesten
Umfang, der nur an den Grenzen unserer Auffassung seine eigene Grenze findet.
Die kürzeste Zeitdauer für den einzelnen Klang ist hier, nach
den Angaben der Musiker, etwa 1/10 Sekunde28),
ein Zeitwert, der genau übereinstimmt mit der kürzesten Auffassungsdauer,
die unserm Bewußtsein möglich ist29).
Die längste Zeitdauer, die der einzelne Klang erreichen kann, ist
viel unbestimmter, sie hängt von dem Taktmaß der Melodie ab,
mit dem unsere Fähigkeit einem ausdauernden Klang seinen richtigen
Zeitwert zuzumessen veränderlich ist. Der Aufbau der Melodie innerhalb
dieser freieren Zeitbewegung der Klänge wird dann ganz und gar durch
die variable Klangverwandtschaft bestimmt. Ihr Einfluß macht hauptsächlich
in zwei Momenten sich geltend: erstens darin, daß das melodische
Ganze mit einem und demselben Klang, der Tonica, anzuheben und wieder
zu schließen pflegt; und zweitens in der Beziehung der rhythmischen
Perioden zu einander, indem jede derselben auch in melodischer Beziehung
ein Vorbild oder eine freie Wiederholung der zu ihr gehörenden folgenden
oder vorangehenden ist. In dem Ausgang von einem Leitton, der Tonica, und
in der Rückkehr zu demselben liegt eine gewisse Verwandtschaft mit
dem Reim, der ebenfalls durch die Wiederholung eines vorangegangenen Klangs
den Rhythmus abschließt. Aber der Reim steht zu dem rhythmischen
Ganzen in keiner innern Beziehung, daher er auch fortwährend wechseln
kann und nur die einzelnen rhythmischen Reihen von einander absondert,
während die Tonica die ganze Klangbewegung der Melodie beherrscht,
so daß in dieser jede rhythmische Reihe und Periode entweder mit
der Tonica selbst oder mit einem ihr verwandten Klang beginnen oder abschließen
muß. Nächst der Tonica kommt daher den nach den Gesetzen der
variabeln Klangverwandtschaft ihr nächststehenden Klängen, der
über und unter ihr gelegenen Quinte, die man als Ober- und
Unterdominante bezeichnet hat, im Fortgang der Melodie eine herrschende
Rolle zu30). Durch alle diese rhythmischen
Klangwiederholungen verstärkt sich wesentlich die Zeitanschauung,
welche die zusammengesetzteren Bestandteile des Rhythmus, die Reihe und
Periode, überhaupt nur dadurch zu fassen vermag, daß sich dieselben
mit einem melodischen Inhalte füllen, während die bloße
Hebung und Senkung der Klangintensität nur zum Überblick des
einzelnen Taktes ausreichen würden. Eine ähnliche Beschränkung
aber haftet dem Bewegungsgefühl und der Bewegungsvorstellung an, in
der höchstens kleinere rhythmische Reihen noch zu einem übersichtlichen
Ganzen zusammengesetzt werden können. Eine weiter gehende Gliederung
wird erst auf dem Boden der Klangverwandtschaft möglich. In dem Maße
als das Gebiet der letzteren die deutlich unterscheidbaren Intensitätsabstufungen
der Empfindung an Ausdehnung übertrifft, wird es fähiger größere
Reihen auf einander folgender Vorstellungen in Zusammenhang zu bringen.
Auch in dieser Beziehung bewährt also das Gehör seine eminente
Bedeutung als zeitauffassender Sinn.
28) G. Schilling, Lehrbuch der allgemeinen Musikwissenschaft.
Karlsruhe 1840. S. 268.
29) Vgl. Kap. XIX.
30) Die Analogie der poetischen und der musikalischen
Klangwiederholung wird vollständiger, wenn in dem poetischen Kunstwerk
ein und derselbe Reim teils direkt teils in Assonanzen von Anfang bis zu
Ende sich wiederholt. In der Tat empfindet man bei dem Ghasel und andern
auf fortwährende Klangwiederholung gegründeten Formen der orientalischen
Poesie unmittelbar die Ähnlichkeit mit der musikalischen Melodie.
Die Gesetze der Harmonie und der rhythmischen Bewegung der Klänge, die im obigen von einander gesondert wurden, haben sich natürlich innerhalb des menschlichen Bewußtsein gleichzeitig entwickelt, wie dies augenfällig an der Melodie zu Tage tritt, welche auf beiderlei Gesetze gegründet ist. Dabei hat aber zweifellos das Gefühl für die rhythmische Bewegung früher seine vollständige Ausbildung erreicht. Der Rhythmik der Alten lassen sich schon alle Grundregeln über den Wechsel von Hebung und Senkung und über die Grenzen unserer messenden Zeitauflassung entnehmen. In letzterer Beziehung scheint sogar das rhythmische Gefühl der Griechen ausgebildeter gewesen zu sein als das unserige, da einige ihrer zusammengesetztern rhythmischen Formen der heutigen Auffassung Schwierigkeiten bereiten. Es hängt dies wahrscheinlich damit zusammen, daß die poetischen Rhythmen der Alten von den dem Gebiet der Klangverwandtschaft angehörenden Hilfsmitteln der Reihen- und Periodenbildung, welche die Modernen anwenden, frei waren und dagegen das Zeitmaß mit größerer Strenge berücksichtigten. Bezeichnend für diese der Harmonie vorausgeeilte Entwicklung der Rhythmik ist überdies die geschichtliche Tatsache, daß sich das Gefühl für die Verwandtschaft der Klänge nicht aus dem Zusammenklang, welchem das moderne Ohr hauptsächlich das Maß der Harmonie oder Disharmonie entnimmt, sondern aus der melodischen Aufeinanderfolge entwickelt hat. Nicht gefesselt durch die beim harmonischen Zusammenklang in Rücksicht kommenden Verhältnisse der Konsonanz und Dissonanz, aber auch weniger sicher in der durch die Kombinationstöne fühlbar werdenden indirekten Klangverwandtschaft, bewegte die Melodie der Alten sich freier und mannigfaltiger31).
31) Vgl. FORTLAGE, das musikalische System der Griechen in seiner Urgestalt. Leipzig 1847.
Wie nun das Gefühl für die Harmonie sich langsamer als dasjenige für den Rhythmus ausgebildet hat, so haben auch über den Ursprung desselben viel widerstreitendere Ansichten geherrscht. Es sind hauptsächlich drei Theorien über diesen Gegenstand aufgestellt worden. Nach der ersten, welche zuerst von EULER entwickelt wurde und bis in die neueste Zeit die herrschende blieb, erscheinen uns Klänge, deren Schwingungszahlen in dem Verhältnis einfacher ganzer Zahlen stehen, deshalb harmonisch, weil uns, wie in der Baukunst, die Einfachheit des Verhältnisses unmittelbar gefällt32). Aber da wir von den Schwingungszahlen der Töne kein Bewußtsein haben, so bleibt diese Theorie die eigentliche Antwort auf die Frage nach dem Grunde des Harmoniegefühls schuldig. Nach der zweiten Ansicht, welche zuerst von Rameau33) begründet und dann von D'ALEMBERT34) vervollständigt wurde, nennen wir solche Klänge harmonisch, welche Teiltöne mit einander gemein haben oder als Bestandteile eines und desselben Grundklangs erscheinen. Diese Theorie gründet sich bereits auf die Erkenntnis, daß jeder Grundklang eine Reihe von Obertönen, deren Schwingungsverhältnisse der Reihe der ganzen Zahlen entsprechen, mitklingen läßt35). In neuerer Zeit hat A. von oettingen wieder an dieselbe angeknüpft und sie namentlich vollständiger als dies durch D'ALEMBERT geschehen war auf die Mollakkorde ausgedehnt. Er faßt demnach die Töne des Durakkords auf als zugehörig zu einem einzigen Grundton, dem tonischen Grundton (basse fondamentale nach RAMEAU), die Klänge des Mollakkords dagegen als übereinstimmend in einem einzigen Oberton, den er den phonischen Oberton nennt. So stellt oettingen überhaupt ein doppeltes Prinzip, der Tonalität und der Phonalität, als zu Grunde liegend dem Aufbau der harmonischen Zusammenklänge auf36). Davon kommt das erstere im wesentlichen mit dem überein was wir oben vom Standpunkt der physiologischen Klanganalyse aus die indirekte, das zweite mit dem was wir die direkte Klangverwandtschaft genannt haben. Nach der dritten Ansicht, welche gegenwärtig von helmholtz vertreten wird, beruht die Harmonie auf der fehlenden Dissonanz, d. h. auf dem Mangel von Schwebungen oder Rauhigkeiten des Klangs. Indem solche Schwebungen ebensowohl zwischen den Grundtönen wie zwischen den Obertönen und Kombinationstönen vorkommen, ist die Möglichkeit zu sehr mannigfachen Dissonanzen gegeben. Der Grad der Harmonie ist nun nach helmholtz wesentlich durch die Größe der Dissonanz bestimmt, die bei einer geringen Verstimmung eines der Grundtöne zwischen den Obertönen und den Kombinationstönen entstehen können37). Diese Theorie macht jedoch den Fehler, daß sie das Harmoniegefühl nur negativ erklärt. Der Mangel der Dissonanzen unterstützt gewiß wesentlich die befriedigende Auflassung der Zusammenklänge, aber als positive Ursache der Harmonie kann er nicht gelten. Hiergegen spricht auch die oben schon hervorgehobene Tatsache, daß in einer Zeit, welche sich des harmonischen Zusammenklangs noch nicht bediente, doch das Gefühl für die harmonisch zusammengehörigen Klänge bereits entwickelt war. Ebenso vermag die HELMHOLTZ'sche Theorie über den Gegensatz des Dur- und Mollsystems keine Rechenschaft zu geben. Statt des Mollakkords könnte ebenso gut irgend eine andere Kombination minder vollkommen konsonanter Intervalle zur Grundlage eines neuen Systems dienen, wenn jene Gleichsetzung von Harmonie und fehlender Dissonanz richtig wäre. Wir haben dagegen geglaubt, für das positive Gefühl der Harmonie auch einen positiven Grund aufsuchen zu müssen, und wir konnten diesen allein in dem Prinzip der Klangverwandtschaft finden, was im wesentlichen auf die RAMEAU'sche Theorie wieder zurückführt38). Hinsichtlich der Reihenfolge der harmonischen Intervalle stimmen die oben aus diesem Prinzip abgeleiteten Resultate mit denjenigen überein, welche Helmholtz39) aus dem Prinzip der Störung durch die Schwebungen der Partialtöne erhalten hat. Über die Ursachen des Wohlgefallens aber, welches wir bei dem sukzessiven oder gleichzeitigen Hören harmonischer Klänge empfinden, werden wir erst später, bei Untersuchung der ästhetischen Gefühle, Rechenschaft geben können 40).
32) EULER, nova theoria musicae, Kap. II, p. 26 seq.
33) Nouveau systéme de musique. Paris 1726.
34) Elémens de musique théorique et pratique
suivant les principes de M. rameau. Nouv. édit. Lyon 1766.
35) Rameau, a. a. O. p. 17.
37) A. v. OETTINGEN, Harmoniesystem in dualer Entwicklung.
Dorpat u. Leipzig 1866.
37) HELMHOLTZ, Lehre von den Tonempfindungen. 3te Aufl.
S. 297 f.
38) Vgl. hierzu oben Kap. IX. S. 370.
39) a. a. O. S. 296 f.
40) Siehe Kap. XVII.