Qualität der Empfindung.
Verstehen wir unter Qualität der Empfindung jenen Bestandteil derselben, welcher übrig bleibt, wenn wir die Intensität uns hinwegdenken, so können alle Empfindungen nach ihrem qualitativen Verhalten in zwei große Klassen gebracht werden. Die einen wollen wir die qualitativ einförmigen nennen. Es sind dies solche Empfindungen, die nur eine bestimmte Qualität erkennen lassen, welche nun alle möglichen Intensitätsabstufungen zeigt. Hierher gehören in erster Linie die Organempfindungen oder Gemeingefühle. Sie zeigen allerdings in verschiedenen Organen qualitative Unterschiede, so daß hierdurch eine ziemlich große Mannigfaltigkeit derselben entsteht, in jedem einzelnen Organ aber scheinen sie nur intensiv veränderlich zu sein. Den Gemeingefühlen verwandt sind die Empfindungen der Haut, welche sich zwar in drei Qualitäten, Druck, Wärme und Kälte, sondern, wobei aber diese nicht in unmittelbarer Beziehung zu einander stehen und jede einzelne für sich nur Intensitätsunterschiede darbietet. Endlich gehören zu den qualitativ einförmigen Empfindungen die so genannten Muskelgefühle. Sie müssen in zwei ganz verschiedene Klassen geschieden werden, nämlich erstens in die unmittelbare Empfindung der bei der Bewegung aufgewandten Muskelkraft, wir wollen sie speziell als das Innervationsgefühl bezeichnen, und zweitens in Empfindungen, die von dem Ernährungs- oder sonstigen Zustände der Muskeln herrühren, und die namentlich bei der Ermüdung, bei Verletzungen der Muskeln u. dergl. beobachtet werden; wir nennen sie die Muskelgefühle im engeren Sinne. Die Innervationsgefühle, die für die Bildung unserer objektiven Vorstellungen von eminenter Wichtigkeit sind, werden in den Muskeln nur lokalisiert, gehören aber ihrem Ursprung nach zu den Empfindungen aus zentraler Reizung, wie aus der Erfahrung hervorgeht, daß sie von dem Zustande der Muskeln und ihrer Nerven ganz und gar unabhängig sind, dagegen zu der Stärke der auf eine Bewegung gerichteten Willensintention in direkter Beziehung stehen1). Die eigentlichen Muskelgefühle schließen sich vollständig den Organempfindungen an. Auch sie sind gewöhnlich von so geringer Intensität, daß sie der Aufmerksamkeit entgehen, können aber in andern Fällen bis zu den heftigsten Schmerzen sich steigern. Zum Gemeingefühl tragen beide Arten der Empfindung wesentlich bei. Ihre qualitativen Unterschiede sind, wie die Unterschiede aller Organempfindungen, höchst unbestimmt. Die Innervationsgefühle sind intensiv außerordentlich fein abgestuft, aber qualitativ einförmig; die eigentlichen Muskelgefühle sind vielleicht je nach der Art ihrer Entstehung etwas verschieden, doch scheinen immerhin z. B. bei der Ermüdung und bei einem Schlag auf den Muskel Empfindungen verwandter Art zu entstehen, ja es ist sehr möglich, daß wir dieselben nur nach nebensächlichen Umständen, wie Ausbreitung des Eindrucks, Miterregung der Haut u. dergl., unterscheiden. Die intensive Abstufung der eigentlichen Muskelgefühle ist weit unvollkommener als die der Innervationsempfindungen, was damit zusammenhängt, daß sie, wie die meisten Organgefühle, erst bei größerer Intensität unsere Aufmerksamkeit auf sich ziehen2).
1) Vergl. Kap. XII u. XIV.
2) Die Ansicht, daß die Innervationsgefühle in Wahrheit auf Tastempfindungen beruhen sollen, welche von mehreren Physiologen, namentlich von schiff (Physiologie I, S. 156 f.), verteidigt worden ist, kann nach den Kap. V S. 213 angeführten Beobachtungen gegenwärtig wohl für widerlegt gelten. Hingegen behalten Schiff's Einwände gegen die Lehre von einem spezifischen Muskelsinn insofern Recht, als nicht alle Vorstellungen, die sich an die Muskelbewegung knüpfen, auf das Innervationsgefühl zurückgeführt werden können, indem namentlich die Vorstellungen von der Lage unserer Glieder im Raume und von den äußeren Widerständen der Bewegung wesentlich mit auf Tastgefühlen beruhen. Vergl. Kap. XII. Daß die Innervationsgefühle als Empfindungen der aufgewandten Kraft zentralen Ursprungs sein müssen, habe ich schon früher hervorgehoben (Vorlesungen über die Menschen- und Tierseele I, S. 222). Dieselbe Ansicht ist auch von A. Bain entwickelt worden, der außerdem eine sehr sorgfältige Beschreibung der eigentlichen Muskelgefühle geliefert hat (The senses and the intellect. 2. edit. London 1864. p. 87). Um Verwechselungen mit den letzteren zu vermeiden und den Ursprung der an die motorische Innervation geknüpften Empfindungen deutlicher zu bezeichnen, ziehe ich hier den Ausdruck "Innervationsgefühle" dem ebenfalls oft gebrauchten "Bewegungsempfindungen" vor.
Den qualitativ einförmigen stehen die qualitativ mannigfaltigen
Empfindungen gegenüber. Sie kommen darin überein, daß jede
Art derselben aus verschiedenen Qualitäten besteht, die in einer ähnlich
abgestuften Weise wie die Intensitätsgrade einer Empfindung in einander
übergehen. Dies ist die Eigenschaft der vier Spezialsinne,
Gehör, Gesicht, Geruch und Geschmack. Jeder derselben enthält
eine zusammenhängende Mannigfaltigkeit von Qualitäten, von denen
jede einzelne verschiedene Intensitätsgrade durchlaufen und außerdem
in die ihr nächstverwandten Qualitäten stetig übergehen
kann. Die Qualitäten eines jeden der vier Spezialsinne lassen sich
daher als eine stetige Mannigfaltigkeit oder als ein Continuum
betrachten. Übrigens muß bemerkt werden, daß das letztere
nur bei den zwei ausgebildelsten Sinnen, dem Gehör und Gesicht, näher
nachzuweisen ist, bei den zwei andern aber bloß im allgemeinen vorausgesetzt
werden muß, indem die Geruchs- und Geschmacksqualitäten zwar
Übergänge darbieten, ohne daß es jedoch gelänge, dieselben
in eine bestimmte Ordnung zu bringen. Hier ist also nur ausgemacht, daß
die Qualitäten ein Continuum bilden, die nähere Beschaffenheit
des letzteren ist aber noch unbekannt.
Die Existenz einer abgestuften Mannigfaltigkeit
von Qualitäten trifft mit einer andern Eigenschaft der vier Spezialsinne
zusammen, durch welche sich die Empfindungen derselben hauptsächlich
von der Summe aller übrigen Empfindungen absondern. Dies ist die Eigenschaft,
daß ihre Qualitäten von einander und von den übrigen Arten
des Empfindens am deutlichsten unterschieden sind. Die Organ- und
Innervationsgefühle bieten, obgleich namentlich die letzteren in Bezug
auf ihre Intensitätsgrade sehr genau getrennt werden können,
wenig ausgeprägte qualitative Differenzen dar, und dasselbe gilt einigermaßen
auch noch von den Hautempfindungen, da manche Organgefühle eine unverkennbare
Ähnlichkeit teils mit den Druck -, teils mit den Temperaturempfindungen
der Haut zeigen.
Man darf wohl annehmen, daß alle diese Eigenschaften,
die Mannigfaltigkeit der Qualitäten und die deutlichere Verschiedenheit
derselben, unmittelbar mit den Strukturverhältnissen der
Sinnesorgane zusammenhängen. In den Organen der vier Spezialsinne
wird nämlich die Wirkung der Sinnesreize auf die Nerven durch eigentümliche
Endgebilde vermittelt, deren Beschaffenheit der besondern Form des Reizes
genau angepaßt scheint. Diese Anpassung kommt überall so zu
Stande, daß die Endfasern der Nerven in Zellen eintreten, welche
im allgemeinen den Charakter der Epithelzellen an sich tragen, und deren
Formen je nach der Beschaffenheit der äußeren Eindrücke
verschiedentlich modifiziert sind. Am deutlichsten haben die Endzellen
ihren epithelialen Charakter beim Geruchs und Geschmacksorgan bewahrt,
wo sie, an der Oberfläche der betreffenden Schleimhäute gelegen,
mit eigentlichen, nicht mit Nerven zusammenhängenden Epithelzellen
vermengt sind. In der Geruchsschleimhaut liegen die Riechzellen
zwischen Epithelzellen von zylindrischer Form. (Fig.
70). Sie besitzen im allgemeinen einen ovalen Zellkörper,
welcher hinten in einen feinen Nervenfaden und vorn in einen stäbchenförmigen
Fortsatz übergeht, der an der Oberfläche der Schleimhaut entweder
mit einem abgestumpften Ende aufhört (bei den Säugetieren) oder
in ein Büschel langer Cilien sich auflöst (bei den Amphibien
und Vögeln)3). Von diesem Verhalten
unterscheiden sich die Endorgane des Geschmackssinns schon dadurch,
daß sie auf scharf begrenzte Stellen der Zungenschleimhaut beschränkt
sind. Die Geschmackszellen liegen nämlich bei den Säugetieren
in flaschenförmigen Vertiefungen der Schleimhaut, welche von einer
eigentümlich gestalteten Fortsetzung des Epithels ausgekleidet werden.
Die in diesen Vertiefungen, den Schmeckbechern oder Geschmacksknospen (Fig.
71), gelagerten Epithelzellen, die so genannten Deckzellen,
sind von spindelförmiger Gestalt (Fig.
72 b); in dem von ihnen umschlossenen Hohlraum finden sich dann
die eigentlichen Geschmackszellen (ebend. a). Diese sind ebenfalls
spindelförmig, unterscheiden sich aber teils durch ihren größeren
Kern, teils durch stark verjüngte Fortsätze, in welche ihre beiden
Enden übergehen. Der nach innen gerichtete Fortsatz wird wieder unmittelbar
zu einem feinen Nervenfaden, der nach außen gerichtete endet mit
einem der Oberfläche zugekehrten Stäbchen oder Härchen.
Die Nervenfasern bilden, ehe sie zu stärkeren Nerven sich sammeln,
ein Geflecht, in welches auch Ganglienzellen eingeschaltet sind4).
Offenbar sind also die Riech- und Geschmackszellen Endorgane von sehr ähnlicher
Beschaffenheit. Bei beiden sind es stäbchen- oder cilienförmige
Fortsätze der Zelle, auf welche zunächst die Sinnesreize einwirken.
Solche Fortsätze können nun im allgemeinen leicht durch äußere
Einwirkungen in Bewegung gesetzt werden, insbesondere aber gehören
die chemischen Reizmittel, für deren Auffassung vorzugsweise
Geruchs- und Geschmackssinn bestimmt sind, zu den stärksten Erregern
der Cilienbewegungen5).
3) Schultze, Untersuchungan über den Bau der Nasenschleimhaut. Halle 1862. BABUCHIN in STRICKER'S Gewebelehre S. 964 f
4) Etwas abweichend verhalten sich die Geschmacksorgane der Amphibien. Bei ihnen bilden dieselben scheibenförmige Epithelinseln, auf welchen zwischen zylindrischen Epithelzellen die eigentlichen Geschmackszellen liegen. Diese sind hier ebenfalls spindelförmige, an einem Nervenfaden aufsitzende Zellen, welche aber nach vorn in einen gabelförmig gespaltenen Fortsatz übergehen. Bei den Vögeln und Reptilien sind die Geschmacksorgane noch nicht aufgefunden. Vgl. Th. W. ENGELMANN in STRICKEK'S Gewebelehre, S. 822 f. und Schwalbe im Arch. f. mikr. Anat. III, S. 504, IV, S. 96 u. 154.
5) Engelmann, die Flimmerbewegung. Leipzig 1868. S. 33, 143.
Im Gehörapparat begegnen uns in Bezug auf die unmittelbare
Endigung der Nervenfasern die ähnlichen Verhältnisse. In den
Ampullen der Bogengänge gehen dieselben in spindelförmige Zellen
über, deren jede, von gewöhnlichen Zylinderepithelzellen umgeben,
an ihrem freien Ende mit einem steifen haarförmigen Fortsatze versehen
ist (Fig. 73). Derselbe
hängt, wie es scheint, unmittelbar mit dem Kern der Spindelzelle zusammen,
in welchen vom anderen Ende her der Nervenfaden sich fortsetzt. In der
Schnecke hängen die Fasern des Hörnerven mir Zellen zusammen,
deren jede ein Büschel borstenförmiger Fortsätze trägt;
auch hier sind diese Zellen von gewöhnlichen zylindrischen Epithelzellen
umgeben. Charakteristisch für die Acusticusendigung sind aber nicht
sowohl diese Endgebilde selbst als vielmehr die ihnen beigegebenen Hilfsapparate,
durch welche namentlich die Schnecke zu einem äußerst verwickelt
geformten Organ wird. Schon in den Ampullen sind Einrichtungen getroffen,
welche augenscheinlich darauf abzielen, den eigentlichen Endgebilden eine
feste Stütze zu bieten. Die Nervenendzellen ruhen nämlich hier
auf der Knorpelplatte der Ampullenwand auf, welche in Folge des Durchtritts
der freien Nervenfasern siebförmig durchlöchert ist. Der freie
Endfaden der Zellen aber ragt in das Labyrinthwasser, dessen Bewegungen
sich ihm unmittelbar mitteilen müssen.
In der Schnecke liegen die Endgebilde in einem Raume,
der von zwei zwischen den knöchernen Wänden der Schnecke ausgespannten
Membranen umschlossen ist (Fig.
74). Die bei der natürlichen Lage der Schnecke innere,
oder, wenn man sich die Spitze nach oben gekehrt denkt, die untere
diese Membranen, die Grundmembran (f - L Sp), ist an einer knöchernen
Leiste befestigt, welche den Windungen des Scheckenkanals folgend in denselben
von der Spindel der Schecke aus vorspringt, als sogenannte crista spiralis
(RCr). Der freie Rand der Leiste besitzt eine gezahnte Beschaffenheit
und bildet auf diese Weise die Gehörzähne (Cr).
Die Grundmembran und die äußere oder (bei nach oben gekehrter
Spitze) obere jener Membranen, die Vorhofsmembran (auch REISSNER'sche
Membran genannt, R - R1),
umschließen zusammen den häutigen Schneckenkanal (D.C.),
welcher den Windungen der knöchernen Schnecke folgt, und durch welchen
diese letztere in zwei Abteilungen, in einen äußeren bez. obern
Gang) die Vorhofstreppe (S. V.), und in einen inneren bez.
unteren, die Paukentreppe (S. T.), geschieden wird. Beide
sind vollständig getrennt bis zur Schneckenspitze, wo sie durch eine
enge Öffnung mit einander kommunizieren. Die Vorhofstreppe mündet
direkt in den Vorhof; dem in ihr enthaltenen Labyrinthwasser teilen sich
daher unmittelbar die Druckschwankungen mit, welche in der Flüssigkeit
des Vorhofs entstehen, wenn die Membran des Vorhofsfensters, die mit dem
Steigbügeltritt in Verbindung steht, durch die Gehörknöchelchen
in Bewegung gerät. Die Paukentreppe dagegen ist an ihrem äußern
Ende durch eine besondere Membran, das Nebentrommelfell, gegen die Paukenhöhle
geschlossen. Wird nun von den Gehörknöchelchen aus das Labyrinthwasser
des Vorhofs in Bewegung gesetzt, so teilt sich diese der häutigen
Schnecke und durch die letztere dem Labyrinthwasser der Paukentreppe mit,
wie man sich nach politzer mittelst eines in das runde
Fenster eingesetzten Manometers überzeugen kann. Das Wasser in einem
solchen Manometer wird in die Höhe getrieben, sobald man einen stärkeren
Luftdruck, der den Steigbügel in das ovale Fenster eintreibt, auf
das Trommelfell anwendet6). Auf diese Weise
müssen also auch die im häutigen Schneckenkanal gelagerten Gebilde
durch mechanische Erschütterungen, mögen dieselben ihnen von
den Gehörknöchelchen oder durch das runde Fenster von der Luft
der Paukenhöhle aus zugeleitet werden, leicht in Bewegung geraten7).
Die zwischen der Vorhofs- und Grundmembran eingeschlossenen Teile, welche
die Endigungen des Hörnerven enthalten, und welche man zusammen das
CORTI'sche Organ nennt (f p Fig.
74), sind nun auch hier mehr oder minder
modifizierte Epithelformen. Zunächst sind nämlich sowohl auf
den innern an der Schneckenspindel befestigten (f) wie auf den äußern
mit der Circumferenz des Schneckenkanals verwachsenen Teil der Grundmembran
(L. sp.) einige Reihen gewöhnlicher Epithelzellen aufgelagert
(B und E Fig.
75), dann folgen, ungefähr die Mitte der Grundmembran einnehmend,
eigentümliche bogenförmige Gebilde, die CORTI'schen
Bogen oder Pfeiler (l Fig.
74, C Fig.
75), zwischen denen und der Grundmembran eine Wölbung frei
bleibt. Man unterscheidet eine Reihe innerer (gegen die Schneckenspindel
gekehrter) und eine Reihe äußerer Bogen (a und b
Fig. 76), die beide
an ihren Köpfen sehr fest mit einander verbunden sind, indem die Zahl
der inneren Pfeiler bedeutend größer ist als die der äußern,
so daß einer der letzteren immer zwischen den Köpfen mindestens
zweier innerer Pfeiler eingekeilt ist. Auf diesen aus harter knochenähnlicher
Substanz bestehenden CORTI'schen Bogen ruhen nun die
mit den Acusticusfasern zusammenhängenden Haarzellen auf. Man unterscheidet
eine innere einfache Reihe solcher Zellen, welche auf Verlängerungen
der inneren Pfeiler, den so genannten Kopfplatten derselben, aufsitzt (e
Fig. 75, c
Fig. 76), und mehrere
äußere Reihen auf den äußeren Pfeilern. Die letzteren
führen zu diesem Zweck ebenfalls Verlängerungen oder so genannte
Kopfplatten, welche in mehrere Glieder, ähnlich den Phalangen der
Finger, abgeteilt sind; jedes dieser Glieder entspricht einer Reihe Haarzellen
(ko Fig. 75,
de4 und f1f5
Fig. 76). Die äußeren
Haarzellen sind übrigens nur in der Schnecke der Säugetiere zu
finden: man zählt deren vier bis fünf Reihen beim Menschen (Fig.
76), drei bei den übrigen Säugetieren (Fig.
75). Alle hier genannten Epithelialgebilde,
eigentliche Epithelzellen, CORTI'sche Bogen und Haarzellen,
sind von einigen Membranen überkleidet, welche wahrscheinlich als
Ausscheidungsprodukte der Epithelzellen zu betrachten sind. Zunächst
werden nämlich die letzteren von einer netzförmig durchbrochenen
Lamelle (lamina reticularis) bedeckt, deren siebförmige Öffnungen
namentlich die Köpfe der Haarzellen in sich aufnehmen, so daß
nur die Cilien über sie vorragen (c u. q Fig.
75, e1e4
Fig. 76). Darüber
kommt dann eine zarte Membran, die so genannte Deckmembran, welche
alle andern Teile überkleidet. Die Hörnervenfasern treten zunächst
in die Spindel der Schnecke ein, durchsetzen hier kleine Ganglien (N
Fig. 74), um dann
durch die in regelmäßiger Anordnung neben einander gelegenen
Löcher der crista spiralis zum CORTI'schen Organ
zu treten. Zwischen diesen Löchern der crista liegen die oben erwähnten
Gehörzähnchen; in Fig.
74 ist eines derselben auf dem Durchschnitt (Cr), in
Fig. 75 (A) sind sie auf der Fläche zu sehen. Unmittelbar
nach ihrem Austritt aus der crista spiralis durchsetzen die Nervenfasern
ein Lager kleiner rundlicher Zellen, welche vielleicht die Bedeutung von
Ganglienzellen besitzen, analog den Körnern der Retina, ihre letzten
mit Sicherheit zu verfolgenden Ausläufer hängen dann mit der
Reihe der inneren Haarzellen zusammen. Übrigens ist eine ähnliche
Verbindung mit den äußeren Haarzellen um so weniger zu bezweifeln,
als an denselben deutliche Nervenfortsätze getroffen werden und einzelne
Nervenfasern sich bis in ihre Nähe verfolgen lassen8).
6) Politzer, Sitzungsberichte der Wiener Akademie 1861. S. 427.
7) Die nähere Betrachtung der schallzuleitenden Apparate des Gehörorgans und ihrer physiologischen Bedeutung würde uns für den gegenwärtigen Zweck zu weit führen. Ich verweise den Leser in dieser Beziehung auf das Werk von HELMHOLTZ, Lehre von den Tonempfindungen 3te Aufl. S. 198 f. so wie auf den kurzen Abriß in meinem Lehrbuch der Physiologie, 3te Aufl S. 658, 661.
8) Vergl. W. Waldeyer, Hörnerv und Schnecke in Stricker's Gewebelehre, S. 915 und die ebend. S. 961 angeführte Literatur.
Über die physiologische Bedeutung der das CORTI'sche Organ zusammensetzenden Teile lassen sich erst jetzt, nachdem die Haarzellen als die wirklichen Endgebilde der Nervenfasern nachgewiesen sind, einigermaßen begründete Vermutungen aufstellen. Solche müssen zunächst von der physiologischen Tatsache ausgehen, daß der Gehörssinn ein analysierender Sinn ist. Wir zerlegen unmittelbar in unserm Gehör eine Klangmasse, falls dieselbe nicht allzu zusammengesetzt ist, in ihre einzelnen Bestandteile. Hieraus läßt sich schließen, daß jeder dieser Bestandteile ein besonderes Endorgan in unserm Ohr in Erregung versetzt, so daß wir eine zusammengesetzte Erregung unmittelbar als eine gewisse Summe einfacher Erregungen empfinden. helmholtz hat diese hervorragende Eigenschaft unseres Gehörssinnes aus der Mechanik des Mittönens abgeleitet9). Wenn wir bei aufgehobenem Dämpfer gegen den Resonanzboden eines Klaviers singen, so geraten diejenigen Saiten in Mitschwingung, deren Töne in dem gesungenen Klang als Bestandteile enthalten sind. Dächten wir uns also jede Saite empfindend, so würde das Klavier eine ähnliche Klanganalyse ausführen, wie sie in unserm Ohr stattfindet. Demnach nimmt man an, die den einzelnen Fasern des Hörnerven anhängenden Endgebilde seien in der Weise verschieden abgestimmt, daß jeder einfache Ton immer nur bestimmte Nervenfasern in Erregung versetze. Man hat früher in den CORTI'schen Bogen solche abgestimmte Endapparate vermutet10). Nachdem nachgewiesen ist, daß die CORTI'schen Bogen gar nicht direkt mit Nervenfasern zusammenhängen, und daß dieselben überdies in der Schnecke der Vögel und Amphibien ganz fehlen11), läßt sich diese Ansicht nicht mehr aufrecht erhalten. Von den Haarzellen, den wirklichen Endgebilden der Nervenfasern, läßt sich aber wegen ihrer außerordentlich geringen Masse nicht annehmen, daß sie nur durch bestimmte Töne erregbar seien. Vielmehr werden die Cilien, sobald das Labyrinthwasser durch Schallschwingungen in Bewegung gerät, dieser Bewegung folgen: es werden daher, wenn ein einfacher Ton in das Ohr dringt, alle Cilien in der entsprechenden Periode mitschwingen, eine zusammengesetzte Klangmasse dagegen wird dieselben in eine zusammengesetzte Schwingungsbewegung versetzen. Die Gehörsreizung, so weit sie durch die Haarzellen allein vermittelt wird, muß also bei verschiedenen Klängen qualitativ verschiedene Empfindungen bewirken, aber zu einer Analyse derselben in ihre einfachen Bestandteile liegt keinerlei Grund vor. Diese kann demnach nicht durch die Nervenendigungen selbst sondern nur durch die in der Umgebung derselben auftretenden Teile zu Stande kommen. Die letzteren zeigen aber allein in der Schnecke eine solche Beschaffenheit, daß eine Anpassung an verschiedene Tonhöhen möglich ist, und zwar liegt es am nächsten hier an die Grundmembran zu denken, die, worauf HENSEN12) zuerst aufmerksam machte, an ihren verschiedenen Stellen eine hinreichend verschiedene Breite besitzt, um eine Abstufung ihrer Abstimmung für alle dem menschlichen Ohr zugänglichen Tonhöhen annehmen zu lassen. Indem nämlich die Breite des Schneckenkanals sich von der Basis gegen die Spitze der Schnecke hin immer mehr verkleinert, nimmt gleichzeitig die Grundmembran in ihrem Querdurchmesser ab. Die einzelnen Teile derselben müssen sich also, da die Spannung der Membran in ihrer Länge verschwindend klein gegen die quere Spannung zu sein scheint, wie Saiten von verschiedener Länge verhalten, indem die breiteren Teile auf tiefere, die schmäleren auf höhere Töne abgestimmt sind. Zweifelhafter ist die Rolle der CORTI'schen Bogen. Vielleicht sind sie, ähnlich den Otolithen in den Vorhofssäckchen, zur Dämpfung der Schwingungen bestimmt, wozu sie bei ihrer bedeutenden Festigkeit wohl geeignet scheinen13). Hierfür spricht wohl der Umstand, daß in der Schnecke der Vögel, wo die Bogen fehlen, Otolithen gefunden werden. Auch ist zweifellos, daß im Ohr sehr wirksame Dämpfungsvorrichtungen existieren, da die Klangempfindung den objektiven Klang eine kaum merkliche Zeit überdauert. Die Schwingungen der Grundmembran müssen aber auf die Hörnervenfasern an der Stelle, wo dieselben aus den einzelnen Löchern der crista spiralis zu ihr hintreten, unmittelbar einwirken. Den Mechanismus der Acusticusreizung in der Schnecke haben wir uns demnach wahrscheinlich folgendermaßen zu denken. Zunächst werden durch die dem Labyrinthwasser mitgeteilten Schallbewegungen die Cilien der Haarzellen in Schwingungen versetzt, die im allgemeinen zusammengesetzter Natur sind, indem jede Cilie bei der Leichtigkeit, mit der sie den Bewegungen zu folgen vermag, die Form der Schwingungskurve treu wiederholt, ähnlich wie dies auch von den Hörhaaren in den Ampullen vorauszusetzen ist. Durch jeden Schall, mag er einfach oder zusammengesetzt sein, aus tieferen oder höheren Teiltönen bestehen, werden also auch alle schwingungsfähigen Cilien in Bewegung gesetzt werden, nur die Form dieser Bewegung wird je nach der Beschaffenheit des Schalls eine verschiedene sein, indem sich dieselbe den Bewegungen des Labyrinthwassers jeweils genau accommodiert. So lange das Gehörorgan diese Stufe der Entwicklung nicht überschreitet, was bei allen denjenigen Tieren der Fall ist, bei denen keine Schnecke existiert, werden sich wohl die Gehörsempfindungen auf einer ähnlichen Stufe befinden, auf welcher wir bei uns selbst die Geruchs- und Geschmacksempfindungen antreffen. Mit der Form der Schallbewegung wird die Qualität der Empfindung sich ändern, aber jene Analyse, wie sie das menschliche Ohr ausführt, und die hierauf begründete eigentümliche Ordnung der Schallempfindungen wird mangeln. Beim Menschen und bei denjenigen Tieren, die gleich ihm eine ausgebildete Schnecke besitzen, wird dagegen der auf einen gewissen Ton abgestimmte Teil der Grundmembran von seinen Hörhaaren aus nur dann in merkliche Mitschwingungen versetzt werden, wenn der Eigenton des Membranabschnitts ein Bestandteil des gehörten Klanges ist. Durch die stark schwingenden Teile der Grundmembran können dann unmittelbar die ihnen anliegenden Acusticusfasern so gereizt werden, daß sie in der Zeiteinheit eine der Schwingungszahl des betreffenden Tones entsprechende Zahl von Stößen empfangen. Es ist möglich, daß die Netzmembran, durch deren Löcher die Cilien der Haarzellen hervorragen, zu dieser Miterregung der Grundmembran in Beziehung steht. Der Effekt eines jeden Schalleindrucks ist demnach wahrscheinlich ein zusammengesetzter. Zunächst wird die Gesamtmasse der Nervenendgebilde in eine Bewegung versetzt, welche der ungetrennten Form des äußern Eindrucks entspricht, sodann aber teilen außerdem einzelnen Nervenfasern des Acusticus Bewegungen von einfacherer Form sich mit, indem die abgestimmten Teile der Grundmembran aus jener zusammengesetzten Gesamtbewegung der Nervenendgebilde einzelne einfache Bestandteile gewissermaßen aussondern und dieselben auf die Nervenfasern direkt übertragen. Es gibt entschieden Gehörorgane, bei denen nur die erste Form zusammengesetzter Reizung möglich ist; es gibt aber keine, bei denen die zweite, die zerlegende Wirkung, ohne die erste zu finden wäre, vielmehr ist sie immer nur eine in verschiedenen Fällen offenbar in sehr verschiedenem Maße entwickelte Begleiterscheinung jener allgemeinsten Form der Schallreizung. Diese vervollkommnete Form der Gehörorgane hat sich daher wohl aus der ersten unvollkommenen Form allmälig entwickelt. Aus diesem Grunde ist es aber auch streng genommen unrichtig, wenn wir dem Ohr des Menschen und der ihm verwandten Tiere ohne weiteres die Eigenschaft zuschreiben, zusammengesetzte Klangmassen unmittelbar in ihren einzelnen Bestandteilen zu empfinden. Jener Vergleich des Ohres mit einem Klavier, dessen einzelne Saiten mit Nervenfasern versehen wären, ist nicht ganz zutreffend, weil im Gehörorgane erst sekundär gewisse abgestimmte Teile einfache Formen der Erregung bewirken, während zunächst der zusammengesetzte Reiz auch die einzelnen Endgebilde in eine komplexe Form der Erregung versetzt. Jedes Gehörorgan empfindet jede, auch die zusammengesetzte Form der Reizung als eine zunächst unteilbare Qualität. Aber durch die accessorischen Gebilde, welche in der Schnecke zu den eigentlichen Endorganen der Nerven hinzutreten, werden die höher entwickelten Gehörorgane befähigt bis zu einem gewissen Grad eine Analyse der Schallqualitäten auszuführen.
9) Helmholtz, Lehre von den Tonempfindungen. 3te Aufl. S. 219 f.
10) Helmholtz in den zwei ersten Ausgaben seiner Lehre von den Tonempfindungen. In der dritten (S. 229) hat er sich der HENSEN'schen Hypothese angeschlossen, daß die Grundmembran je nach der verschiedenen Breite ihrer Abschnitte auf verschiedene Töne abgestimmt sei. Siehe unten.
11) Hasse, Ztschr. f. wissensch. Zoologie XVII, S. 56,
461. XVIII, S. 72, 359.
12) Zeitschr. f. wiss. Zoologie XIII S. 481.
13) Waldeyer a. a. O. S. 952. Eine andere Vermutung hat Helmholtz aufgestellt. Er glaubt, daß die CORTI'schen Bogen, als relativ feste Gebilde, bestimmt seien, die Schwingungen der Grundmembran auf eng abgegrenzte Bezirke des Nervenwulstes zu übertragen. (Tonempflndungen, 3te Aufl., S. 229.)
Die bisher betrachteten Sinnesorgane bieten bei aller Strukturverschiedenheit insofern eine gewisse Analogie dar, als die nächsten Endgebilde der Nerven mehr oder minder veränderte Epithelialzellen mit stäbchen- oder haarförmigen Anhängen sind, welche als Angriffspunkte äußerer Bewegungen besonders geeignet erscheinen. Wesentlich anders verhält sich die Nervenendigung im Auge. Zwar als metamorphosierte Epithelialzellen sind auch hier die Endorgane der Nervenfasern, die Stäbchen und Zapfen der Netzhaut, ohne Zweifel anzusehen, aber sowohl die Formbeschaffenheit dieser Zellen wie die Art ihres Zusammenhangs mit den Opticusfasern verhält sich durchaus eigentümlich. Die letzteren, die schon im Opticusstamm der SCHWANNschen Primitivscheide entbehren, breiten sich von der Eintrittsstelle des Sehnerven an strahlenförmig über die ganze Innenfläche der Netzhaut aus. Aller Orten beugen dann Opticusfasern nach außen sich um und treten in große Ganglienzellen ein, welche von innen nach außen gezählt die zweite Hauptschicht der Netzhaut ausmachen (3 Fig. 77). Jede dieser Ganglienzellen entsendet nach außen mehrere sich teilende Fortsätze, die in eine dritte ziemlich breite Schichte, welche großenteils aus feinen Körnern besteht, hineinragen (4). Auf sie folgt eine Schichte kleiner Zellen (5), dann nochmals ein schmaler Saum aus feinkörniger Masse (6). In diesem pflegt der von der Ganglienzellenschichte bis hierher meist verloren gegangene Faserzusammenhang wieder sichtbar zu werden: es werden nämlich nun in verschiedener Höhe feine oder breitere Fasern durch Zellen oder Körner unterbrochen (7), um auf der anderen Seite in die den äußeren Umfang der Retina einnehmenden Terminalgebilde, die Stäbchen und Zapfen, überzugehen (9). Die mit den Zapfen zusammenhängenden Körner sitzen diesen Endgebilden unmittelbar auf, sie bilden darum den äußern Saum der ganzen Körnerschichte (8); die Körner der Stäbchen dagegen sind von den letzteren durch einen feinen Zwischenfaden von wechselnder Länge getrennt, daher die Stäbchenkörner den größeren inneren Teil der Schichte einnehmen (7). Der nach innen gegen die Opticusschichte gerichtete Fortsatz der Zapfenkörner ist breit, er besteht augenscheinlich aus einer größeren Zahl von Fasern, der Fortsatz der Stäbchenkörner ist sehr schmal, er besteht vielleicht nur aus einer einzigen Primitivfibrille. Den ganzen Zusammenhang des Sehnerven mit seinen Endgebilden haben wir demnach folgendermaßen uns vorzustellen (Fig. 78): die Opticusfasern (2) treten zunächst in Ganglienzellen ein (3), aus diesen treten nach außen neue Fasern hervor, die erstens durch die Zellen der inneren Körnerschichte (5), dann durch die Zellen der äußeren Körnerschichte (7) unterbrochen werden, worauf sie in den Stäbchen und Zapfen endigen (9), und zwar so, daß jedem Zapfen eine Mehrzahl von Primitivfibrillen, jedem Stäbchen aber vielleicht nur eine einzige entspricht. Übrigens ist es zweifelhaft, ob alle Zellen der beiden Körnerschichten in den Verlauf von Opticusfasern eingeschaltet und demnach zu den Nervenzellen zu rechnen sind; manche mögen dem bindegewebigen Gerüste zugehören, welches als Kittmittel der nervösen Bestandteile die ganze Netzhaut durchzieht und in den beiden Grenzmembranen, der innern und äußern (1, 8 Fig. 77), sich flächenhaft ausbreitet14).
14) Vgl. M. SCHULTZE in seinem Archiv f. mikr. Anatomie II, S. 165, 175. III, S. 215, 404. V, S. 1, 379. VII, S. 244, und in StrickeR's Gewebelehre S. 977 f.
Physiologische Tatsachen zeigen, daß nur die Stäbchen und Zapfen, nicht aber die Opticusfasern oder Ganglienzellen der Retina durch Licht reizbar sind. Die Eintrittsstelle des Sehnerven, wo die Stäbchen und Zapfen fehlen, ist nämlich unerregbar für Lichtreize. Sie bildet den blinden oder Mariotte'schen Fleck15). Ferner können wir bei geeigneter, namentlich schräger Beleuchtung des Auges den Schatten unserer eigenen Netzhautgefäße als nach außen versetzte Gefäßfigur wahrnehmen. Dies beweist, daß die durch Licht reizbaren Teile in den tieferen Schichten der Retina liegen16). Stäbchen und Zapfen sind analog geformte Gebilde. Jedes derselben besteht aus einem innen- und einem Außengliede, die sich leicht durch eine Querlinie von einander trennen. Innen- und Außenglied der Stäbchen sind beide zylindrisch geformt. Das breite Innenglied der Zapfen hat eine spindelförmige, das weit kürzere und schmälere Außenglied eine kegelförmige Gestalt. Beide Endgebilde zeigen zuweilen schon im frischen, immer aber im macerirten Zustande Andeutungen einer feineren Struktur. Zunächst nämlich bemerkt man sowohl an den Innen- wie an den Außengliedern häufig eine feine Längsstreifung, welche auf eine fibrilläre Beschaffenheit hinzuweisen scheint (Fig. 79 a). Außerdem ist an den Außengliedern eine Querstreifung zu erkennen, nach welcher jedes derselben aus einer Reihe sehr dünner Plättchen zusammengesetzt scheint (bf ebend.). Diese Plättchen sind an den Zapfen etwas dicker als an den Stäbchen. Die Plattensätze der Außenglieder sind nun die Teile, welche zuletzt die Lichtstrahlen auffangen, nachdem dieselben durch die brechenden Medien des Auges und die durchsichtigen Schichten der Netzhaut selber gedrungen sind, denn nach außen werden die Stäbchen und Zapfen von einer schwarzen Pigmentschichte überzogen, die alles Licht, das etwa durch diese Elemente gegangen ist, absorbieren muß (10 Fig. 77). Nun läßt aber die Querstreifung der Außenglieder eine doppelte Deutung zu. Entweder kann man annehmen, dieselbe rühre von über einander geschichteten Plättchen aus stärker brechender Substanz her, welche durch ein schwächer brechendes Medium mit einander verbunden sind, oder man kann sie darauf beziehen, daß das Brechungsvermögen von innen nach außen schichtenweise zunimmt. In beiden Fällen wird natürlich das einfallende Licht an den einzelnen Grenzflächen zurückgeworfen, so daß das ganze Außenglied als ein katoptrischer Apparat angesehen werden muß, welcher das einfallende Licht wieder auf die in den Innengliedern enthaltenen Endfibrillen des Sehnerven zurückwirft. Betrachtet man die Innenglieder als die lichtempfindenden Elemente, was, da sich die Endfibrillen des Sehnerven direkt in dieselben fortsetzen, viele Wahrscheinlichkeit für sich hat, so wird bei der geringen Entfernung zwischen Außen- und Innengliedern das reflektierte Licht immer innerhalb desjenigen Elementes, durch das es eingetreten ist, verbleiben. Jedes Element wird also gewissermaßen doppelt gereizt werden: einmal durch das direkt einfallende und sodann durch das von den Außengliedern her reflektierte Licht. Das Außenglied, welches morphologisch eine Art Cuticularbildung zu dem der eigentlichen Epithelzelle äquivalenten Innengliede darzustellen scheint, wäre demnach physiologisch als eine Vorrichtung zu betrachten, welche bestimmt ist, alles überhaupt eingetretene Licht für die im Innenglied stattfindende Lichtreizung zu sammeln. Wir vermögen nicht anzugeben, durch welche Bedingungen die im Opticusstamm und in der vordersten Netzhautschichte noch unempfindlichen Sehnervenfasern in den Innengliedern ihre Lichtreizbarkeit gewinnen. Man kann nur vermuten, daß einesteils und vorzugsweise die Interpolation größerer und kleinerer Nervenzellen in der Ganglienschichte und in den beiden Körnerschichten, anderenteils aber auch. die vermittelst der reflektierenden Außenglieder bewirkte Verstärkung des Reizes hier von wesentlicher Bedeutung sei.
15) Über die Erscheinungen desselben vgl. mein Lehrb. der Physiologie, 3te Aufl., S. 600
16) H. Müller, über die entoptische Wahrnehmung der Netzhautgefäße, Verhandlungen der Würzburger phys.-med. Ges. V. 1854. S. 411. Wieder abgedruckt in H, MÜLLER's Schriften zur Anatomie und Physiologie des Auges. Leipzig, 1872, S. 27 f.
Unsere Lichtempfindung ist stets eine qualitativ ungeschiedene. Wir sind zwar im Stande zu entscheiden, ob verschiedene Lichteindrücke sich qualitativ mehr oder weniger ähnlich sind, nicht aber ob die Eindrücke qualitativ einfach oder zusammengesetzt seien. Einer Analyse des Reizes, wie sie das Gehörorgan ausführt, ist das Auge nicht fähig. Wir müssen es daher als ein irrtümliches Bestreben betrachten, wenn eine beim Gehörssinn berechtigte Auffassung auf den Gesichtssinn übertragen wird, indem man im Auge verschiedene Vorrichtungen für verschiedene einfache Empfindungsqualitäten voraussetzt. Auf eine derartige Annahme ist aber die Hypothese thomas YOUNG's gegründet, nach welcher in der Netzhaut gewisse qualitativ verschiedene Empfindungen, nämlich diejenigen der drei so genannten Grundfarben, an verschiedene Nervenfasern gebunden sein sollen17). Das menschliche Auge führt eine Analyse der Lichtempfindungen tatsächlich nicht aus. Die Hypothese, daß eine solche Zerlegung durch Endgebilde, welche nur für bestimmte qualitative Lichtreizungen zugänglich seien, dennoch stattfinde, steht daher im Widerspruch mit den Tatsachen. Die physiologischen Erscheinungen führen zunächst nur zu der Voraussetzung, daß in jedem der mosaikähnlich angeordneten Endgebilde der innere Reizungsvorgang im allgemeinen mit der Form der äußeren Reizung wechselt. Allerdings ist aber aus Erscheinungen, die wir unten kennen lernen werden, zu schließen, daß nicht jede Änderung des äußern Reizes eine entsprechende Veränderung der innern Reizungsvorgänge herbeiführt, indem objektiv verschiedenartige Lichteindrücke qualitativ gleiche Empfindungen und demnach auch, wie wir vermuten dürfen, übereinstimmende Formen der inneren Reizung oder des Nervenprozesses vorursachen können. Aus dieser Tatsache läßt sich aber nichts weiteres schließen, als daß das Licht innerhalb der Opticusfasern in eine Form der Bewegung sich umsetzt, welche nur innerhalb gewisser näher zu bestimmender Grenzen mit der Geschwindigkeit der Lichtschwingungen wechselt.
17) Thomas YOUNG, lectures on natural philosophy. London 1807. HELMHOLTZ, physiologische Optik S. 291. Historisch ist allerdings die Hypothese von der verschiedenartigen Funktion verschiedener Nervenfasern nicht vom Gehör auf das Gesicht sondern umgekehrt vom Gesicht auf das Gehör übertragen worden, indem Helmholtz, der in Bezug auf die Tonempfindungen zuerst diese Ansicht entwickelte, dieselbe ausdrücklich an die YOUNG'sche Hypothese über die Gesichtsempfindungen anknüpfte (Tonempfindungen, 3te Aufl., S. 232). Ferner ist es in historischer Hinsicht beachtenswert, dass YOUNG seine Hypothese ursprünglich nicht, wie gewöhnlich angenommen wird, unmittelbar auf die Existenz der drei so genannten Grundfarben stützte, sondern daß er dabei von der Vorstellung ausging, das Licht bringe in der Netzhaut eine vibrierende Bewegung hervor, deren Geschwindigkeit von der Beschaffenheit der vibrierenden Teilchen abhänge. Man könne sich nun, meint YOUNG, kaum als möglich denken, daß jeder empfindende Punkt der Netzhaut eine unendliche Menge von Teilchen enthalte, deren jedem eine andere Vibrationsgeschwindigkeit entspreche: es sei also notwendig eine kleine Zahl, z. B. solche, die den drei Grundfarben korrespondieren, vorauszusetzen, und anzunehmen, daß jedes durch Lichtwellen aller Größen, aber je nach der Annäherung an seine eigene Vibrationsgeschwindigkeit in verschiedenem Grade, in Bewegung gesetzt werde. (Phil. transact. for 1802. GILBERT'S Annalen der Physik. 1811. Bd. 39. S. 166.) Selbstverständlich fällt dieses ursprüngliche Motiv der YOUNG'schen Hypothese heute für uns ganz hinweg, da die Annahme, die Netzhauterregung bestehe in einem den Lichtwellen entsprechenden Schwingungsvorgang, aus Gründen, die weiter unten entwickelt sind, vollständig verlassen ist.
Schon Hannover und Brücke haben die Vermutung ausgesprochen, die Stäbchen und Zapfen der Retina seien katoptrische Gebilde, dazu bestimmt, das auf sie treffende Licht wieder auf die lichtempfindenden Elemente zurückzuwerfen18). Aber zu jener Zeit galt noch die Sehnervenschichte für lichtempfindend. In dieser Form war daher die Hypothese dem Einwande ausgesetzt, es müsse das reflektierte Licht verschiedenartige Nervenelemente treffen und so eine Konfusion der Empfindungen verursachen. Zudem wurde sie durch den Nachweis der Unempfindlichkeit der Sehnervenschichte für Lichtreize sowie durch die Versuche H. müller's, die auf die Stäbchen- und Zapfenschichte als den Ort der Lichtempfindung hinwiesen, widerlegt. Doch läßt sich nach den Beobachtungen des letzteren die Frage, ob die Außen- oder Innenglieder oder beide die lichtperzipierenden Elemente seien, nicht entscheiden19). Im allgemeinen aber wird vorauszusetzen sein, daß, wenn die Außenglieder auf nach innen gelegene perzipierende Teile Licht wieder zurückwerfen, dadurch eine Verstärkung der Reizwirkung zu Stande kommen kann, ohne daß die räumliche Ordnung der Empfindungen gestört zu werden braucht. Da nämlich das Licht nahezu rechtwinkelig auf die Retina auffällt, so wird bei der regelmäßigen Anordnung der Stäbchen- und Zapfenschichte das von einem Außenglied reflektierte Licht wieder zu dem ihm entsprechenden Innengliede gelangen. Die Ansicht, daß die Außenglieder wesentlich eine katoptrische Funktion haben, scheint außerdem durch die von Max Schultze entdeckte Plättchenstruktur derselben gestützt zu werden, obgleich neuerdings Schultze selbst mit W. Zenker dieser eine durchaus andere Bedeutung zuschreibt, indem er sie mit der Young-HELMHOLTZ'schen Theorie der Lichtperzeption in Zusammenhang bringt20). ZENKER geht bei seiner Hypothese von den Interferenzerscheinungen aus, welche bei der Brechung und Reflexion durch dünne Plättchen beobachtet werden. Nehmen wir an, je zwei Plättchen seien durch eine schwächer brechende Schichte, die wir als unendlich dünn betrachten wollen, von einander getrennt, und denken wir uns nun, ein Strahlenbüschel a a' (Fig. 80) falle auf ein innerstes Plättchen 1 auf, so wird jeder Strahl ab, a'b' in einen unter gleichem Winkel reflektierten Strahl bc, b'c' und in einen nach dem Einfallslot gebrochenen Strahl bd, b'd' sich spalten. Jeder der letzteren wird aber in ähnlicher Weise wieder an der Oberfläche des zweiten Plättchens in einen reflektierten und in einen gebrochenen Strahl zerlegt werden, und es ist sogleich klar, daß bei einer gewissen Dicke des Plattensatzes der schließlich übrig bleibende gebrochene Anteil des einfallenden Lichtes verschwindend klein ist gegen denjenigen, welcher durch Reflexion an der Oberfläche der einzelnen Plättchen wieder nach außen zurückkehrt. Besitzt daher das Medium eine sehr vollkommene Durchsichtigkeit, so daß wenig Licht durch Absorption in demselben verloren geht, so wird nahezu alles eingedrungene Licht in Folge der wiederholten Reflexionen wieder zurückgeworfen. Indem dann aber das zurückkehrende Licht zum Teil nochmals an den Grenzflächen der Plättchen zurückgeworfen wird, werden zugleich stehende Wellen entstehen können, ähnlich wie sie ein zwischen zwei festen Punkten ausgespanntes Seil zeigt, das man in Schwingungen versetzt hat. Es ist, wenn solche stehende Lichtwellen sich bilden sollen, nur die Voraussetzung nötig, daß das Licht nach der Reflexion in den nämlichen Ebenen schwingt wie vorher, eine Voraussetzung, die wenigstens für einen Teil des zurückgeworfenen Lichtes zutreffend zu sein scheint21). Nimmt man nun an, daß der größte Teil des eingefallenen Lichtes wieder nach den Außengliedern reflektiert werde, so führt dies zu der Ansicht, welche wir oben vertreten haben, wonach die Außenglieder katoptrische Apparate und die Innenglieder die lichtperzipierenden Elemente sind. Nimmt man dagegen an, der größte Teil des Lichtes verschwinde in den Außengliedern, indem er in denselben stehende Wellen bilde, so wird man mit ZENKER die Außenglieder als den Sitz der Lichtperzeption betrachten müssen. Als anatomischen Grund hat man für die letztere Ansicht noch speziell die Struktur der Retina bei den Cephalopoden und Heteropoden angeführt22). Das Auge dieser Mollusken gleicht nämlich in seinem Bau dem Wirbeltierauge, es besteht aber die innerste, nicht die äußerste Lage seiner Netzhaut aus stäbchenförmigen Gebilden, an welche von außen die Opticusfasern herantreten. Hieraus läßt sich zunächst jedoch nur folgern, daß Teilen, die im Auge der Wirbeltiere wahrscheinlich eine katoptrische Wirkung haben, hier jedenfalls eine dioptrische zukommt, so daß sie dieselbe Funktion besitzen, wie die vor ihnen gelegenen brechenden Medien, Linse und Glaskörper, mit denen sie sich auch nach HENSEN als Einstülpungen der äußeren Haut entwickeln, während die Stäbchen und Zapfen bei den Wirbeltieren als Wachstumsprodukte des Gehirns, nämlich der primitiven Augenblase, entstehen.
18) HANNOVER, Müller's Archiv 1840. S. 326. Brücke, ebend. 1844. S. 444,
19) Nach H. Müller (Ges. Abhandlungen I, S. 48) liegen am gelben Fleck die Zapfen 0,20,3 Mm. von den Netzhautgefäßen entfernt, und aus der Bewegung des entoptischen Schattens der Netzhautgefäße, wenn ein Licht vor dem Auge hin- und herbewegt wird, berechnet sich ihre Entfernung von der lichtperzipierenden Schichte zu 0,170,32 Mm. Wenn hiernach beide Zahlwerte ungefähr übereinkommen, so läßt sich doch nicht sagen, daß Müller's Versuche auf einen bestimmten Teil der Stäbchen- und Zapfenschichte hinweisen.
20) W. Zenker, Archiv f. mikr. Anat. III, S. 248.
21) Zenker a. a. O. S. 254.
22) Hensen, Arch. f. mikr. Anat. II, S. 399.
Läßt man mit ZENKER den größten Teil des in die Außenglieder gelangten Lichtes hier in Folge wiederholter Reflexion an den Grenzflächen der Plättchen stehende Wellen bilden, so führt dies zugleich zu einer Hypothese über die Entstehung der Farbenempfindungen, welche sich unmittelbar der YOUNG'schen Theorie anschließt. Verfolgt man nämlich den Weg der an den einzelnen Grenzflächen reflektierten Strahlen, so muß nach den allgemeinen Gesetzen der Brechung der bei d reflektierte Strahl db' bei seinem Übergang in das vor 1 gelegene dünnere Medium um ebenso viel vom Einfallslot weg gebrochen werden, als er bei seiner ersten Brechung bei b demselben genähert wurde. Der erst bei 2 reflektierte Teil bd des Strahls ab wird daher nur in Bezug auf seine Austrittsstelle verschoben, nimmt aber dieselbe Richtung an wie der sogleich reflektierte Teil bc desselben Strahls, er muß sonach mit irgend einem andern an der Oberfläche von 1 reflektierten Strahl des parallelen Strahlenbüschels, z. B. mit b'c', zusammenfallen und denselben verstärken. Dabei ist vorauszusetzen, daß die Verschiebung des reflektierten gegen den einfallenden Lichtstrahl, da der letztere sehr nahe mit dem Einfallslot zusammenfällt, außerordentlich gering ist. Dieselbe Betrachtung wird auf die in den tieferen Teilen des Plattensatzes reflektierten Strahlen Anwendung finden, d. h. es wird allgemein ein paralleles Strahlenbüschel auch wieder als solches unter gleichem Winkel reflektiert werden. Nach den allgemeinen Gesetzen der Wellenreflexion wird nun ein an der Grenze eines dichteren Mediums anlangender Wellenberg wieder als Wellenberg, ein an der Grenze eines dünneren Mediums anlangender Wellenberg aber als Wellental zurückgeworfen. Ebenso kehrt ein Wellental von der Grenze des dichteren Mediums wieder als Wellental, von der Grenze des dünneren als Wellenberg zurück. Allgemein also können wir sagen: Die Schwingungsphase bleibt ungeändert, wenn die Reflexion beim Übergang aus einem dünneren in ein dichteres Medium stattfindet, die Schwingungsphase kehrt sich dagegen um, wenn die Reflexion beim Übergang in ein dünneres Medium erfolgt. So werden z. B. die bei b, b reflektierten Strahlen mit ungeänderter Phase zurückgeworfen, der Strahl bd aber wird um eine halbe Wellenlänge verzögert. Wäre also die Dicke der Platte 1 verschwindend klein, so würde der Strahl b'c' aus zwei Wellenzügen bestehen, einer bei b' reflektierten mit ungeänderter Phase und einer bei d reflektierten mit um eine halbe Wellenlänge verschobener Phase: es würden daher bei b' ein Wellenberg und ein Wellental zusammentreffen, die sich durch Interferenz ganz oder teilweise aufheben. Dies ändert sich, wenn die Plättchen eine Dicke haben, welche gegen die Wellenlänge des Lichtes nicht verschwindet, ein Verhalten, das für die Platten der Stäbchen und Zapfen jedenfalls vorausgesetzt werden muß, da die Dicke derselben durchschnittlich 0,0030,004 Mm. beträgt, die Länge der Lichtwellen aber (0,00040,0007 Mm.) den zehnten Teil dieser Größe teils eben erreicht teils wenig überschreitet. Nehmen wir nun z. B. an, der Weg b d b' oder, was demselben nahehin gleich gesetzt werden kann, die doppelte Dicke der Platte sei ein gerades Vielfaches einer halben Wellenlänge, so wird der Strahl d b' bei b' dieselbe Phase haben wie der unmittelbar bei b' reflektierte Strahl, die Wellen werden sich also jetzt verstärken. Ist dagegen die doppelte Dicke der Platte ein ungerades Vielfache einer halben Wellenlange, so wird wieder ungleiche Phase, also Schwächung durch Interferenz vorhanden sein. Da nun in dem gemischten Licht Schwingungen von verschiedener Wellenlänge vorkommen, so können bestimmte Schwingungen verstärkt, andere geschwächt werden. Dies ist die Ursache, weshalb dünne Platten, wenn sie von genau gleicher Dicke sind, einfarbig, und wenn sie von ungleicher Dicke sind, in verschiedenen Farben erscheinen. ZENKER hat nun, auf diese Erscheinungen gestützt, vermutet, die Plättchenstruktur der Außenglieder sei dazu bestimmt das Licht in ähnlicher Weise zu analysieren, wie in unserm Ohr durch die verschiedene Breite der Grundmembran eine Analyse des Klangs möglich ist. Denken wir uns nämlich, die Dicke der Plattensätze sei eine veränderliche oder, was auf dasselbe hinauskommt, der Brechungsindex derselben sei ein etwas wechselnder, so könnte in bestimmten Plattensätzen Licht von bestimmter Wellenlänge verstärkt, anderes geschwächt werden. Hätte man z. B. dreierlei Plattensätze, die innerhalb jedes einzelnen Stäbchens und Zapfens vereinigt angenommen werden müßten, und von denen durch den ersten die brechbarsten (violetten), durch den zweiten die wenigst brechbaren (roten) Strahlen und durch den dritten solche von mittlerer Brechbarkeit (grüne) verstärkt würden, so hätte man damit offenbar eine Einrichtung, welche dem unten zu erwähnenden Gesetz, daß wir alle Lichtempfindungen aus drei Grundempfindungen zusammensetzen können, einigermaßen entspräche. Aber diese Annahme begegnet vorerst noch mehreren Bedenken. Erstens lassen sich Unterschiede in der Plättchendicke nicht nachweisen, ausgenommen solche zwischen den Außengliedern der Zapfen und Stäbchen, die aber gerade vom Standpunkt der Annahme einer derartigen Lichtzerlegung aus ganz unerklärlich sein würden; ebenso ist es sehr zweifelhaft, ob in dem Brechungsvermögen der einzelnen Teile eines Stäbchens oder Zapfens konstante Unterschiede dieser Art existieren23). Sodann bleibt es unverständlich, warum die Zapfen, die doch eine größere Zahl von Opticusfasern aufnehmen als die Stäbchen, mit kleineren Außengliedern als diese versehen sind (vergl. Fig. 79). Endlich aber müssen wir eine Analyse des Lichts durch perzipierende Elemente überhaupt leugnen, weil eine solche Analyse, ähnlich wie sie dem Ohr zu Gebote steht, im Auge gar nicht existiert. Wir empfinden den Eindruck des weißen Lichtes nicht als gemischt aus gewissen Grundfarben, es liegt daher auch gar kein Grund vor in diesem Fall gesonderte Endorgane vorauszusetzen, mag man nun unter diesen, wie einst th. YOUNG, spezifisch empfindende Nervenfasern oder aber, wie HELMHOLTZ und M. schultze, gesonderte Teile der Stäbchen- und Zapfenschichte verstehen24). Diese Hypothese macht den Fehler, daß sie mehr erklärt als sie soll. Wenn für das Auge verschiedene Reizformen in eine qualitativ untrennbare Empfindung zusammenfließen, so können wir hieraus mit demselben Rechte folgern, daß gesonderte Endorgane für diese Reizformen nicht existieren, wie wir beim Ohr wegen der hier tatsächlich bestehenden Fähigkeit der Analyse zusammengesetzter Empfindungen auf das Vorhandensein solcher gesonderter Vorrichtungen schließen. So scheint uns denn die Annahme wahrscheinlicher, daß die Außenglieder katoptrische Apparate sind, welche wesentlich die Bestimmung haben, alles Licht auf die in den Innengliedern in regelmäßiger Mosaik angeordneten Enden der Nervenfasern zu konzentrieren.
23) ZENKER schließt zwar aus der starken sphärischen Aberration, welche man an dem durch die Stäbchenschichte gebrochenen Lichte beobachtet, daß der Brechungsindex in der Achse der Außenglieder geringer sei als an der Mantelfläche (a. a. O. S. 259). Aber erstens ist es möglich, daß jene Erscheinung von dem die einzelnen Stäbchen umgebenden schwächer brechenden Medium herrührt, und zweitens gibt ZENKER gelbst zu, daß der Brechungsindex höchstens zwischen 1,5 und 1,333 variiert, während er bis auf 0,8 herabsinken müßte, wenn alle Farben des Spektrums stehende Wellen von gleicher Länge bilden sollten.
24) Zu der YOUNG'schen Ansicht müßte wieder zurückgegangen werden, wenn man einer Beobachtung hensen's (Zeitschr. f. wiss. Zoo). XV, S. 199), der in einem Fall aus einem Stäbchen der Cephalopodenretina drei Nervenfasern hervorkommen sah, eine Bedeutung beilegen wollte. Hinsichtlich der ganzen Frage hat aber natürlich eine vereinzelte Beobachtung dieser Art keine entscheidende Beweiskraft.
Da an den Stäbchen der katoptrische Apparat starker entwickelt ist als an den Zapfen, an diesen dagegen das lichtempfindende Innenglied sowie die eintretende Nervenfaser in eine größere Zahl feiner Endfibrillen zerfällt, so können wir vermuten, daß die ersteren Elemente gegen die unmittelbare Lichtreizung empfindlicher, die letzteren zur Vermittlung einer genauen räumlichen Auffassung geeigneter seien. Damit steht das Ergebnis der vergleichend anatomischen Untersuchungen im Einklang, wonach bei den nachtsehenden Säugetieren, Fledermaus, Igel, Maulwurf, die Netzhaut ausschließlich Stäbchen, bei den durch Schärfe des Sehens ausgezeichneten Vögeln und Reptilien aber vorzugsweise Zapfen enthält, mit Ausnahme der Nachtvögel, bei denen wiederum die Zahl der Stäbchen überhand nimmt. Auch beim Menschen und den Affen vermindern sich an der zum schärfsten Sehen bestimmten Stelle, am gelben Fleck, die Stäbchen, und die Mitte dieser Stelle führt nur Zapfen. Insofern die Stäbchen im Tierreich die verbreiteteren Elemente sind, werden sich wahrscheinlich die Zapfen aus denselben bei Vervollkommnung des Sehorganes entwickelt haben. Mit der Einrichtung dieser Apparate zu schärferer Auffassung mag dann die Verminderung ihrer Lichtempfindlichkeit zusammenhängen. Denn indem bei den Zapfen viel mehr lichtempfindende Elemente auf eine gegebene Fläche kommen, muß, falls die Lichtempfindlichkeit nicht auf Kosten der Schärfe des Sehens gesteigert sein soll, die intensive Wirkung des Eindrucks gemindert werden, wenn seine extensive Wirkung zunimmt25).
25) Vielleicht ist die physiologische Beobachtung, daß wir zuweilen im indirekten Sehen sehr schwache Lichteindrücke aufzufassen im Stande sind, die uns im direkten Sehen entgehen, ebenfalls auf die größere Empfindlichkeit der die Seitenteile der Netzhaut einnehmenden Stäbchenelemente zu beziehen.
Als Endorgane der Tastnerven pflegt man eigentümliche kolbenförmige Gebilde zu betrachten, welche an verschiedenen Stellen, teils in der eigentlichen Haut, teils in ihren Schleimhautfortsetzungen, teils im Unterhautbindegewebe gefunden werden und als Endkolben, Tastkörperchen und PACINI'sche Körper beschrieben sind. Alle drei stimmen darin überein, daß sie aus einer birnförmigen Kapsel aus fester Bindesubstanz bestehen, in welche eine oder mehrere Nervenfasern eintreten, um entweder im Innern oder an der Oberfläche derselben in einer noch nicht genau festgestellten Weise zu endigen (Fig. 81, Fig. 82 und Fig. 83). Alle diese morphologisch verwandten Gebilde können jedoch keinesfalls im selben Sinne wie die Stäbchen und Zapfen, die Haarzellen oder auch die Riech- und Geschmackszellen als Endorgane der sensibeln Nerven betrachtet werden. Dagegen spricht nämlich vor allem die Tatsache, daß es weite Strecken der Haut gibt, die der Tastempfindung durchaus nicht entbehren, wo aber keines jener Endgebilde nachgewiesen ist26). Hiernach sowie mit Rücksicht auf die Verbreitung derselben ist wohl anzunehmen, daß solche kolbenförmige Endgebilde nur dazu bestimmt sind die Tastempfindlichkeit gewisser Teile zu erhöhen, vielleicht indem sie polsterförmige Unterlagen für die Nerven gewähren und dieselben auf diese Weise schwachen Druckreizen zugänglicher machen. Wie aber die Nervenfasern selbst in der Haut endigen, ist bis jetzt nicht sicher festgestellt. Einige Beobachtungen machen es wahrscheinlich, daß die letzten Endfasern mit Epidermiszellen der tieferen Schichten der Oberhaut zusammenhängen27). Doch da man diese Zellen kaum als Endorgane im physiologischen Sinne ansehen kann, als solche Organe nämlich, die ausschließlich zur Auffassung der Eindrücke befähigt waren, so ist es am wahrscheinlichsten, daß die letzten Zweige der sensibeln Nerven selbst durch die Druck- und Temperaturreize erregt werden. Auch in dieser Beziehung unterscheidet sich also der Tastsinn wesentlich von den vier Spezialsinnen. Den mit Organempfindungen begabten Teilen schließt er außerdem insofern sich an, als die eine Form jener kolbenförmigen Endgebilde der sensibeln Nerven, die PACINI'schen Körper, außer in der Haut auch in inneren Organen, namentlich an den Gelenken und im Mesenterium, vorkommen28). Hierdurch bestätigt sich die früher auf die Qualitäten der Hautempfindungen gestützte Bemerkung, daß die Haut und die Gesamtheit der übrigen sensibeln Teile mit Ausnahme der Organe der vier Spezialsinne, im Grunde nur ein allgemeines Sinnesorgan ausmachen, das sich auf der Hautfläche zu größerer Vollkommenheit entwickelt und eine für die Auffassung objektiver Reize geeignetere Beschaffenheit angenommen hat. Anatomisch ist dieses allgemeine Gefühlsorgan wahrscheinlich dadurch ausgezeichnet, daß in ihm die Nervenfasern direkt von den Reizen getroffen werden, während in den Organen der vier Spezialsinne überall besondere Endgebilde existieren, durch welche Reize, die bei direkter Einwirkung zu schwach sind, um eine Erregung hervorzubringen, den Nerven in einer verstärkten oder modifizierten Form zugeführt werden.
26) Endkolben sind bis jetzt nur in der Bindehaut des Auges, der Schleimhaut der Mundhöhle, der Lippen, der Zunge und des weichen Gaumens sowie in einer etwas modifizierten Form an der glans penis und clitoridis aufgefunden. Tastkörperchen finden sich an den Fingerenden, besonders reichlich am Zeigefinger, in der Haut der Handfläche, des Handrückens, des Vorderarmes, der Fußsohle, des Fußrückens, der Brustwarze und in der Lippenschleimhaut. Die pacinI'schen (oder VATER'schen) Körperchen hängen den Verzweigungen der Hautnerven im Unterhautbindegewebe an. Sie finden sich so in großer Zahl an der Haut der Fingerflächen, am Hand- und Fußrücken, an der Fußsohle, in geringerer Menge am Oberarm, Vorderarm; Halse, an den Gelenk- und Inlercostalnerven sowie an den Verbreitungen der sympatischen Bauchgeflechte im Mesenterium.
27) HENSEN, Archiv f. mikr. Anatomie IV, S. 116.
28) RAUBER, VATER'sche Körper der Bänder- und
Periostnerven und ihre Beziehung zum sog. Muskelsinne. Neustadt a. d. H.
1865.
Die wesentlichsten qualitativen Verschiedenheiten, welche der Gefühlssinn darbietet, sind die der Druck- und der Temperaturempfindungen. Beide sind, da sie auf durchaus verschiedenen Formen der Reizung beruhen, nicht mit einander vergleichbar. Nur die schwächsten Temperatur- und Tastreize, die nahe der Empfindungsschwelle liegen, können verwechselt werden29), eine Tatsache, welche für die ohnehin wahrscheinliche Annahme spricht, daß beide Formen des Reizes von den nämlichen Nervenfasern aus wirken. Unter den Temperaturempfindungen sind wieder die Warme- und Kälteempfindungen qualitativ disparat, daher denselben wohl auch verschiedenartige Reizungsvorgänge zu Grunde liegen.
29) Fick und WUNDERLICH, Moleschott's Untersuchungen zur Naturlehre des Menschen VII, S. 1.
Indem wir hiermit dem Gefühlssinn die Bedeutung eines allgemeinen Sinnes zuerkennen, der von den Gemeingefühlen nicht strenge zu sondern ist, suchen wir eine Auffassung wieder zur Geltung zu bringen, welche im wesentlichen schon J. MÜLLER30) vertreten hat. In neuerer Zeit wurde dieselbe durch die Annahme einer spezifischen Natur der Tastempfindungen verdrängt, was mit der Tendenz einer folgerichtigen Durchführung der Lehre von den spezifischen Energien im Zusammenhange steht. Auf experimentellem Wege hat E. H. WEBER das spezifische Wesen der Tastempfindungen zu begründen gesucht. Er stützte sich hierbei auf folgende Beobachtungen: 1) Innere Teile, wie die Schleimhaut des Magens, des Darms, bloßgelegte Wundflächen u. s. w., können durch Druck- und Temperaturreize entweder gar nicht oder jedenfalls viel schwieriger erregt werden als die äußere Haut31). 2) Die Einwirkung der nämlichen Reize auf die Nervenstämme, deren Fasern sich im Tastorgan ausbreiten, bringt keine Druck- und Temperaturempfindung sondern nur Schmerz hervor32). Schon WEBER vermutete daher, daß in der Haut, wie in den anderen Sinneswerkzeugen, spezifische Einrichtungen zur Auffassung der Reize getroffen sein möchten, und wies in dieser Beziehung auf die PACINI'schen Körper hin33). Diese Auffassung schien sich dann glänzend zu bestätigen, als die Entdeckung der Tastkörperchen durch Meissner, der Endkolben durch Krause eine Reihe analoger Endgebilde kennen lehrte34). Aber es wurde schon oben darauf hingewiesen, daß damit immer noch viele, ja vielleicht die meisten der einfach sensibeln Nerven der besondern Endorgane entbehren, während von diesen letzteren hinwiederum manche, nämlich ein großer Teil der PACINI'schen Körper, in Teilen vorkommen, die nicht zum eigentlichen Tastorgan gehören. Auch die von weber beigebrachten Beobachtungen beweisen bei genauerer Prüfung nicht ganz was sie sollen. Wenn Druck- und Temperaturreize direkt auf die Nervenstämme oder auf innere Teile angewandt bis zu ziemlich beträchtlicher Stärke ohne Wirkung bleiben, so beweist dies eben nur eine geringere Reizbarkeit, keine verschiedenartige Energie des Empfindens. Wenn z. B. bei Anfüllung des Mastdarms mit kaltem Wasser oder bei Berührung einer eiternden Wundfläche mit einem kalten metallischen Körper der Patient nicht sicher zu entscheiden vermag, ob der Eindruck kalt oder warm sei, so weist das stattfindende Schwanken des Urteils doch immerhin auf die, obzwar undeutliche, Empfindung eines Temperaturreizes hin. Dabei kommt dann außerdem in Betracht, daß offenbar bei vielen inneren Teilen, und vielleicht ebenso bei den sensibeln Nervenstämmen, Reizschwelle und Reizhöhe einander sehr nahe liegen. Nun vermindert sich auch im Tastorgan mit der Annäherung an jene beiden Grenzwerte die Deutlichkeit der Empfindung außerordentlich, so daß Wärme und Kälte, Druck und Temperatur leicht mit einander verwechselt werden. Sucht man sich aber über die Qualität irgend welcher aus innern Reizen hervorgegangener Organgefühle Rechenschaft zu geben, so werden immer die Druck- und Temperaturempfindungen der Haut zum Vergleichungsmaßstabe gewählt; nie wird an irgend eine der andern Sinnesqualitäten gedacht. Es mag hier allerdings zum Teil die häufig vorkommende Miterregung des Tastorgans (durch einen von innern Organen ausgehenden Druck- oder Temperaturreiz) im Spiele sein; aber jene Beziehung ist doch auch in solchen Fällen vorhanden, wo an eine solche Reizung des Tastorgans selbst nicht zu denken ist. So werden denn auch die Schmerzen der innern Organe als brennend, drückend, stechend u. s. w. bezeichnet, Ausdrücke, die unmittelbar an die Qualitäten bestimmter Tastempfindungen erinnern. Der Unterschied der Haut von den übrigen Organen, in welchen einfach sensible Nerven sich ausbreiten, besteht also wesentlich darin, daß jene in Bezug auf den Reizumfang bevorzugt ist. Hierdurch vermag das Tastorgan teils Veränderungen der Reizstärke zwischen weiteren Grenzen zu unterscheiden, teils aber auch die verschiedenen Qualitäten der Tastreize, Wärme, Kälte und Druck, ungleich schärfer aufzufassen. Diese Unterschiede in Bezug auf Reizschwelle und Reizhöhe können möglicher Weise in zwei Momenten ihren Grund haben: erstens in der günstigeren Lage der Nervenenden gegenüber den auf sie wirkenden Reizen, und zweitens in der Interpolation solcher nervöser Gebilde, welche die Reizbarkeit der peripherisch gelegenen Nervenfasern vergrößern. Daß eine solche Rolle unter Umständen den Ganglienzellen zukommen kann, haben wir in Kap. VI gesehen, und in der Tat sind, worauf wir unten zurückkommen werden, wahrscheinlich in die Endausbreitung aller sensibeln Nerven Ganglienzellen eingestreut.
30) Handbuch der Physiologie II, S. 494
31) Art. Tastsinn und Gemeingefühl S. 513 f.
32) Ebend. S. 497.
33) Ebend. S. 521.
34) MEISSNER, Beiträge zur Anatomie und Physiologie der Haut. Leipzig 1852. KRAUSE, die terminalen Körperchen der einfach sensibeln Nerven. Hannover 1860.
Vergleichen wir die Einrichtungen, welche in den
verschiedenen Sinnesorganen zur Auffassung der Reize getroffen sind, so
bietet offenbar der allgemeinste Sinn, der Gefühlssinn, die einfachsten
Verhältnisse dar. Die in feine Endfibrillen zerspaltenen Nervenfasern
selbst sind es, die hier die Eindrücke aufnehmen; und an besonders
bevorzugten Stellen finden sich Vorrichtungen, durch welche, wie es scheint,
die Nervenfasern den Reizen zugänglicher gemacht werden. Wahrscheinlich
hängt diese Einfachheit der anatomischen Grundlage damit zusammen,
daß die Druck- und Temperatureinwirkungen eine Beschaffenheit und
Stärke besitzen, welche besondere Endgebilde zur Auffassung der Reize
entbehrlich machen. Solche Endgebilde kommen erst bei den vier Spezialsinnen
zur Anwendung. Unter diesen scheint der Gehörssinn dem Gefühlssinne
insofern am nächsten zu stehen, als bei ihm, ähnlich wie bei
den Druckempfindungen, mechanische Erschütterungen der Nervenenden
die Reizung bewirken, und diese scheinen sogar in dem zur analytischen
Auffassung der Schalleindrücke vorzugsweise befähigten Teil des
Gehörorgans, in der Schnecke, ebenfalls die Nervenenden selber zu
treffen, da die letzteren hier unmittelbar der Grundmembran aufliegen,
deren Schwingungen sich ihnen mitteilen müssen. Dazu kommen dann aber
in der Schnecke sowohl wie in den Ampullen der Bogengänge die Cilien
der den Nervenfasern aufsitzenden epithelförmigen Endzellen, welche
durch die Leichtigkeit, mit der sich mechanische Erschütterungen auf
sie übertragen, vorzugsweise geeignet sind Schallreize von sehr geringer
Intensität und von sehr verschiedener Form auf die Nervenfasern fortzupflanzen.
Wesentlich anders gestalten sich die Verhältnisse bei den drei weiteren
Spezialsinnen. In der Geruchs- und Geschmacksschleimhaut sind die äußeren
Verhältnisse zwar insofern übereinstimmende, als auch hier cilienförmige
Fortsätze der Endepithelien die Reizeinwirkung vermitteln. Aber dabei
pflanzt nicht einfach die mechanische Bewegung als solche auf die Endgebilde
sich fort, sondern es ist höchst wahrscheinlich eine chemische Einwirkung,
welche eine Bewegung jener Cilien und durch sie den Reizungsvorgang hervorruft.
Hier weicht also die Art des letzteren wesentlich von seiner äußeren
Ursache ab. Sehr verschiedene Reize können daher den nämlichen
Erregungsvorgang auslösen, die Beziehung zwischen Qualität der
Empfindung und Form des Reizes ist nur eine indirekte, insofern gewissen
Klassen chemischer Einwirkung übereinstimmende Formen der Erregung
zu entsprechen pflegen. In dieser Beziehung haben darum auch Geruchs- und
Geschmackssinn bis zu einem gewissen Grad ein analytisches Vermögen:
Säuren, Basen, Salze, ätherische Öle u. s. w. bewirken Empfindungen
von ähnlicher Qualität, also auch, wie wir vermuten dürfen,
Reizungsvorgänge von ähnlicher Form. Aber die Empfindung folgt
nicht, wie beim Gehörssinn, stufenweise der Form des Reizes, sondern
sie ist nur ein verhältnismäßig rohes Reagens für
gewisse bedeutende Differenzen der chemischen Einwirkung.
Schon in dieser Beziehung schließt sich der
Gesichtssinn den beiden letztgenannten Sinnen näher als dem Gehörs-
und dem Tastsinne an. Er unterscheidet sich von ihnen nicht sowohl durch
die Feinheit der objektiven Reizanalyse, hierin übertrifft er sie
kaum, da sehr verschiedene Formen der Lichtreizung für die Empfindung
nicht unterscheidbar sind als durch die Genauigkeit in der Unterscheidung
der subjektiven Reizerfolge, der Empfindungen, welche er in die
stetige Mannigfaltigkeit der Farben ordnet, der im Gebiete jener niedrigeren
chemischen Sinne kein ähnlich ausgebildetes Continuum entspricht.
Vielmehr sind hier zu einem solchen nur Bruchstücke vorhanden, welche
sich teils in gewissen Geruchs- und Geschmacksnuancen, teils in Mischempfindungen
zu erkennen geben. Im Ganzen aber bildet jeder dieser Sinne, da zwischen
derartigen Bruchstücken unbestimmte Lücken bleiben, die es unmöglich
machen die vorhandenen Ansätze zu einem Continuum in irgend eine Ordnung
zu bringen, eine diskrete Mannigfaltigkeit von Empfindungen35).
Es ist sehr wahrscheinlich, daß jene Übereinstimmung des Gesichtssinns
mit den im engeren Sinne so zu nennenden chemischen Sinnen, die Unvollkommenheit
der Reizanalyse, auch auf einer übereinstimmenden Ursache beruht,
darauf nämlich, daß in der Netzhaut des Auges ebenfalls nicht,
wie im Tast- und Gehörorgan, der äußere Bewegungsvorgang
in eine ihm entsprechende Reizbewegung übergeht, sondern daß
er sich bei der Übertragung auf die Nervenenden in irgend eine andere
Bewegungsform umsetzt. Um welche Art der Umsetzung es sich dabei handelt,
muß natürlich vorerst unbestimmt bleiben, aber auch hier ist
vielleicht die Vermutung gerechtfertigt, daß eine chemische
Wirkung vorliegt. Zur Begründung dessen kann man im allgemeinen einerseits
auf die leichte chemische Zersetzbarkeit der Nervensubstanz, anderseits
auf die chemische Wirksamkeit des Lichtes überhaupt hinweisen36).
Bei den niedersten Formen des Sehorgans scheint die photochemische Wirkung
stets von einer Absorption begleitet zu sein, welche gewisse Lichtstrahlen,
namentlich die stärker brechbaren, trifft. Diese niedersten Formen
des Sehorgans bestehen nämlich in mit Nervenfasern verbundenen Epithelzellen,
welche mit rotem Pigmente, also mit einer Substanz, die vorzugsweise
Strahlen von geringer Brechbarkeit durchläßt, erfüllt sind.
Ein solcher Absorptionsvorgang scheint noch in der Retina der Vögel
die photochemische Wirkung zu begleiten, indem man hier in den Innengliedern
der Zapfen rote und gelbe Pigmentkugeln vorfindet37).
Da nun die absorbierten Strahlen vorzugsweise zu chemischer Arbeit verwandt
werden müssen, so dürfte das Vorkommen solcher roter und gelber
Pigmente die Bedeutung haben, daß in den betreffenden Sehorganen
vorzugsweise die brechbareren Strahlen die Reizwirkung ausüben38).
Da in Folge dieser Verhältnisse sowie der sonstigen chemischen Eigenschaften
der Endfasern die Wirksamkeit der einzelnen Strahlengattungen jedenfalls
eine verschiedene ist, so erhellt hieraus schon, daß im allgemeinen
mit der Veränderung des objektiven Lichtes auch der Reizungsvorgang
sich ändern wird, wobei jedoch eine genaue Beziehung zwischen beiden
nicht zu bestehen braucht. Auch genügt die Annahme einer bloßen
Gradverschiedenheit in der Wirkung der verschiedenen Lichtstrahlen auf
die Endfasern des Sehnerven nicht, um die Mannigfaltigkeit der Lichtempfindungen
zu erklären; sonst würden wir statt der verschiedenen Farben
nur Licht von verschiedener Stärke empfinden. Es müssen daher
noch andere Unterschiede in den chemischen Erfolgen der Lichtreizung stattfinden,
Unterschiede, welche wir, ähnlich wie bei den Geruchs- und Geschmackseindrücken,
nur im allgemeinen als solche in der Form des Reizungsvorganges bezeichnen
können, ohne daß wir ihre Natur näher zu bestimmen vermöchten.
Übrigens zeigt der Gesichtssinn die bemerkenswerte Eigentümlichkeit,
die mit der Einordnung seiner Empfindungen in ein Continuum zusammenhängt,
daß diese Unterschiede der Reizungsform bei den schwächsten
und bei den stärksten Reizen aufhören: die schwächsten Lichteindrücke
jeder Art werden als Dunkel oder Schwarz, die stärksten als Weiß
empfunden. Jene Differenzen der Reizwirkung oder, wie wir vermuten, der
photochemischen Wirkung auf die Endfasern des Opticus, welche wir auf verschiedene
Lichtqualitäten beziehen, sind also bei einer gewissen mittleren Intensität
der Lichtreize am deutlichsten ausgebildet. Den qualitativen Verschiedenheiten
der Empfindung werden aber Differenzen der photochemischen Wirkung entsprechen,
die wir gleichfalls in einem gewissen Sinne als qualitative betrachten
können, nämlich als solche, die je nach der Strahlengattung verschiedene
der chemischen Verbindungen ergreifen, aus welchen die Nervensubstanz besteht.
Dabei muß jedoch erstens ein abgestufter Übergang der chemischen
Wirkungen stattfinden, und es werden zweitens, wie die Rückkehr der
Farbenempfindungen im Violett gegen den roten Anfang des Spektrums annehmen
läßt, die brechbarsten der empfindbaren Strahlen Wirkungen äußern,
welche denen der wenigst brechbaren wieder nahe kommen.
35) Es muß übrigens zugestanden werden, daß es Organismen geben mag, bei denen die beim Menschen nur als Anlage vorhandene Disposition zu einem Continuum der Geruchs- und der Geschmacksempfindungen zu einer wirklichen Ausbildung gelangt ist, ebenso wie anderseits sehr wahrscheinlich Organismen existieren, denen das Continuum der Gehör- und der Lichtempfindungen, das der Mensch besitzt, fehlt, so daß statt dessen nur diskrete Mannigfaltigkeiten vorhanden sind. Für alle Sinne ist offenbar die stetige Mannigfaltigkeit in der Anlage vorhanden, ob sie zur Wirklichkeit geworden, ist überall Sache der speziellen Entwicklung.
36) Die Tatsache, daß die gewöhnlich so genannten chemischen Strahlen, d. h. diejenigen, welche auf Silber- und andere Verbindungen vorzugsweise leicht zersetzend einwirken, an der oberen Grenze des Spektrums oder sogar über dieselbe hinaus liegen, also entweder nur schwach oder gar nicht mehr empfunden werden können, bildet gegen diese Annahme keinen Einwand, da die chemische Wirksamkeit der einzelnen Strahlengattungen auch von der Natur der Verbindungen abhängt, auf welche die Wirkung stattfindet. Insbesondere scheinen sich in dieser Beziehung die komplexen organischen Verbindungen wesentlich von den einfacheren Metallverbindungen zu unterscheiden. So fand N. J. C. MÜLLER (botanische Untersuchungen, Heidelberg 1872), daß die stärkste Sauerstoffabscheidung des Chlorophylls der Pflanzen bei Bestrahlung mit rotem Licht stattfindet, welches auch durch das Chlorophyll am stärksten absorbiert wird.
37) H. Müller, über die Retina S. 37. (Ges. Abhandl. S. 76) und Taf. II.
38) Die allerdings nahe liegende Vermutung, welche Zenker (Archiv für mikr. Anatomie III, S. 250) ausspricht, daß die rot pigmentierten Zapfen die Empfindung Rot, die gelb pigmentierten die Empfindung Gelb vermitteln, kann ich nicht teilen. Die objektive Färbung eines Endorganes hat ja mit der subjektiven Beschaffenheit seiner Empfindung an und für sich gar nichts zu tun. Im vorliegenden Fall wird man aber sogar annehmen dürfen, daß diejenigen Strahlen, welche das Endorgan absorbiert, also die zu seiner eigenen Farbe komplementären, den Haupteffekt der Reizung hervorbringen. Auch für die Hypothese, daß die Empfindungen der verschiedenen Farben an verschiedene Endorgane gebunden seien, beweisen die pigmentierten Zapfen nichts. Rot und Gelb sind zu nahe stehende Farben, als daß sie oder ihre Komplementärfarben mit einer dritten zusammen ein irgend vollständiges Farbensystem bilden könnten. Dazu kommt nun, daß Zapfen mit einem dritten, z. B. blauen, Pigment nicht vorkommen, und daß nach der YOUNG'schen Hypothese, wenigstens beim Menschen, jedes Zapfen alle drei Grundempflndungen, nicht bloß eine, vermitteln soll. Es wäre aber durchaus unwahrscheinlich anzunehmen, bei den Vögeln, die sich doch bekanntlich. durch sehr bedeutende Sehschärfe auszeichnen, setze sich das Sehen aus einer viel roheren Farbenmosaik als beim Menschen zusammen.
Nach der mutmaßlichen Art der Reizübertragung
können wir hiernach alle Sinne vorläufig in zwei Klassen bringen:
in die mechanischen und in die chemischen Sinne. Bei den
ersteren, welche den allgemeinen Gefühlssinn und unter den Spezialsinnen
das Gehör umfassen, ist es die direkte Übertragung der äußern
Bewegungsvorgänge auf die Nervenenden, wodurch die Reizung erzeugt
wird. Bei den letzteren, zu welchen wir die drei übrigen Spezialsinne
rechnen, löst der Reiz sogleich einen anderartigen Vorgang, wahrscheinlich
eine chemische Molekularbewegung, aus. Bei den mechanischen. Sinnen steht
offenbar der Vorgang in den Endnervenfasern dem äußeren Reizungsvorgang
viel näher, wir empfinden den letzteren mit ihnen gleichsam unmittelbarer
als mit den chemischen Sinnen, bei denen die Form der Erregung in höherem
Grade von der unbekannten Molekularkonstitution der Nerven abhängt.
Insofern sind die mechanischen Sinne augenscheinlich die einfacheren. Der
allgemeinste unter ihnen, der Tastsinn, ist wahrscheinlich die Grundlage
für die Entwicklung der vier Spezialsinne gewesen. Bei dreien der
letzteren hat sich diese Entwicklung wohl im Anschlusse an Wimperzellen
vollzogen, die im niederen Tierreich als besondere Ausstattung einzelner
Teile der Hautbedeckung auftreten. Denn die Hörhaare, die Fortsätze
der Riech- und Geschmackszellen sind Cilien, die durch Lage und Beschaffenheit
für bestimmte Reizformen vorzugsweise empfänglich sind. Andere
Epithelzellen der Hautbedeckung sind durch Pigmentablagerung oder, bei
den höheren Tieren, durch komplizierte Cuticularbildungen der photochemischen
Wirkung des Lichtes vorzugsweise zugänglich und so zu Aufnahmegebilden
für Lichtreize geworden.
An allen Sinnesnerven finden sich endlich noch gewisse
gemeinsame Einrichtungen, welche auf übereinstimmende Erfordernisse
hindeuten: dies sind die Ganglienzellen, welche, wie es scheint, stets
den Sinnesnervenfasern kurz vor ihrer Endigung interpoliert sind. Nach
den Grundsätzen der allgemeinen physiologischen Mechanik des Nervensystems
sind aber die Ganglienzellen überall Apparate zur Ansammlung von Arbeitsvorrat,
welche, je nach der Art ihrer Verbindung mit den Nervenfasern, entweder
zugeleitete Erregungen hemmen oder solche verstärkt durch die in ihnen
frei werdenden Kräfte auf weitere Fasern übertragen39).
Es kann nicht bezweifelt werden, daß in den Ganglienzellen der Sinnesnerven
keine Hemmung sondern eine solche Übertragung stattfindet, oder daß,
um in der Sprache der früher entwickelten Molekularhypothese zu reden,
die Sinnesnervenfasern auf ihrer peripherischen Seite mit der peripherischen
Region der Zellen in Verbindung stehen. (Kap. VI) Darnach würden diese
Anfangszellen der Sinnesnerven als Vorrichtungen zu betrachten sein, welche
teils den durch die besonderen Endgebilde den Nervenfasern zugeleiteten
Reizungsvorgang nochmals verstärken, teils die für eine größere
Zahl aufeinander folgender Reizungen erforderliche Kraft den Nerven zur
Verfügung stellen.
39) Vgl. Kap. VI.
Als letzte allgemeine Frage erhebt sich endlich die nach den Beziehungen der in den Endfasern und ihren Anhangsgebilden durch den Reiz verursachten Vorgänge und desjenigen Vorgangs, welcher dann in den Sinnesnerven weiter geleitet zum Gehirn gelangt. Bleibt dieser Vorgang bis zu seinem zentralen Endpunkte von derselben nach der Form der Reize, wechselnden Form wie in den peripherischen Endgebilden, oder findet bei der Fortpflanzung eine nochmalige und vielleicht im Gehirn eine dritte Transformation statt? Man hat bis jetzt die letztere Annahme bevorzugt, indem man einerseits an der Lehre von der spezifischen Energie der Sinnesnerven festhielt, anderseits aber den Satz von der funktionellen Indifferenz der Nervenfasern stillschweigend oder ausdrücklich annahm. Nach der Lehre von der spezifischen Energie der Sinnesnerven ist die Qualität der Empfindung eine der Substanz eines jeden Sinnesnerven durchaus eigentümliche Funktion. Indem wir Licht, Schall, Wärme u. s. w. empfinden, kommt uns nichts von dem äußern Eindruck sondern nur die Reaktion unserer Sinnesnerven auf denselben zum Bewußtsein. Die spezifische Energie aber äußert sich in doppelter Weise: einmal darin, daß jeder Sinnesnerv bestimmten Reizen allein zugänglich ist, so der Sehnerv dem Licht, der Hörnerv dem Schall u. s. w., und sodann darin, daß jeder Sinnesnerv auf die allgemeinen Nervenreize, namentlich die mechanische und elektrische Erregung, nur in der ihm spezifischen Form reagiert. Es wurde schon gelegentlich bemerkt, wie der erste dieser Sätze für die verbreitetste Klasse der Sinnesnerven, nämlich für die Nerven der Haut und anderer sensibler Organe, nicht gilt, insofern für sie ein allgemeiner Nervenreiz, der mechanische, zugleich ein ihnen adäquater Reiz ist. Bei den vier Spezialsinnen scheint aber die spezifische Reizbarkeit nicht sowohl auf einer spezifischen Eigentümlichkeit der Nerven zu beruhen als darauf, daß jedem der letzteren besondere Endgebilde beigegeben sind, welche die Übertragung bestimmter Formen der Reizbewegung auf die Nervenenden vermitteln. So hat man denn auch die Lehre in ihrer ursprünglichen Form aufgegeben und, indem man sie durch den Satz von der funktionellen Indifferenz der Nerven verbesserte, die spezifische Form der Sinnesleistung ausschließlich auf die Endgebilde in den Sinnesorganen und im Gehirn zurückgeführt. Die Nervenfasern werden nach einem oft gebrauchten Bilde mit Telegraphendrähten verglichen, in denen immer dieselbe Art des elektrischen Stromes geleitet wird, der aber, je nachdem man die Enden des Drahtes mit verschiedenen Apparaten in Verbindung setzt, die verschiedensten Effekte hervorbringen, Glocken läuten, Minen entzünden, Magnete bewegen, Licht entwickeln kann u. s. w. 40). Wird nun außerdem zugegeben, daß die peripherischen Endgebilde nach ihrer ganzen Einrichtung wahrscheinlich nur die Übertragung der spezifischen Reizformen auf die Nervenfasern, nicht selbst die Empfindung vermitteln, so bleiben allein die zentralen Sinnesflächen im Gehirn übrig, auf deren mannigfache Energien alle Unterschiede der Empfindung zurückzuführen wären. Sollte man aber auch die peripherischen Endgebilde selbst Teil nehmen lassen an dem Akt der Empfindung, so würde man doch über eine solche spezifische Energie der zentralen Sinnesflächen nicht hinwegkommen, da nach Hinwegfall des Sinnesorgans die Reizung des Nerven noch spezifische Empfindungen auslöst. Man müßte dann in den Zentralteilen immerhin Verschiedenheiten der Vorgänge annehmen, die als eine Art Zeichen oder Signale den Verschiedenheiten der peripherischen Reizungsvorgänge entsprächen41). Nun machen es, wie wir in Kap. V gesehen haben, sowohl die elementaren Strukturverhältnisse des Gehirns wie die Zergliederung seiner Verrichtungen in hohem Grade wahrscheinlich, daß der Satz von der funktionellen Indifferenz im selben Umfange, in welchem er in Bezug auf die Nervenfasern angenommen ist, auch auf die zentralen Endigungen derselben ausgedehnt werden muß. Die Unterschiede, die an den letzteren gefunden werden, sind nicht größer als diejenigen, welche die verschiedenen Nervengattungen darbieten, und der Erfahrung, daß verschiedenartige Nervenenden mit einander verheilt und dann z. B. durch Reizung sensibler Fasern motorische Wirkungen ausgelöst werden können42), treten die umfangreichen Stellvertretungen zwischen den zentralen Endgebilden als nahehin gleichberechtigte Tatsachen zur Seite. Offenbar hat man bei dieser Verlegung in die Zentralteile nur den Kunstgriff gebraucht, den Sitz der spezifischen Funktion in ein Gebiet zu verschieben, das noch hinreichend unbekannt war, um über dasselbe beliebige Behauptungen wagen zu können43).
40) Helmholtz, Lehre von den Tonempfindungen, 3te Aufl. S. 233.
41) In dieser Weise habe ich selbst früher die Lehre von den spezifischen Sinnesenergien mit dem Satz von der funktionellen Indifferenz zu vereinigen gesucht. S. meine Vorlesungen über die Menschen- und Tierseele I, S. 182. Auch die Voraussetzung, daß die peripherischen Endgebilde selbst zentraler Funktionen fähig seien, wie sie mit Rucksicht auf manche andere Verhaltnisse der Sinnesempfindungen ausgesprochen wurde (Mach, Vierteljahrsschrift f. Psychiatrie II), hilft nicht aus dieser Verlegenheit. Denn die Annahme zentraler Signale bleibt immer erforderlich, da nach Zerstörung der Sinnesorgane immer noch die spezifischen Empfindungen derselben in Folge zentraler Reizung entstehen können.
42) Vgl. S. 227.
43) Vgl. Cap. V, S. 226. 231.
Zu den Schwierigkeiten, welche der Lehre von der spezifischen Energie in ihrer Anwendung auf die verschiedenen Sinne anhaften, kommen noch größere, sobald man dieselbe den Erfahrungen über die qualitativen Empfindungsverschiedenheiten eines und desselben Sinnes anpassen will. Im Sehnerven sollen nach der von helmholtz adoptierten und modifizierten Hypothese YOUNG'S dreierlei Nervenfasern existieren, rot-, grün- und violett-empfindende. Nun wird aber der örtlich beschränkteste Lichteindruck niemals in einer bestimmten Farbe wahrgenommen: man ist also genötigt auf der kleinsten Fläche der Retina schon eine Mischung dieser drei Fasergattungen oder ihrer Endgebilde vorauszusetzen, eine Annahme, welche mit dem Durchmesser der Stäbchen, deren jedes, wie es scheint, nur je eine Primitivfibrille aufnimmt44) schwer in Einklang zu bringen ist. Aber noch größer werden die Schwierigkeiten im Gehörorgan. Hier muß man wegen der analysierenden Fähigkeit des Ohres natürlich annehmen, daß jedem einfachen Ton von bestimmter Höhe eine bestimmte Nervenfaser entspreche, welche mit dem auf sie abgestimmten Teil der Grundmembran in Verbindung stehe. Nun ist aber unsere Tonempfindung eine stetige, sie springt nicht plötzlich sondern geht allmälig von einer Tonhöhe zur andern über. Man müßte also unendlich viele Nervenfasern postulieren. Um dem zu entgehen, setzt helmholtz voraus, durch einen Ton, der zwischen den der spezifischen Empfindung je zweier Fasern entsprechenden Tönen in der Mitte liege, würden beide in Erregung versetzt, und zwar beide gleich stark, wenn der betreffende Ton genau die Mitte halte zwischen den zwei Grundempfindungen, verschieden stark, wenn er der einen oder andern naher stehe45). Dies steht aber im Widerspruch mit der Tatsache, daß ein einfacher Ton immer nur eine einfache Empfindung bewirkt. Bei den Tönen, welche in dem Intervall zwischen den Grundempfindungen zweier Nervenfasern gelegen sind, müßte notwendig die Empfindung eine zusammengesetzte sein. Auf die anatomischen Schwierigkeiten, die sich in andern Sinnesgebieten erheben, will ich hier nur kurz hinweisen. In der Haut müßten mindestens dreierlei Nerven, Druck-, Wärme- und Kältenerven, angenommen werden; in der Geruchs- und Geschmacksschleimhaut waren für die verschiedenen Sinneseindrücke wieder spezifisch verschiedene Endgebilde mit zugehörigen Nervenfasern vorauszusetzen, wozu die anatomische Untersuchung schlechterdings noch gar keine Anhaltspunkte geboten hat.
44) Siehe oben.
45) Helmholtz a. a. O. S. 230. Ich habe mir erlaubt,
statt der Abstimmung der CORTI'schen Bogen oder der ihnen entsprechenden
Teile der Grundmembran, wovon Helmholtz redet, die Grundempfindungen der
Nervenfasern zu setzen, was in der Sache auf dasselbe hinauskommt, aber
den Widerspruch der Hypothese mehr ins Licht setzt.
Die Verhältnisse am Gehörorgan, die nach physiologischer und anatomischer Seite bis jetzt am klarsten dargelegt sind, geben die beste Lösung dieser Schwierigkeiten, in welche die Lehre von den spezifischen Energien verwickelt. Nehmen wir der jetzt herrschenden Vorstellung gemäß an, die Grundmembran sei in ihren verschiedenen Teilen auf die verschiedenen dem Ohr empfindbaren Töne abgestimmt, so läßt sich, wie oben schon angedeutet, die einfache Tonempfindung aus der unmittelbaren mechanischen Erregung der Nervenenden ableiten. Diese wird in analoger Weise wie bei der so genannten mechanischen Tetanisierung der Muskelnerven vor sich gehen, bei welcher die Muskeln durch schnell und in gleichen Intervallen auf einander folgende mechanische Stöße zu dauernder Zusammenziehung gebracht werden46). Wir können uns dann aber vorstellen, daß eine und dieselbe Nervenfaser, wenn sie sukzessiv mit den verschiedenen Teilen der Grundmembran in Berührung gebracht würde, auch sukzessiv verschiedene Tonempfindungen vermittelte, indem jeder momentanen Erregung ein einmaliger Reizungsvorgang, einer n-mal in der Zeiteinheit erfolgenden Erregung also ein n-maliger entspricht. Diese Annahme würde nur dann unhaltbar sein, wenn sich ergeben sollte, daß die Reizung im Nerven ein zu kurzer Vorgang ist, um auch den schnellsten Schwingungen, welche unser Ohr noch als Ton aufzufassen vermag, folgen zu können. In der Tat haben wir nun in Kap. VI gefunden, daß jede momentane Reizung eine sehr lange Zeit im Nerven nachdauert. Aber die Dauer der ganzen Reizungsperiode schließt nicht aus, daß der Nerv periodischen Erregungen von viel kürzerer Dauer mit einem Auf- und Abwogen seiner eigenen Reizungswelle zu folgen vermag; hierfür ist nur erforderlich, daß die Maxima der einzelnen Reizungsperioden nicht völlig zusammenfließen. In der Tat wird nun durch Beobachtungen am Muskel der Satz, daß der Reizungsvorgang im Nerven bei periodischer Reizung die gleiche Periode wie der äußere Reizungsvorgang einhält, in gewissem Umfang bestätigt. Reizt man nämlich den Muskelnerven durch periodische elektrische Stromstöße, so befindet sich der in Kontraktion geratene Muskel in Schwingungen von gleicher Geschwindigkeit, welche sich durch einen leisen Ton zu erkennen geben47). Bei diesem Versuch setzt aber die Trägheit der Muskelsubstanz dem Umfang der Schwingungsperioden eine ziemlich enge Grenze. Im Nerven kann die Reizung mit ihren periodischen Ab- und Zunahmen jedenfalls in viel weiterem Umfange der periodischen Reizung folgen. Ein gewisses Maß der Vergleichung dürfte hier die Untersuchung der Veränderungen des Muskel- und Nervenstroms bieten. Die negative Schwankung, welche nach einer instantanen Reizung eintritt, dauert nach den Versuchen von J. bernstein vom Moment der Reizung an gerechnet beim Nerven im Mittel 0,0005, beim Muskel 0,003 Sekunden48). Sonach würde bei einer intermittierenden Reizung des Nerven von 2000 einzelnen Stößen in der Sek. jeder einzelne Reizungsvorgang vollständig ablaufen können, ehe ein neuer anfinge. Sollten dagegen nur die Maxima der einzelnen Reizungskurven noch von einander sich sondern, so würde, wie aus den von BERNSTEIN gegebenen Ermittlungen zu schließen ist, nahezu eine 10mal so schnell, also 20.000 mal in der Sek. erfolgende Reizung eben noch einen intermittierenden Reizungsvorgang nach sich ziehen. Diese Zahl fällt so ziemlich mit der Grenze zusammen, welche man für die höchsten noch wahrnehmbaren Töne gefunden hat. Hiernach scheint uns nichts der Annahme im Wege zu stehen, daß die Schallreizung nur eine besondere Form der intermittierenden Nervenreizung sei, und daß speziell die Tonempfindung auf einem regelmäßig periodischen Verlauf der Reizungsvorgänge in den Acusticusfasern selber beruhe. Die Acusticusfasern sind aber nach unserer Ansicht nur deshalb die einzigen, die der Tonempfindung fähig sind, weil allein an den Enden des Hörnerven jene Vorrichtungen angebracht sind, die sich zur Unterhaltung regelmäßig periodischer Reizungen eignen.
46) Vgl. mein Lehrb. der Physiologie, 3te Aufl. S. 506.
47) Helmholtz, Monatsber. der Berliner Akademie. Mai
1864.
48) Bernstein, Untersuchungen über den Erregungsvorgang
S. 24. 64.
Was die übrigen Sinnesnerven betrifft, so scheint hier die größte Wahrscheinlichkeit dafür obzuwalten, daß der Erregungsvorgang in ihnen kein periodischer und nicht einmal ein intermittierender sei. Hierfür spricht namentlich die bei denselben vorhandene Nachdauer der Empfindung, welche auf bleibende und allmälig sich ausgleichende Veränderungen durch die Reizung hindeutet. Man wird nämlich annehmen dürfen, daß, wo die Reizung eine Nachdauer hat, gegen welche die Länge der möglicher Weise anzunehmenden Reizungsperioden verschwindet, überhaupt der Reizungsvorgang keine intermittierende Form mehr besitzt, sondern, abgesehen von den etwa einwirkenden Ermüdungserscheinungen, während der ganzen Zeit gleichmäßig andauert. Die Maxima der einzelnen Reizungskurven werden also zu einer der Abszissenachse parallelen Geraden zusammenfließen. Auch hierfür besitzen wir in den Erscheinungen der Muskelreizung eine Analogie: wenn wir nämlich den Muskel nicht durch intermittierende Reize sondern mittelst Durchleitung eines konstanten Stromes durch den Muskel selbst in Kontraktion versetzen, so gerät er ebenso wie bei der raschen intermittierenden Reizung in dauernde Zusammenziehung, aber er befindet sich nicht wie bei dieser in tönenden Schwingungen, offenbar weil der konstante Strom in Zeitmomenten, welche zu rasch auf einander folgen, als daß sie im Bewegungszustand des Muskels sich äußern könnten, Reizungsvorgänge auslöst49). In ähnlicher Weise bewirkt, so nehmen wir an, bei den chemischen Sinnen die Reizung Molekularvorgänge, die in jedem Moment in der gleichen Form sich wiederholen, so daß der Gesamtvorgang der Reizung fortwährend in gleicher Höhe andauert. Damit werden wir aber auch sogleich darauf hingewiesen, bei diesen Sinnen die Form der Erregung nicht in dem Verlauf der Reizung, sondern in der eigentümlichen Form der elementareren Molekularbewegungen zu suchen. Es lassen sich nämlich zweierlei Arten denken, nach denen sich der Vorgang der Reizung im Nerven ändert. Entweder können die Molekularvorgänge in ihrer Beschaffenheit ungeändert bleiben, während die periodische Aufeinanderfolge ihrer Zu- und Abnahme wechselt: dies ist der Fall, den wir bei der Schallreizung voraussetzen. Oder es können die Unterschiede des Verlaufs verschwinden, während in der Natur der Molekularvorgänge je nach der Art der Reizung Veränderungen eintreten: dies ist der Fall, den wir bei den chemischen Sinnen vermuten. Nichts steht dann aber im Wege anzunehmen, daß in beiden Fällen der Molekularvorgang in der ihm von Anfang an zukommenden Beschaffenheit durch die ganze Nervenfaser bis zum Gehirn sich fortpflanzt, so daß die schließlich in den zentralen Zellen ausgelösten Prozesse eben nur deshalb verschieden sind und als verschiedene Empfindungen zum Bewußtsein kommen, weil die Molekularvorgänge, die von den Nerven aus in ihnen anlangen, entweder in ihrem periodischen Verlauf, wie bei den Klangempfindungen, oder in ihrer sonstigen Natur, wie bei den Erregungsweisen der chemischen Sinne, sich unterscheiden. Dies ist, so weit ich sehen kann, der einzige Weg, auf welchem die Erfahrungen über die funktionelle Scheidung der Organe mit dem Satz von der funktionellen Indifferenz der Elementarteile in Einklang zu bringen ist. Eine spezifische Funktion der einzelnen Nervenelemente existiert in der Tat nach unserer Hypothese nicht mehr, denn auch jener Wechsel in der Beschaffenheit der Molekularvorgänge ist nur durch die Art und Weise verursacht, wie die einzelnen Elemente unter einander und in den Sinnesorganen mit den äußern Reizen in Berührung gebracht werden.
49) WUNDT, Lehre von der Muskelbewegung S. 121. Lehrb. der Physiologie, 3te Aufl. S. 509.
Noch gibt es einen Punkt, den wir bisher nicht berührten, und der doch der Lehre von der spezifischen Energie zur wesentlichsten Stütze gedient hat: dies ist die Erfahrung, daß die einzelnen Sinnesnerven jede Art der Reizung, nicht bloß die ihnen allein zugängliche, in der ihnen eigenen Qualität der Empfindung beantworten. Zur Erklärung dieser Tatsache können wir aber ein Prinzip benutzen, das durch andere bereits früher erörterte Erfahrungen nahe gelegt wird. Dasselbe besteht in der außerordentlichen Anpassungsfähigkeit der Nervensubstanz an die Reize. Wir sahen, daß neue Leitungswege innerhalb der Nervenzentren sich ausbilden können, indem die Fähigkeit bestimmter Teile der Nervensubstanz, eine ihnen zugeleitete Erregung fortzupflanzen, in dem Maße zunimmt, als dieser Vorgang öfter sich wiederholt hat50). Im wesentlichen dieselbe Anpassung müssen wir statuieren, wenn wir beobachten, daß zentrale Elemente für andere, deren Leistung aufgehoben ist, in funktioneller Aushilfe eintreten51). Dieselbe Erscheinung, die wir bei der Herstellung neuer Hauptbahnen und bei der Übernahme neuer Funktionen in Bezug auf den Reizungsvorgang im allgemeinen eintreten sehen, brauchen wir nun nur auf die besonderen Formen der Reizung auszudehnen, um jene Erfahrungen, welche die spezifische Energie scheinbar direkt bezeugen, alsbald begreiflich zu finden. Bei aller Übereinstimmung in dem allgemeinen Verlauf der Reizung wechseln doch die besonderen Molekularvorgänge in den einzelnen Sinnesnerven nach der Natur der ihnen zugeführten Reize. Wo aber einmal in einer gewissen Nervenfaser Vorgänge bestimmter Art sich ausbilden, da werden auch die komplexen Moleküle der Nervensubstanz eine Beschaffenheit annehmen, welche sie zu dieser bestimmten Form der Molekularbewegung vorzugsweise befähigt, so daß jede eintretende Erschütterung des Molekulargleichgewichts gerade diese Form der Bewegung hervorruft. Wie also, nach den Erscheinungen der stellvertretenden Funktion und gewissen Tatsachen der allgemeinen physiologischen Mechanik52) zu schließen, oft wiederholte Reizanstöße eine immer größere Beweglichkeit der Moleküle im allgemeinen begründen, so werden oft wiederholte Reizvorgänge von bestimmter Form eine Disposition zurücklassen, wonach überhaupt jede Reizung die nämliche Form einhält. Dieser spezielle Satz ergibt sich aus dem allgemeinen von selbst, wenn wir uns jene Dispositionen, wie wir wohl nicht anders können, auf eine Veränderung des Gleichgewichtszustandes der komplexen Moleküle zurückführen. Denn eine solche Veränderung wird immer darin bestehen müssen, daß das Molekulargleichgewicht nach einer bestimmten Richtung ein labiles geworden ist, und offenbar eben nach jener Richtung, in welcher regelmäßig die mit der Reizung verbundene Gleichgewichtsstörung, welche die Disposition begründet, bestanden hat.
50) Vgl. S. 124.
51) Vgl. S. 162.
52) Vgl. Kap. VI, S. 262.
Schließlich wollen wir nicht versäumen zu Gunsten der hier entwickelten Anschauung zwei Gründe anzuführen, die zwar der Erklärbarkeit der einzelnen Erfahrungen nichts hinzufügen, die aber für den allgemeinen Wert der Theorie von großer Bedeutung zu sein scheinen. Indem die Lehre von der spezifischen Energie jedem Sinnesnerven oder jedem zentralen Element eine eigentümliche Form der Empfindung zuschreibt, kann sie die empirisch feststehende Tatsache nicht erklären, wie es komme, daß doch eine gewisse Zeit hindurch die Funktion der einzelnen Sinnesorgane durch die ihnen adäquaten Reize unterhalten sein muß, wenn die eigentümliche Form der Empfindung auch nach dem Verlust des Sinnesorgans fortbestehen soll. Blind- und Taubgeborenen mangelt absolut die Licht- und Klangempfindung, obgleich die Sinnesnerven und ihre zentralen Endigungen vollkommen ausgebildet sein können, da Atrophie der Nervenelemente in Folge von Funktionsmangel erst im postfötalen Leben sich einstellt53), und es an einer Erregung der zentralen Elemente durch die gewöhnlichen Formen automatischer zentraler Reizung nicht fehlt. In der Tat erhalten sich bei vollständig Erblindeten und Tauben viele Jahre hindurch die Licht- und Klangempfindung in der Form von Träumen, Halluzinationen und Erinnerungsbildern54). Aber Bedingung hierzu ist immer, daß eine gewisse Zeit hindurch das peripherische Sinnesorgan funktioniert habe. Nach unserer Hypothese erklärt sich diese Erfahrung unmittelbar aus der Anpassungsfähigkeit der Nervensubstanz, während die Lehre von der spezifischen Energie dafür schlechterdings keine Erklärung weiß. Endlich muß die letztere Lehre annehmen, jedes Sinneselement bewahre seine eigentümliche Funktion unverändert durch alle Zeiten der Entwicklung. Denn sollte sich etwa die eine Form der Funktion aus der andern hervorgebildet haben, so wäre sie eben keine spezifische mehr. Sollten also die Fähigkeiten des Hörens, Sehens, überhaupt die höheren Sinnesverrichtungen irgend einmal im Tierreich entstanden sein, so wäre dies nur auf dem Weg einer vollständigen Neuschöpfung der betreffenden Nervenelemente möglich, nie aber auf dem der Entwicklung aus niedereren Sinnesformen. Hierdurch setzt sich die Lehre von der spezifischen Energie in direkten Widerspruch mit der Annahme einer Entwicklung der organischen Wesen, während die Hypothese der Anpassung der Reizvorgänge an den Reiz nur als die besondere Form erscheint, welche die Entwicklungstheorie in Bezug auf die Entwicklung der Sinne notwendig gewinnen muß. So dürfen wir denn eine Anschauung, zu welcher von so verschiedenen Seiten her unabhängige Wege zu führen scheinen, und aus welcher alle bekannten Erfahrungen sich ableiten lassen, wohl als hinreichend begründet ansehen, um sie einer andern vorzuziehen, die mit der Mechanik der Nerven, der Physiologie der Sinne und der allgemeinen Entwicklungsgeschichte gleich unvereinbar ist, und von der in der Tat schwer wäre einzusehen, wie sie so lange ihre Herrschaft behaupten konnte, wäre sie nicht durch die in der Naturwissenschaft gegenwärtig herrschende spekulative Richtung begünstigt worden. Die philosophische Grundlage der heutigen Naturwissenschaften überhaupt und ganz besonders der Sinneslehre ruht auf kant. Die Lehre von den spezifischen Energien ist ein physiologischer Reflex des KANT'schen Versuchs, die subjektiven Bedingungen der Erkenntnis zu ermitteln, wie dies bei dem hervorragendsten Vertreter jener Lehre, bei J. müller, besonders deutlich hervortritt55). Doch kann man diesen Zusammenhang mit der KANT'schen Lehre keineswegs als einen notwendigen anerkennen. Die Einsicht in die rein subjektive Natur der Empfindung ließ allen möglichen Anschauungen über die physiologische Grundlage derselben Raum, und in der Annahme, daß die Empfindung selbst eine spezifische Energie der Sinnesnerven sei, hatte der KANT'sche Satz von der Subjektivität der Sinnesanschauungen im Grunde ein materialistisches Gewand angezogen, welches demselben ursprünglich durchaus nicht angepaßt war. Übrigens läßt sich nicht leugnen, daß sich die allgemeineren physiologischen Erfahrungen über die Sinne mit der Lehre von der spezifischen Energie in Einklang bringen ließen. Erst die speziellen Gestaltungen, die man ihr hat geben müssen, um die neueren Erfahrungen im Gebiet des Gesichts- und Gehörssinns mit ihr zu vereinbaren, haben die oben aufgezeigten Widersprüche dargelegt, zu deren Beseitigung von einer andern Seite die in der allgemeinen Nervenphysiologie gewonnenen Anschauungen hindrängen. Doch ist es selbstverständlich, daß die allgemeine Frage über den Zusammenhang der äußeren Reizform mit der Empfindung durch diese Änderung des theoretischen Standpunktes nicht berührt wird. Die Empfindung ist zwar, dies läßt sich nicht verkennen, dem äußeren Reiz gewissermaßen näher gerückt, sie steht nicht mehr als eine unbegriffene Energie bestimmter Nervengebiete dem Reiz völlig unabhängig, unberührt von der besondern Beschaffenheit desselben, gegenüber, sondern sie richtet sich wesentlich nach der letzteren, indem die Qualität der Empfindung ursprünglich nur aus der Einwirkung einer bestimmten Reizform auf die Nervensubstanz hervorgeht. Aber trotzdem wird die Empfindung nicht mit dem äußeren Reiz identisch, sondern sie bleibt die rein subjektive Form, in der unser Bewußtsein auf bestimmte Nervenprozesse reagiert. Der wesentliche Unterschied von der Hypothese der spezifischen Energie besteht darin, daß diese die Empfindung lediglich von den Teilen bestimmt sein ließ, in welchen der Reizungsvorgang ablief, während wir in der Form dieses Vorgangs den nächsten Grund für die Form der Empfindung erkennen. Es braucht aber kaum darauf hingewiesen zu werden, daß diese Anschauung auch die psychologisch begreiflichere ist. Wir können uns sehr wohl vorstellen, daß unser Bewußtsein qualitativ bestimmt ist durch die Beschaffenheit der Prozesse, welche in den Organen, die seine Träger sind, ablaufen; es wird uns aber schwer zu denken, wie dieses qualitative Sein nur mit den örtlichen Verschiedenheiten jener Prozesse veränderlich sein soll. Man müßte mindestens neben den örtlichen noch andere innere Verschiedenheiten annehmen. Dann ist man aber von selbst bei unserer Anschauung angelangt, denn daß nebenbei die einzelnen Provinzen des Nervensystems in die verschiedenen Funktionen sich teilen, leugnen wir keineswegs. Nur haben diese örtlichen Verschiedenheiten für unser Bewußtsein, das sich den Raum und alle räumlichen Beziehungen erst konstruieren muß, schwerlich einen ursprünglichen Wert und am allerwenigsten einen solchen, der sich in rein qualitativen Bestimmungen ausdrückt.
53) Vgl. S. 27.
54) Ich habe über diese Frage mit einem intelligenten
wissenschaftlich gebildeten Manne korrespondiert, der, in seinem achten
Lebensjahre total erblindet, jetzt etwa zwischen dreißig und vierzig
steht. Derselbe versichert mich, daß seine Traum- und Erinnerungsbilder
die volle Lebhaftigkeit ihrer Farben bewahrt haben.
55) J. Müller, Handbuch der Physiologie II, S. 249 f. Zur vergleichenden Physiologie des Gesichtssinns S. 39.
Wir haben die Sinnesorgane in zwei Hauptklassen zu trennen vermocht. Bei der ersten pflanzt sich die äußere Reizbewegung höchst wahrscheinlich in der ihr eigentümlichen Form auf die Nervensubstanz fort und erregt hier einen Vorgang, der in seinem allgemeinen Verlauf denn Verlauf der Reizbewegung entspricht: hierher gehören Tast- und Gehörorgan. Bei der zweiten regt die äußere Reizbewegung einen Nervenprozeß an, der, nach Form und Verlauf von ihr verschieden ist, aber doch innerhalb weiter Grenzen sich mit der Variation des äußeren Reizes verändert: hierher rechnen wir die Organe des Gesichts-, des Geruchs- und Geschmackssinns. Aus der ersten Klasse wollen wir die Gehörempfindungen, aus der zweiten die Gesichtsempfindungen einer eingehenderen Betrachtung unterziehen. Hinsichtlich der übrigen Sinne, die in jeder Beziehung noch weniger untersucht sind, mögen die obigen allgemeinen Bemerkungen genügen56).
56) Hinsichtlich des Gefühlssinns verweise ich überdies auf die Besprechung der Tastvorstellungen in Kap. XII.
Die periodischen Bewegungen der Luft, welche sich
im Gehörorgan in Reizbewegungen umsetzen, nennen wir im allgemeinen
Schall. Wie alle periodischen Bewegungen, so können auch diese
in regelmäßigen oder in unregelmäßigen Perioden vor
sich gehen. Bei der regelmäßig periodischen Schallbewegung befindet
sich die Luft in Schwingungen, deren während einer gegebenen Zeit
immer gleich viele von gleicher Form auf einander folgen; bei der unregelmäßig
periodischen Schallbewegung können die einzelnen Schwingungen in Dauer
und Form beliebig verschieden sein. Man kann sich nun aber alle, auch die
unregelmäßig periodischen Schwingungen der Luft aus regelmäßig
periodischen zusammengesetzt denken. Dies läßt sich am leichtesten
durch unmittelbare Zusammenfügung einer Anzahl regelmäßig
periodischer Wellenzüge zeigen, welche beliebig neben einander herlaufen.
Sind die Exkursionen der oszillierenden Luftteilchen nicht zu groß,
was bei den Schallschwingungen im allgemeinen vorausgesetzt werden darf,
so erhält man die resultierende Bewegung, die aus der Interferenz
mehrerer Schwingungen hervorgeht, wenn man die Exkursionen, welche
die einzelnen Wellenzüge für sich zu Stande bringen würden,
einfach addiert. Auf diese Weise ist in Fig.
84 durch Addition der punktierten und der unterbrochenen Kurve
die ausgezogene Wellenlinie erhalten worden: die letztere hat eine unregelmäßig
periodische Form, während jede der beiden ersten eine regelmäßig
periodische Bewegung darstellt. Da der Schall in der Form rasch auf einander
folgender Verdichtungen und Verdünnungen durch die Luft fortschreitet,
so ist die so gewonnene Konstruktion natürlich nur ein Bild: man hat
sich an Stelle der Wellenberge verdichtete, an Stelle der Wellentäler
verdünnte Schichten der Luft vorzustellen und überdies zu erwägen,
daß jede solche Verdichtungs- und Verdünnungswelle nicht in
einer Richtung sondern nach allen möglichen Richtungen, also
in Form einer Kugelwelle sich fortpflanzt, d. h. so daß die einzelnen
Verdichtungen und Verdünnungen in konzentrischen Kugelschalen auf
einander folgen. Da nun durch Addition verschiedenartiger regelmäßig
periodischer Schallwellenzüge, die sich, wie in Fig.
84, beliebig durchkreuzen, alle möglichen unregelmäßig
periodischen Wellenformen zu erhalten sind, so ist klar, daß auch
umgekehrt jede beliebige unregelmäßig periodische Welle in eine
Anzahl regelmäßig periodischer muß aufgelöst werden
können. Diese Zerlegung, die scheinbar bloß eine mathematische
Fiktion ist, hat in der Natur der periodischen Bewegungen ihre gute Begründung.
Jedes Masseteilchen, dessen Gleichgewicht durch eine momentane Erschütterung
gestört wird, muß nämlich in regelmäßigen Perioden
um seine ursprüngliche Gleichgewichtslage schwingen. Denken wir uns
nun viele solche Erschütterungen in beliebiger Richtung auf einander
folgen, so wird die resultierende Bewegung natürlich keine regelmäßige
mehr sein können, aber sie wird sich immer in eine Anzahl regelmäßig
oszillierender Bewegungen auflösen lassen, weil sich eben die ganze
Reihe unregelmäßig auf einander folgender Anstöße
aus einzelnen zusammensetzt, deren jeder regelmäßig periodische
Oszillationen verursachen würde.
Wirken regelmäßig periodische Schallschwingungen
auf unser Ohr ein, so erzeugen dieselben eine Empfindung, die wir als Klang
bezeichnen, wogegen wir die durch eine unregelmäßig periodische
Luftbewegung hervorgerufene Empfindung Geräusch nennen. Der
Klang ist eine stetige, das Geräusch eine unstetige,
unregelmäßig wechselnde Empfindung. Die Empfindung ist also
schon in dieser Beziehung ein treues Abbild der äußern Reizform.
Alle regelmäßig periodischen Bewegungen
können ferner in solche zerlegt werden, welche dem einfachsten
Gesetz regelmäßig periodischer Schwingungen, dem Gesetz unendlich
kleiner Pendelschwingungen folgen. Das Pendel bewegt sich fortwährend
um eine und dieselbe Gleichgewichtslage. Denken wir uns nun, ein Punkt
schwinge nach dem Gesetz des Pendels hin und her, derselbe werde aber außerdem
vorwärts bewegt, so daß seine Gleichgewichtslage fortschreitet,
so beschreibt der Punkt eine einfache oder pendelartige Schwingungskurve,
deren Entstehung man sich auch in folgender Weise versinnlichen kann. Man
denke sich einen Punkt in der um c (Fig.
85) beschriebenen Kreislinie mit gleichförmiger Geschwindigkeit
bewegt und einen Beobachter bei h aufgestellt, der den Kreis nur
von der Kante, nicht von der Fläche aus sehen kann. Es wird dann diesem
Beobachter der in der Kreislinie umlaufende Punkt so erscheinen, als ob
er nur längs des Durchmessers ab auf- und abstiege: seine Bewegung
wird aber dabei genau das Gesetz des Pendels innehalten57).
Um eine fortschreitende pendelarlige Schwingung darzustellen, teile man
den einer ganzen Wellenlänge entsprechenden Raum eg in ebenso
viele gleiche Teile wie die Peripherie des Kreises (hier in 12), und mache
die Lote auf den Teilpunkten der Linie eg der Reihe nach gleich
denen, die in dem Kreis von den entsprechenden Teilpunkten 1, 2, 3 u. s.
w. gefällt sind: die Kurve c f g, welche diese Lote verbindet,
ist dann eine einfache, pendelartige Schwingungskurve.
57) Zieht man von c aus Radien nach den Punkten 1, 2 u.s.w., so entsprechen die Winkel t, t' den verflossenen Zeiträumen, und es ist, wenn man mit r den Radius des um c beschriebenen Kreises bezeichnet, m = r. sin. t, n = r. sin. (t + t') u.s.w., d. h. die Entfernung der Punkte 1, 2 u.s.w. von der Gleichgewichtslage ist proportional dem Sinus der verflossenen Zeit. Wegen dieser mathematischen Beziehung werden die pendelartigen Schwingungen auch Sinusschwingungen genannt.
Jede periodische Schwingungsform läßt
sich aus einer bestimmten Anzahl einfacher Schwingungskurven von der hier
dargestellten Form zusammensetzen. Aber damit die resultierende Schwingungsform
eine regemäßig periodische sei, müssen die Wellenlängen
der einfachen Schwingungen, welche addiert werden, in einem einfachen
Verhältnisse stehen. Setzen wir die Wellenlänge der langsamsten
Schwingungen = 1, so müssen also die Wellenlängen der schnelleren
Schwingungen, die mit ihr addiert werden, = 1/2,
1/3, 1/4 u. s. w. sein. Im
entgegengesetzten Fall wird die Schwingungsform eine unregelmäßig
periodische wie in Fig. 84.
Es läßt sich leicht durch Konstruktion zeigen, daß man
auf diese Weise die verschiedenartigsten regelmäßig periodischen
Schwingungsformen aus einfach pendelartigen zusammensetzen kann, falls
man nur die Höhe der einzelnen Teilschwingungen wechseln läßt,
und je nachdem z. B. die geradzahligen oder die ungeradzahligen Schwingungen
überwiegen oder auch ganz wegfallen. Die Periode der ganzen Schwingungsform
bestimmt sich dabei stets nach derjenigen Teilschwingung, welche die größte
Wellenlänge besitzt. So sind in Fig.
86 verschiedene Schwingungsformen von gleicher Wellenlänge
abgebildet. Die ausgezogenen Kurven stellen die resultierenden Schwingungsformen,
die unterbrochenen die einfach pendelartigen Schwingungen, aus denen jene
zusammengesetzt sind, dar. Die Form A ist eine der häufigsten:
sie wird erhalten, wenn ein Ton mit einem etwas schwächeren von der
doppelten Schwingungszahl sich verbindet. Auch die Form B ist nicht
selten: sie entspricht solchen Klängen, bei denen jeder Ton mit einem
schwächeren von der dreifachen Schwingungszahl vereinigt ist. Da auf
diese Weise alle möglichen regelmäßig periodischen Schwingungsformen
durch Addition aus einfach pendelartigen Schwingungen erhalten werden können,
so ist klar, daß auch umgekehrt jede beliebige regelmäßig
periodische Schwingungsform in einfach pendelartige zerlegbar sein muß.
Diese Zerlegung ist ebenfalls keine bloße Fiktion sondern in der
Natur begründet. Jedes Teilchen, dessen Gleichgewicht erschüttert
wird, vibriert nämlich, vorausgesetzt, daß seine Bewegungen
nicht gestört werden und die Schwingungsamplitude sehr klein bleibt,
in einfach pendelartigen Schwingungen. Werden nun viele Teilchen gleichzeitig
oder sukzessiv in vibrierende Bewegungen versetzt, so können natürlich
durch Addition ihrer Bewegungen die Schwingungen eine verwickeltere Form
annehmen, auch wenn sie regelmäßig periodisch bleiben, aber
sie müssen doch immer in die einfach pendelartigen Schwingungen sich
auflösen lassen, aus denen sie ursprünglich hervorgegangen sind.
Der pendelartigen Bewegung der Luftteilchen entspricht
eine Klangempfindung, welche sich durch ihre Einfachheit auszeichnet:
wir nennen dieselbe einen einfachen Klang oder einen Ton. In einem
gewöhnlichen zusammengesetzten Klang, der auf einer regelmäßig
periodischen, aber zusammengesetzten Luftbewegung beruht, lassen sich in
der Regel mehrere neben einander klingende Töne deutlich unterscheiden:
unter ihnen zeichnet der tiefste stets durch größere Stärke
sich aus, nach ihm, dem Grundton, wird daher auch die Tonhöhe des
Klangs bestimmt. Erleichtert wird diese Klanganalyse durch Resonatoren,
welche man vor das Ohr hält, abgestimmte Röhren oder Hohlkugeln,
deren Luftsäulen vorzugsweise durch diejenigen Schwingungen in Bewegung
gesetzt werden, die ihrem Eigenton entsprechen58).
Mittelst eines Resonators, der auf einen Teilton des zu analysierenden
Klangs abgestimmt ist, kann man daher diesen Teilton auch dann noch wahrnehmen,
wenn er wegen seiner geringen Stärke der unmittelbaren Beobachtung
entgehen würde. Auf diese Weise ergibt sich, daß jeder Klang
aus einer Anzahl einfacher Töne besteht, dem Grundton, welcher
die größte Stärke hat und daher die Tonhöhe des Klangs
bestimmt, und aus einer gewissen Zahl von Obertönen, denen
die zwei -, drei -, vierfache u. s. w. Schwingungszahl entspricht. Die
verschiedene Stärke und Zahl dieser Obertöne ist es, von der
die Klangfärbung der musikalischen und anderer Klänge
abhängt. Überdies sind viele Klänge von Geräuschen
begleitet (man denke z. B. an das Kratzen der Violinbogen, das Zischen
der Orgelpfeifen u. s. w.), die aber in die eigentliche Klangfärbung
nicht eingehen. Das Ohr zerlegt somit den zusammengesetzten Klang ganz
ebenso in einfache Klänge oder Töne, wie der objektive Schwingungsvorgang
sich aus einer Anzahl einfach pendelartiger Schwingungen zusammensetzt.
Die stärkste dieser pendelartigen Schwingungen empfindet das Ohr als
den Grundton des Klangs, die schwächeren als die Obertöne. Dieselbe
Analyse erstreckt sich bis zu einem gewissen Grade auch auf die Geräusche.
In den meisten Geräuschen vermögen wir deutlich einzelne Klänge
zu unterscheiden. Diese Unterscheidung wird aber teils durch die große
Zahl der ein Geräusch zusammensetzenden Klänge teils durch den
unregelmäßigen Wechsel derselben gestört, indem auch in
einem länger dauernden Geräusche der einzelne Klang oft nur von
kurzer Dauer ist. Die Zerlegung der Geräusche findet also augenscheinlich
eine Grenze nicht sowohl an den Empfindungen als an der Enge unseres Bewußtseins,
indem das letztere eine große Zahl neben einander herlaufender und
unregelmäßig wechselnder Empfindungen nicht mehr hinreichend
deutlich zu trennen vermag59).
58) HELMHOLTZ, Lehre von den Tonempfindungen. 3te Aufl.
S. 72 f.
59) Vgl. Kap. XIX.
Unsere Gehörempfindungen folgen so in jeder
Beziehung treu dem Verlauf der äußeren Reizbewegung: die gleichmäßig
andauernde Schwingungsbewegung empfinden wir als stetigen Klang, die unregelmäßig
wechselnde als unstetiges Geräusch. Die regelmäßig periodische
Schwingungsbewegung, den Klang, zerlegen wir in die pendelartigen einfachen
Schwingungen, die Töne, aus denen er besteht, und bis zu einem gewissen
Grade, insoweit nämlich nicht die Enge des Bewußtseins eine
Schranke bietet, sogar die unregelmäßig periodische Bewegung,
das Geräusch, in regelmäßig periodische Schwingungen, Klänge.
Man könnte denken, und hat dies in der Tat zuweilen geglaubt, diese
Analyse entspreche in einem gewissen Sinne zwar der Zergliederung, wie
sie mathematisch ausgeführt werden kann, nicht aber einer in der Natur
vorhandenen Scheidung. Denn hier existieren nur die zusammengesetzten Schwingungsbahnen
der Teilchen, nicht die einzelnen pendelartigen Schwingungen. Dennoch sind
die letzteren in der zusammengesetzten Bewegung insofern enthalten, als
diese wirklich aus Anstößen hervorgeht, von denen jeder einzelne
eine einfach pendelartige Schwingung erzeugen würde. Das Ohr analysiert
hier allerdings vollkommener als das Auge, welches, z. B. bei Beobachtung
einer Wasserwelle, von einer solchen Addition der Schwingungen nichts wahrnimmt,
aber es legt nichts in den objektiven Vorgang hinein, was nicht in diesem
selbst schon enthalten wäre. Jene Analyse, die sich in der Empfindung
vollzieht, bedeutet also: diese setzt den Reizungsvorgang aus Elementen
zusammen, welche den Elementen des objektiven Reizes genau korrespondieren.
Nur in einer Beziehung bleibt die Empfindung hinter dem äußern
Vorgang zurück: der regelmäßig periodischen Schwingung
folgt sie als eine stetige, nicht als eine auf- und abwogende Qualität,
ausgenommen bei den tiefsten musikalischen Tönen, bei denen wir die
einzelnen Schwingungen noch unterscheiden können. Auch diese Unvollkommenheit
ist wahrscheinlich in der Natur unseres Bewußtseins begründet,
welchem in der Auffassung zeitlicher Verhältnisse ziemlich enge Schranken
gesetzt sind.
Den Charakter von einfachen Klängen oder von
Tönen im physiologischen Sinne haben nur wenige der auf musikalischem
Wege erzeugbaren Klänge in mehr oder minder vollständigem Grade,
und selbst bei solchen Klängen, welche, wie die der Stimmgabeln oder
der Labialpfeifen der Orgel, objektiv ziemlich genau einfach pendelartigen
Schwingungen entsprechen, führt die Struktur des Gehörorgans
Bedingungen mit sich, welche bewirken, daß die zu den Enden des Hörnerven
gelangenden Schwingungen nicht mehr vollkommen einfach sondern mit schwachen
Schwingungen, die Obertönen des angegebenen Grundtons entsprechen,
gemischt sind60). Wir empfinden also wahrscheinlich
niemals Töne ganz frei von Klangfarbe, und der einfache Ton ist in
diesem Sinne nur ein Gegenstand der Abstraktion, dem aber allerdings gewisse
Klänge in hohem Grade sich nähern. Die meisten Klänge jedoch
besitzen schon vermöge ihrer objektiven Entstehungsweise eine entschiedene
Klangfarbe, d. h. es ist in ihnen ein Grundton mit schwächeren Obertönen
von der 2-, 3-, 4-fachen Schwingungszahl u. s. w. gemischt. Durch die geringe
Stärke dieser Obertöne unterscheiden sich die Klänge von
solchen Zusammenklängen, welche durch gleichzeitige Erzeugung
mehrerer Klänge entstehen, und deren einzelne Bestandteile völlig
oder nahezu die gleiche Stärke besitzen. Da wir übrigens in der
Empfindung den Klang in seine Teiltöne zerlegen können, so besteht
keine scharfe Grenze zwischen dem zusammengesetzten Klang und dem Zusammenklang.
Der Umstand jedoch, daß die Obertöne eines Klangs eine bedeutendere
Höhe im Verhältnis zum Grundton besitzen als die meisten Teilklänge
eines Akkords, und daß sie von viel geringerer Stärke sind,
unterscheidet in der Regel beide hinreichend scharf von einander. Den Klang
empfinden wir in der Regel noch als eine Qualität, und erst bei großer
Aufmerksamkeit und Übung erkennen wir die zusammengesetzte Natur desselben.
Die Klangqualität ist in den mittleren Tonhöhen und Klangstärken
im allgemeinen am deutlichsten ausgeprägt. Bei den tiefsten Tönen
wird der Grundton zu schwach im Verhältnis zu den Obertönen,
bei den höchsten überschreiten die letzteren die Grenzen der
Wahrnehmbarkeit. Wird ferner ein Klang schwach angegeben, so verschwinden
die die Klangfärbung bestimmenden Obertöne teilweise; bei sehr
starken Klängen dagegen werden dieselben so stark, daß die für
die Klangfärbung charakteristischen Unterschiede meistens undeutlicher
sind. Je höhere Obertöne einen Klang begleiten, um so geringer
werden die relativen Unterschiede ihrer Schwingungszahlen. Bei Klängen,
welche hohe und starke Obertöne enthalten, werden daher ähnliche
Erscheinungen wie beim Zusammenklingen nahe bei einander liegender Grundtöne
beobachtet: es entstehen scharfe Dissonanzen der Obertöne, welche,
wie bei der Trompete und anderen Blechinstrumenten, eine schmetternde Klangfarbe
hervorbringen. Andere Unterschiede des Klangs entstehen je nach dem Überwiegen
der gerad- oder ungeradzahligen Obertöne. Solche Klänge, die
bloß aus geradzahligen Partialtönen mit den Schwingungsverhältnissen
2, 4, 6 u. s. w., oder bloß aus ungeradzahligen Partialtönen
1, 3, 5, 7 u. s. w. bestehen, zeigen im Vergleich mit jenen, welche die
ganze Reihe der Obertöne 2, 3, 4, 5, 6 enthalten, eine eigentümlich
mangelhafte Beschaffenheit der Klangfärbung, die jedoch zu bestimmten
Zwecken ästhetischer Wirkung Anwendung finden kann61).
60) HELMHOLTZ, Tonempfindungen. 3te Aufl., S. 259. Einige hiermit zusammenhängende Erscheinungen sind von J. J. MÜLLER erörtert. (Berichte der Leipziger Ges. der W. 1872, S. 117 f.)
61) Beispiele von Klängen mit ungeradzahligen Obertönen
bieten die Klarinette und Bratsche mit ihrer näselnden Klangfärbung;
bloß geradzahlige Obertöne enthalten die Klänge der Saiten,
wenn sie in einem Drittteil ihrer Länge gezupft oder gestrichen werden.
Vgl. Kap. X.
Unsere Tönempfindung hat eine untere und eine
obere Grenze. Sehr langsame Schwingungen empfindet das Ohr noch als einzelne
Luftstöße, aber nicht mehr als Ton, sehr schnelle bilden ein
kontinuierliches zischendes Geräusch. In beiden Fällen hört
also nicht die Gehörempfindung überhaupt auf, sondern sie verliert
nur ihren Charakter als Klang. Die Bestimmung der Schwingungszahlen, bei
welchen dies eintritt, hat Schwierigkeiten, die teils experimentaler Natur
sind, teils in der Beschaffenheit unserer Empfindung liegen. Offenbar handelt
es sich nämlich hier nicht um scharfe Grenzen, und die tiefsten Töne
verlieren namentlich dann ihren Charakter, wenn die Schallschwingungen
nicht die hinreichende Starke besitzen. So beruht die Angabe, daß
die untere Tongrenze erst bei den musikalisch einigermaßen verwendbaren
Tönen von 2830 Schwingungen liege, zweifellos auf der Anwendung allzu
schwacher Klangquellen. Anderseits ist, sobald man nicht einfache Klänge
untersucht, eine Verwechselung mit Obertönen möglich, welche
letzteren bei diesen tiefen Tönen eine verhältnismäßig
große Stärke erreichen. Durch die in den unteren Regionen sehr
mangelhafte Unterscheidung der Tonhöhe wird diese Verwechselung leicht
möglich. Nach eigenen Beobachtungen glaube ich die untere Grenze der
Tonempfindung als eine ziemlich variable ansehen zu müssen, welche
namentlich von der Stärke der Schwingungen abhängt und daher
unter Umständen die Schwingungszahl 30 in der Sekunde noch überschreitet,
bei bedeutender Tonstärke aber leicht erheblich unter diese Grenze
gebracht werden kann.
SAVART, der zuerst die kleinste noch als Ton zu empfindende Schwingungszahl auf 8 in der Sek. angab, bediente sich einer Vorrichtung, welche sehr starke Obertöne hervorbringen mußte, nämlich eines Eisenstabs, der, um eine horizontale Achse rotierend, durch eine Brettspalte fuhr und dabei die Ränder des Brettes berührte62). Auch bei den tiefen Zungenpfeifen, die in neuerer Zeit wolf und APPUNN zum gleichen Zweck anwandten63), sowie bei der Sirene, sind die Obertöne viel zu mächtig; sie übertäuben den schwachen Grundton, wenn ein solcher vorhanden sein sollte. helmholtz hat daher teils mittelst großer KÖNIG'scher Stimmgabeln teils mittelst Klaviersaiten, die in ihrer Mitte beschwert waren, möglichst einfache Töne zu erzeugen gesucht 64). Diese Methode hat aber den andern Nachteil, daß die Luftstöße sehr schwach werden. Ich habe deshalb die ebenfalls sehr starken Kombinationstöne65) benutzt, welche zwei große gedackte Labialpfeifen bei starkem Anblasen durch einen kräftigen Blasebalg gaben. Stimmt man z. B. die eine dieser Pfeifen auf den Ton C = 64, die andere auf D = 72 Schwingungen, so entsteht beim gleichzeitigen Anblasen beider ein Differenzton C3 von 8 Schwingungen in der Sek., die man sehr deutlich als einzelne Luftstöße wahrnimmt. Verkürzt man die Länge des schwingenden Teils der einen Pfeife, so wird der Kombinationston höher und allmälig stärker. Bei dem C1 von 32 Schwingungen beginnt er zugleich stetig zu werden und endlich einen mehr musikalischen Charakter anzunehmen. Aber ich kann nicht zugeben, daß man demselben erst von dieser Grenze an eine Tonhöhe beilegt. Die verschiedensten lndividuen, musikalisch gebildete und andere, haben mir einen Kombinationston von 8 bis 16 Schwingungen im Vergleich mit dem tieferen der primären Töne als den noch tieferen Ton bezeichnet. Darnach scheint es mir zweifellos, daß bei geeigneter Stärke der Schwingungen die Tongrenze weit unter die Zahl von 30 herabgehen kann, wenn auch diese tiefsten Töne nur unvollkommen und erst im Zusammenklingen mit anderen Tönen ein gewisses Maß ihrer Tonhöhe zulassen. Dies scheint denn auch die Praxis des Orgelspiels zu bestätigen, in der man sich solch' tiefer Töne in größeren Zusammenklängen bisweilen bedient66).
62) SAVART, ann. chim. et phys. t. XLIV. p. 337.
63) Wolf, Sprache und Ohr. Braunschweig 1871. S. 246.
64) Helmholtz, Tonempfindungen. 3te Aufl. S. 279.
65) Über die Kombinationstöne und ihre Entstehungsweise
vergl. unten.
66) Ich folge hier und weiterhin der jetzt gebräuchlichsten Bezeichnung der Tonhöhen, nach welcher c das c der ungestrichenen Oktave von 128, C die tiefere Oktave von 64 Schwingungen bedeutet; die höheren Oktaven von C an, die ein-, zwei- und mehrgestrichenen, werden durch oben beigefügte Striche c', c" u. s. w., die tieferen von C an durch unten beigefügte Ziffern, C1, C2, u. s. w. bezeichnet. An den meisten Orgeln ist die Kontraoktave C1 die tiefste, größere Werke reichen bis zum Subcontra C2 von 16 Schwingungen. Als Kombinationstöne können aber noch tiefere Töne hervorgebracht werden. So gibt z. B. der Ton C2 mit seiner Quinte G2 den Differenzton C3 von 8 Schwingungen. In der Tat hört man, wenn die tiefsten Töne der Orgel benutzt werden, immer diese ganz tiefen Kombinationstöne mit, wobei zugleich, wenn die Pfeifen nahe beieinander stehen, die primären Töne durch Interferenz fast vollständig ausgelöscht werden.
Zwischen den angegebenen Grenzen stuft sich nun unsere
Tonempfindung ab nach dem in der musikalischen Skala niedergelegten Gesetze.
Wir bringen die Tonempfindungen in eine stetige Reihe, innerhalb deren
wir die Stelle jeder einzelnen Empfindung als Höhe des Tons
bezeichnen. Die Tonhöhen stehen aber zu den objekiven Schwingungszahlen
der Töne in der konstanten Beziehung, daß gleiche absolute
Unterschiede der Tonhöhe gleichen relativen Unterschieden der Schwingungszahlen
entsprechen. Damit die Tonhöhe um dieselben absoluten Größen
zu- oder abnehme, muß also die Schwingungszahl im selben Verhältnisse
vermehrt oder vermindert werden. Die musikalische Skala entnimmt der stetig
abgestuften Reihe der Tonempfindungen bestimmte Stufen: sie substituiert
auf diese Weise dem stetigen Kontinuum der Tonhöhen ein diskretes,
indem sie die Übergänge zwischen den einzelnen von ihr ausgewählten
Tonstufen überspringt. Die Auswahl der Tonstufen wird zunächst
durch Regeln bestimmt, welche auf die später (in Kap. XIII) zu erörternden
Gesetze der Klangverwandtschaft gegründet sind. Aber das Gesetz der
Beziehung zwischen Tonhöhe und Schwingungszahl kommt in der musikalischen
Skala darin zum Ausdruck, daß gleichen Tonstufen überall gleiche
Verhältnisse der Schwingungszahlen entsprechen. So ist in der ganzen
musikalischen Skala das Verhältnis der Schwingungszahlen
für die Oktave l : 2,
für die Quarte 3 : 4,
für die Duodecime l : 3,
für die Sexte 3 : 5,
für die Quinte 2 : 3,
für die große Terz 4 : 5,
für die kleine Terz 5 : 6.
Diese Verhältnisse bleiben ungeändert, wie auch die absoluten
Schwingungszahlen sich ändern mögen. Wir sind im Stande sehr
genau und ohne viele Vorbereitung die Intervalle der Tonhöhe wiederzuerkennen,
während große Übung nötig ist, um die absolute Tonhöhe
zu bestimmen. Letzteres bedarf stets einer genauen, durch häufige
Wiederholung der Toneindrücke geleiteten Wiedererinnerung, während
die Gleichheit oder der Unterschied zweier Tonintervalle, selbst wenn dieselben
verschiedenen Höhen der musikalischen Skala angehören, unmittelbar
in der Empfindung sich ausprägt. Aus demselben Grunde kann die absolute
Stimmung eines musikalischen Instrumentes beträchtlich variieren,
ohne daß wir dies wahrnehmen, während wir geringe Abweichungen
von jenen regelmäßigen Intervallen sogleich empfinden. Hieraus
ist zu schließen, daß wir nur die Verhältnisse
der Schwingungszahlen, nicht aber ihre absoluten Unterschiede unmittelbar
empfinden, und daß gleichen Verhältnissen der Schwingungszahlen
gleiche absolute Unterschiede der Empfindung korrespondieren. Dieses Gesetz
stimmt in seiner Form ganz und gar überein mit demjenigen, welches
für die Beziehung zwischen der Intensität der Empfindung und
der Stärke des Reizes gefunden wurde; wir haben nur in demselben statt
der Reizstärke die Schwingungszahl zu setzen. Stellen wir uns demnach
die Tonreihe als eine gerade Linie vor, auf der gleiche Abschnitte gleichen
Zunahmen der Tonhöhe entsprechen, und errichten wir darauf Ordinaten,
die den zugehörigen Schwingungszahlen gleich gemacht sind, so ist
die Kurve, welche die Gipfelpunkte der Ordinaten verbindet, wieder eine
logarithmische Linie. Wird mit H die Tonhöhe, mit S die
Schwingungszahl des gegebenen Tons und mit b diejenige des tiefsten
Tons der Tonreihe, mit K aber eine Konstante bezeichnet, so ist
67) Der Erste, der die Logarithmen auf das Verhältniss der Töne anwandte, war Euler, tentamen novae theoriae musicae. Petrop. 1739. p. 73. Vgl. a. HERBART, über die Tonlehre. Werke, Bd. 7., S. 224. f. Eine Berechnung der Logarithmen aller musikalisch angewandten Schwingungszahlen hat neuerdings SCHUBRING geliefert. (SCHLÖMILCH, KAHL und CANTOR, Zeitschr. f. Mathematik und Physik. XIII. Suppl. S. 105.)
Es ist bemerkenswert, daß in diesem Fall das
Gesetz der logarithmischen Funktion nicht aus der Bestimmung von Grenzwerten
der Empfindung oder eben merklichen Unterschieden abstrahiert, sondern
daß es unmittelbar der Vergleichung endlicher Empfindungswerte entnommen
ist. Dies beweist, daß das Empfindungsmaß für die Tonhöhen
weit ausgebildeter ist als dasjenige für die Empfindungsstärken
überhaupt, eine Tatsache, die wahrscheinlich in der weit reicheren
Abstufung der Tonhöhen und, was damit wohl zusammenhängt, in
der vollkommneren Erziehung des menschlichen Gehörorgans für
die Auffassung derselben begründet ist.
Die Ordnung der Töne nach dem Gesetz der Tonskala
ist ein Produkt der unmittelbaren Auffassung der Torverhältnisse;
sie kann nicht erst durch Nebenbedingungen, z. B. durch begleitende Partialtöne
von übereinstimmender Höhe, veranlaßt sein. Denn solche
Nebenbedingungen können wechseln, ohne daß dadurch die Bestimmung
der Tonintervalle sich ändert. Wir fassen diese bei reinen Tönen
genau in derselben Weise wie bei Klängen von mehr oder minder zusammengesetzter
Beschaffenheit auf68). Die Ordnung der
Tonreihe muß also darauf beruhen, daß wir an Oktave und Grundton,
Quinte und Grundton u. s. w. immer dieselben Unterschiede der Empfindung
erkennen, welche absolute Höhe die Tone auch haben mögen.
68) Hierdurch wird die Meinung widerlegt, die Ordnung der Tonhöhe beruhe auf denselben Ursachen wie die, wegen ihres Zusammenhangs mit den melodischen und harmonischen Gesetzen, erst im nächsten Abschnitt zu besprechende Klangverwandtschaft, nämlich darauf, daß die Tonintervalle bestimmter Klänge stets gewisse Partialtöne gemeinsam haben (vgl. Kap. XIII). Wäre dies richtig, so müßte unser Gefühl für die Intervalle mit der Klangfarbe der Instrumente wechseln, und bei reinen Tönen müßte es ganz fehlen. Es ist zwar wahrscheinlich, daß die aus der Klangverwandtschaft entspringenden Eigenschaften die sichere Bestimmung der Tonverhältnisse unterstützen, aber als die eigentliche Grundlage derselben kann man sie unmöglich betrachten.
Die Tonreihe bildet ein Kontinuum von einer Dimension. Wir können sie uns durch eine Linie versinnlichen, am einfachsten durch eine Gerade von unbestimmter Ausdehnung. Ihre beiden nicht genau zu bestimmenden Endpunkte sind die untere und die obere Grenze der Tonhöhen. Beide Grenzen sind rein physiologische, sie wechseln bei verschieden organisierten Wesen, wahrscheinlich sogar bei verschiedenen Individuen derselben Art, denn sie sind abhängig von der wechselnden Abstimmung der mit der Acusticusendigung verbundenen Einrichtungen. Virtuell können wir uns daher die Linie der Töne über jene beiden Endpunkte ins unendliche fortgesetzt denken. Berücksichtigt man gleichzeitig die Intensität der Empfindung, so wird aus der Tonlinie ein Kontinuum von zwei Dimensionen, das am einfachsten in der Form einer Ebene sich darstellen läßt. Diese Ebene findet nach derjenigen Abmessung, welche der Stärke des Tones entspricht, ihre Grenze an der Empfindungshöhe. Nun ist die letztere, wegen der verschiedenen Reizbarkeit unseres Ohres, im allgemeinen für mittlere Tonhöhen am größten, während sie gegen die untere und obere Tongrenze allmälig sinkt. Das Kontinuum der intensiven Töne kann somit als eine Ebene betrachtet werden, die sich gegen ihre untere und obere Grenze allmälig zu einer Linie verjüngt. Hierin eben ist die Erfahrung ausgedrückt, daß unsere reellen Tonempfindungen einen begrenzten Umfang besitzen. In unserm Bewußtsein hat außerdem als dritte Dimension der Tonempfindungen deren zeitliche Dauer eine wesentliche Bedeutung. Aber da die Zeitanschauung erst aus der gegenseitigen Beziehung wechselnder Empfindungen entspringt, so haben wir hierauf erst bei der Verbindung der Tonempfindungen zu Vorstellungen näher einzugehen69).
69) Vgl. Kap. XIII.
Von dem Klang unterscheidet sich der Zusammenklang
im allgemeinen nur durch die gleichmäßigere Stärke der
Partialtöne, aus denen er besteht. Hierdurch wird es aber unserm Ohr
leichter möglich, denselben in einzelne seiner Bestandteile zu zerlegen.
Während wir den Klang zunächst als eine einheitliche Empfindung
gelten lassen, um uns erst bei der genaueren Analyse desselben von seiner
komplexen Beschaffenheit zu überzeugen, fassen wir den Zusammenklang
sogleich als eine zusammengesetzte Empfindung auf. Hierzu trägt auch
die weit wechselndere Beschaffenheit der Zusammenklänge das ihrige
bei. Der Klang eines Instrumentes z. B. enthält, mit wenig Abweichungen,
immer dieselbe Reihe von Obertönen. Dagegen können wir auf einem
und demselben mehrstimmigen Instrumente sehr verschiedene Akkorde und andere
Zusammenklänge hervorbringen. In diesen Verhältnissen liegen
nun zwei Erscheinungen begründet, welche ausschließlich bei
Zusammenklängen vorkommen, und welche namentlich bei den musikalischen
Wirkungen derselben von großer Wichtigkeit sind. Die erste dieser
Erscheinungen besteht in den Kombinationstönen, welche dadurch
entstehen, daß zwei Tonwellenzüge von hinreichender Stärke
eine dritte Tonbewegung hervorbringen, die der Differenz oder auch der
Summe ihrer Schwingungszahlen entspricht. Die zweite besteht in den Schwebungen,
welche durch die wechselseitige Störung zweier Tonwellenzüge
von geringem Unterschied der Schwingungszahlen erzeugt werden.
Kombinationstöne bilden sich unter allen
Umständen dann, wenn die gleichzeitig erklingenden Töne stark
genug sind, daß die Größe der Schwingungen nicht mehr
als unendlich klein im Verhältnis zur Größe der schwingenden
Masse betrachtet werden kann. In diesem Falle ist nämlich das bereits
ausgesprochene Prinzip der Superposition der Schallwellen, wonach die resultierende
Schwingung immer durch einfache Addition ihrer Komponenten erhalten wird,
nicht mehr strenge richtig, sondern es entstehen zwei neue Schwingungsbewegungen
neben der ursprünglichen, von denen die Schwingungszahl der einen
der Differenz, die der andern der Summe der Schwingungen
der beiden primären Töne entspricht70).
Je zwei einfache Töne können daher zweierlei Kombinationstöne
erzeugen: einen Differenzton und einen Summationston. Davon
ist der Differenzton in der Regel der weitaus stärkere. In vielen
Fällen entstehen diese Töne erst im Ohr, dessen schwingende Massen
bei ihrer Kleinheit leicht dazu Veranlassung geben; zuweilen entstehen
sie aber auch außerhalb, in klangerzeugenden Instrumenten. Beiderlei
Kombinationstöne können sowohl durch die Grundtöne der Klänge
wie durch ihre Obertöne erzeugt werden. Aber da die Stärke der
Kombinationstöne von der Stärke der erzeugenden Töne abhängt,
so geben die Grundtöne im allgemeinen die stärkeren Kombinationstöne;
auch erreichen die Summationstöne in den Höhen der musikalischen
Skala wegen ihrer bedeutenden Schwingungszahl bald die Grenzen der Tonempfindlichkeit
des Ohres. Ferner können starke Kombinationstöne mit den primären
Tönen abermals Kombinationstöne bilden. Auf diese Weise entstehen
Differenz- und Summationstöne höherer Ordnung,
die jedoch, namentlich die letzteren, sehr schwach sind. Überhaupt
besitzen die Kombinationstöne in vielen Fällen eine so geringe
Intensität, daß sie erst mittelst Resonanzröhren, die auf
sie abgestimmt sind, deutlich wahrgenommen werden können. Doch werden
nur die außerhalb des Ohres erzeugten Kombinationstöne auf diesem
Wege verstärkt, daher die Untersuchung mit Resonanzröhren zugleich
ein Hilfsmittel darbietet, um den Ursprung der Kombinationstöne zu
erkennen. Auch schwache Kombinationstöne haben übrigens immer
noch einen wichtigen Einfluß auf den Zusammenklang, wie wir später
bei der Erörterung der ästhetischen Wirkung der Klangvorstellungen
sehen werden71); es erstreckt sich, jedoch
dieser Einfluß im allgemeinen nur auf die Kombinationstöne erster
Ordnung, unter ihnen wieder namentlich auf die Differenztöne. Von
großer Bedeutung für die Wahrnehmbarkeit und die Wirkung der
Kombinationstöne ist endlich das Schwingungsverhältnis der sie
erzeugenden primären Töne. Ist nämlich dieses Schwingungsverhältnis
ein einfaches, so daß die primären Töne ein harmonisches
Intervall (Oktave, Quinte u. s. w.) mit einander bilden, so wird auch das
Schwingungsverhältnis des Kombinationstones zu den primären Tönen
ein einfaches. So entspricht z. B. der Oktave mit dem Schwingungsverhältnis
1 : 2 ein Differenzton 1 und ein Summationston 3, der erstere fällt
also mit dem tieferen der primären Töne zusammen, der hierdurch
eine Verstärkung erfährt, der zweite bildet die Duodecime desselben.
Der Quinte mit dem Schwingungsverhältnis 2 : 3 entspricht ein
Differenzton 1 und ein Summationston 5; der erstere bildet die tiefere
Oktave des ersten der primären Töne, der zweite die große
Terz seiner höhern Octave. In solchen Fällen bringen die Kombinationstöne,
ebenso wie ihre primären Töne, eine stetige Empfindung hervor.
Dies ist anders, wenn die Schwingungszahlen der primären Töne
in keinem einfachen Verhältnis stehen. Verhalten sich z. B. die Schwingungen
der letzteren wie 10 : 23, so entsteht ein Differenzton 13, welcher
mit dem tieferen Tone 10 in der Regel nicht mehr ungestört zusammenklingt.
Vielmehr tritt hier der im allgemeinen schon in Fig.
84 dargestellte Fall ein, daß zwei Schwingungskurven,
deren jede regelmäßig ist, sich zu einer unregelmäßig
periodischen Bewegung kombinieren, die ihrer Natur nach keine stetige Empfindung
hervorbringen kann. Es entstehen auf diese Weise die sogleich näher
zu betrachtenden Schwebungen der Töne, welche der Dissonanz
zu Grunde liegen. In Folge dieser Schwebungen sind die Kombinationstöne
unharmonischer Tonverbindungen viel schwerer wahrzunehmen, doch können
sie die Dissonanz der primären Töne verstärken oder sogar,
wenn zwischen diesen selbst keine Dissonanz vorhanden war, solche hervorbringen.
70) Helmholtz, POGGENDORFF's Annalen, Bd. 94, S. 497.
Lehre von den Tonempfindungen. 3te Aufl. S. 239, 618.
71) Siehe Kap. XIII u. XVII.
Schwebungen der Töne können zwischen allen Bestandteilen zweier Klänge, sowohl zwischen den Grundtönen wie den Obertönen derselben, eintreten; außerdem können sich an denselben die Kombinationstöne beteiligen. Es beruhen diese Störungen des Zusammenklangs auf der Interferenz der Schallwellen. Läßt man zwei Töne von gleicher Höhe und Stärke erklingen, so entsteht ein Ton von der doppelten Intensität, falls die Berge und die Täler beider Wellen zusammenfallen. Nach dem früher vorgeführten Prinzip der Addition der Wellen entsteht hierbei ein einziger Wellenzug, dessen Berge und Täler die doppelte Größe besitzen. Richtet man dagegen den Versuch so ein, daß die Berge der einen Welle auf die Täler der andern treffen, und umgekehrt, so vernichten sich die beiden Bewegungen, und es entsteht gar keine Tonempfindung. Befinden sich die beiden Tonquellen in einiger Entfernung von einander, so beeinflussen sich in der Regel die Schwingungen in solcher Weise, daß der Ton durch die Interferenz verstärkt wird. Dies beruht auf den Gesetzen des Mitschwingens. Da z. B. eine Saite durch das Erklingen des Tones, auf den sie abgestimmt ist, in Mitschwingungen gerät, so passen auch die durch direktes Anschlagen derselben erzeugten Schwingungen der Schwingungsphase eines andern Tones von gleicher Höhe sich an. Nur unter besonderen Umständen wird das entgegengesetzte Resultat beobachtet: so z. B. wenn man zwei große Labialpfeifen dicht neben einander von der nämlichen Windlade aus anbläst. In diesem Falle tritt die aus der einen Pfeife ausströmende Luft immer gleichzeitig in die andere Pfeife ein, so daß beide nun in entgegengesetzten Phasen schwingen. In Folge dessen hört man statt des Tones nur noch ein zischendes Geräusch72).
72) HELMHOLTZ, Lehre von den Tonempfindungen S. 352. An der Doppelsirene von Helmholtz läßt sich derselbe Versuch ausführen, wenn man die beiden auf denselben Ton eingerichteten Scheiben so stellt, daß die Luftstöße der einen in die Zeit zwischen zwei Luftstöße der andern fallen. (Helmholtz, a. a. O. S. 256.) Aber der Versuch mit den Labialpfeifen ist schlagender, weil die Klänge derselben fast vollkommen den Charakter einfacher Klänge haben, weshalb der Ton hier wirklich verschwindet, während er bei dem von starken Obertönen begleiteten Sirenenklang in die höhere Oktave umschlägt.
Die nämlichen Erscheinungen, die wir hier während der ganzen Dauer der zusammenklingenden Töne beobachten, können nun auch während eines kleinen Teils dieser Zeit eintreten. Dies geschieht, wenn zwei Töne zusammenklingen, deren Schwingungszahlen sehr wenig von einander verschieden sind. Denken wir uns z. B., zwei Töne differierten um eine Schwingung in der Sekunde, und im Beginn des Zusammenklingens seien beide Bewegungen von gleicher Phase, so werden im Anfang der zweiten Sekunde wieder gleiche Phasen zusammentreffen, aber im Verlauf der ersten Sekunde hat der eine Ton eine ganze, aus Berg und Tal bestehende Schwingung weniger gemacht als der andere: es muß also einmal während dieser Zeit, und zwar nach Verfluß der ersten halben Sekunde, ein Berg der einen mit einem Tal der andern Welle zusammengetroffen sein. Hieraus folgt, daß Töne, die um eine Schwingung differieren, einmal in der Sekunde, nämlich da wo gleiche Phasen zusammenkommen, durch Interferenz sich verstärken; und einmal, da wo entgegengesetzte Phasen bestehen, durch Interferenz sich schwächen. Sind die Töne um 2, 3, 4 ... n Schwingungen in der Sekunde verschieden, so treten natürlich 2, 3, 4 ... n solche Ab- und Zunahmen oder Schwebungen des Tones ein. Mittelst der letzteren lassen sich beim Zusammenklingen der Töne noch außerordentlich geringe Unterschiede der Höhe erkennen. Töne, die um sehr wenig Schwingungen von einander abweichen, empfinden wir absolut gleich, wenn sie nach einander erklingen; aber sobald sie gleichzeitig angestimmt werden, erkennen wir an den Schwebungen, daß sie verschieden sind. So kann man z. B. um die Mitte der musikalischen Skala nach den Schwebungen ganz deutlich noch Töne unterscheiden, die um einige Bruchteile einer Schwingung differieren, während bei sukzessiver Auffassung meistens selbst für ein geübtes Ohr erst eine Differenz von einigen Schwingungen in der Sekunde eben vernehmbar wird73). Noch viel unvollkommener ist unsere Unterschiedsempfindlichkeit für Tonhöhen bei den tiefsten und höchsten Tönen, wo endlich selbst die genaue Bestimmung der gewöhnlich angewandten musikalischen Intervalle unsicher wird.
73) Man führt den Versuch am besten mit auf Resonanzkästen
stehenden Stimmgabeln aus, die stark mit dem Violinbogen gestrichen werden,
und deren eine man durch etwas an ihre Zinken geklebtes Wachs verstimmt.
seebeck (POGGENDORFF'S Annalen, Bd. 68, S. 463) konnte von zwei Stimmgabeln,
deren eine 1209, die andere 1210 Schwingungen in der Sekunde machte, die
erste noch als die tiefere unterscheiden. Dabei sind aber wahrscheinlich
die Schwebungen zur Bestimmung der Tonhöhe mitbenutzt worden. Nach
E. H. WEBER kann ein geübtes Ohr sukzessiv angegebene Tonhöhen
noch eben unterscheiden, wenn dieselben den Schwingungszahlen 1149 und
1145 entsprechen. Ich finde an zwei genau gleich gestimmten a-Gabeln
von 435 Schwingungen, daß, wenn die eine um 3 Schwingungen tiefer
gestimmt wird, noch zuweilen Irrtümer vorkommen; erst bei 3 Schwebungen
in der Sek. kann aber deutlich der Tonunterschied bei sukzessivem Anstreichen
erkannt werden. Dies stimmt mit WEBER'S Angaben ziemlich gut überein.
Hiernach dürfte für die Tongrenzen zwischen dem a und
etwa dem d der nächsten Oktave eine Unterscheidungsempfindlichkeit
von ![]() anzunehmen
sein. Übrigens ist eine eingehende Untersuchung, namentlich mit Rücksicht
auf die Veränderungen dieses Wertes in verschiedenen Tonhöhen,
wünschenswert.
anzunehmen
sein. Übrigens ist eine eingehende Untersuchung, namentlich mit Rücksicht
auf die Veränderungen dieses Wertes in verschiedenen Tonhöhen,
wünschenswert.
Die störende Wirkung der Schwebungen hat ihren Grund in der Umwandlung der stetigen Tonempfindung in eine intermittierende. Bei sehr langsamen Schwebungen macht sich daher die störende Wirkung noch kaum geltend, und sie wächst mit der Zunahme der Schwebungen bis zu einem Maximum, worauf sie schnell abnimmt und bald ganz schwindet, indem die Schwebungen aufhören wahrnehmbar zu sein. Jenes Maximum der Störung liegt etwa bei 30 Schwebungen in der Sekunde. Bei dieser oder einer ihr nahe kommenden Geschwindigkeit bringen die Schwebungen ein rasselndes, R-ähnliches Geräusch hervor, wobei wegen der großen Schnelligkeit, mit der die einzelnen Tonstöße auf einander folgen, eine deutliche Auffassung der Tonhöhe nicht mehr möglich ist. Der Klang verliert also hier seinen Charakter als stetige Empfindung und wird unmittelbar zum Geräusch, welches wir schon oben auf eine unregelmäßige Schallbewegung zurückgeführt haben. In der Tat beruhen Geräusche überall darauf, daß mannigfache regelmäßige Luftbewegungen sich stören, indem sie schnell nach einander Verstärkungen und Schwächungen des Schalls durch Interferenzen hervorbringen (vgl. Fig. 84). So sind demnach die Schwebungen zweier einfacher Töne gewissermaßen die elementarste Geräuscherscheinung. Bei Sehwebungen, welche die Zahl 30 erheblich übersteigen, vermag unser Ohr die einzelnen Töne nicht mehr auseinander zu halten. Schon bei 50 Schwebungen wird der intermittierende Charakter der Empfindung sehr undeutlich, und bei 60 ist er gänzlich verschwunden. Die Angabe, daß wir noch viel zahlreichere Intermissionen zusammenklingender Töne, sogar bis zu 132 in der Sekunde74), unterscheiden können, beruht zweifellos auf einer Verwechselung mit dem disharmonischen Eindruck, welchen nicht verwandte Klänge, wenn sie gleichzeitig ertönen, auf uns machen. Wir müssen aber durchaus die Störungen des Zusammenklanges, welche in den Schwebungen ihre Ursache haben, von der Beziehung, in welche die einzelnen Klänge durch ihre Verwandtschaft, nämlich durch die Übereinstimmung oder Verschiedenheit ihrer Teiltöne treten, unterscheiden. Wir wollen, um Irrtümern dieser Art möglichst vorzubeugen, den Ausdruck Dissonanz auf jene Störungen des Zusammenklanges beschränken, welche durch die Schwebungen, also durch Intermissionen der Empfindung verursacht sind. Konsonant nennen wir somit alle Klänge, welche keine für unser Gehör wahrnehmbaren Schwebungen mit einander bilden. Dagegen wollen wir die Bezeichnung der Harmonie für jene Fälle anwenden, wo eine gewisse Zahl von Teiltönen mehrerer Klänge zusammenfällt. Die Begriffe der Konsonanz und der Harmonie sind fast immer mit einander vermengt worden, und noch HELMHOLTZ hat die Identität beider Begriffe naturwissenschaftlich zu begründen gesucht, indem er die Disharmonie aus den Schwebungen, also aus dem was wir Dissonanz genannt haben, ableitete, und den Begriff der Harmonie im Grunde nur negativ, als, fehlende Dissonanz, bestimmte75). Beide sind jedoch wesentlich verschieden. Die Dissonanz kann unter Umständen den störenden Eindruck der Disharmonie verstärken, aber es kann Disharmonie ohne Dissonanz und bis zu einem gewissen Grade sogar Dissonanz ohne Disharmonie bestehen. Die Dissonanz, die größere oder geringere Rauhigkeit eines Zusammenklanges ist eine der Empfindungsqualität unmittelbar zugehörige Eigenschaft. Die Harmonie dagegen beruht, da sie von der Auffassung der verwandten oder disparaten Beschaffenheit der Klänge ausgeht, auf einem Akt der Verbindung der Empfindungen, sie fällt deshalb nicht der reinen Empfindung sondern der Vorstellung zu76). Davon daß Töne disharmonisch sein können, ohne eine Spur von Rauhigkeit zu zeigen, überzeugt man sich am besten an den einfachen Klängen auf Resonanzkästen aufgesetzter Stimmgabeln, weil hierbei die Schwebungen von Obertönen vermieden werden. In den mittleren und höheren Lagen der musikalischen Skala ist es leicht, solchen Gabeln eine Schwingungsdifferenz zu geben, bei der die Interferenzen der Töne viel zu rasch auf einander folgen, als daß Schwebungen wahrgenommen werden könnten. Trotzdem bleibt der störende Eindruck der disharmonischen Intervalle bestehen77). Anderseits kann man aber auch Schwebungen zweier Töne erzeugen, an denen keine Disharmonie bemerkt wird. Dies beruht darauf, daß wir Intermissionen des Tons schärfer auffassen als Unterschiede der Tonhöhe. Zwei Töne können daher Schwebungen mit einander machen, obgleich sie im Einklang zu stehen oder einem harmonischen Intervall anzugehören scheinen. Solche Schwebungen können unter Umständen sogar als Hilfsmittel musikalischer Wirkung dienen, öfter zwar sind sie störend, aber nicht weil durch sie Disharmonie entsteht, sondern weil die zitternde Beschaffenheit des Klangs meistens für den musikalischen Ausdruck nicht angemessen ist. Im allgemeinen achten wir auf leichte Dissonanzen dieser Art nicht viel, so lange nur das Verhältnis der Tonhöhen und die Klangverwandtschaft ungeändert bleiben. Hierauf beruht auch die relativ geringe Belästigung, welche uns die Stimmung der Instrumente nach gleichschwebender Temperatur verursacht. Denn die Abweichungen derselben von der reinen Stimmung üben auf die Empfindung von Tonhöhe und Klangverwandtschaft keinen nennenswerten Einfluß aus.
74) Helmholtz, Tonempfindungen, 3te Aufl. S. 273.
75) Auf dieser Verwechslung beruht ohne Zweifel die oben erwähnte Behauptung von Helmholtz, daß wir bis zu 132 Intermissionen des Tons in der Sek. noch wahrnehmen können. Beginnt man auf den mittleren und höheren Stufen der musikalischen Skala mit dem Einklang zweier Töne, und verstimmt man dann den einen mehr und mehr, so nimmt die durch die Schwebungen verursachte Rauhigkeit des Tons allmälig zu und dann rasch wieder ab, worauf bald beide Töne wieder kontinuierlich neben einander klingen. Aber die Disharmonie dauert fort und verschwindet erst, wenn ein durch Klangverwandtschaft ausgezeichnetes Intervall erreicht wurde. Es kann nun begegnen, daß man dieses Fortsetzen der Disharmonie auf eine Fortdauer der Rauhigkeit des Tons, der Dissonanz, bezieht.
76) Die nähere Betrachtung der Harmonie und Disharmonie gehört darum in den nächsten Abschnitt. Vgl. Kap. XIII und XVII.
77) Ich habe diese Versuche in folgender Weise ausgeführt. Von zwei gleich abgestimmten Stimmgabeln auf Resonanzkästen wurde die eine durch angeklebte kleine Gewichte allmälig verstimmt, entsprechend wurde der Resonanzkasten derselben durch Ausziehen eines Schiebers aus Pappe in seiner Stimmung verändert. Auf diese Weise konnte leicht das Entstehen der Schwebungen vom Einklang an bis zum Maximum der Rauhigkeit und von da bis zum Verschwinden der Dissonanz verfolgt werden. Unter allen Umständen fand ich so schon bei 50 Schwebungen die Rauhigkeit so undeutlich, daß man an ihrer Existenz zweifeln konnte; über 60 ist aber sicherlich keine Spur von Störung mehr zu bemerken. Auf die nämliche Grenze führt übrigens die Beobachtung der tiefsten Töne hin. Wenn ich zwei große gedeckte Labialpfeifen, die zwischen dem C von 64 und dem C von 128 Schwingungen in ihrer Stimmung veränderlich sind, auf Grundton und Quinte (C und G) stimme, so entsteht ein Differenzton C1 von 32 Schwingungen, an dem noch eben die Intermissionen der einzelnen Luftstöße bemerklich sind. Bei dem Ton C von 64 Schwingungen ist aber davon keine Spur mehr zu entdecken. Übrigens ist zu bemerken, daß einfache Töne, auch wenn noch die einzelnen Luftstöße derselben empfunden werden, niemals jene Rauhigkeit zeigen, welche bei den Schwebungen beobachtet wird, und welche eben in dem raschen Wechsel zwischen den zwei dissonierenden Tönen ihre Ursache hat.
Wie einfache Töne mit einander Schwebungen bilden und dadurch Dissonanz erzeugen können, so ist dies auch bei den verschiedenen Partialtönen zusammengesetzter Klänge möglich. Von den einzelnen Bestandteilen eines Klanges können entweder die Grundtöne mit einander Dissonanz geben; dann ist diese wegen der überwiegenden Stärke des Grundtons so mächtig, daß die Dissonanzen der Obertöne, die hierbei nie fehlen, dagegen verschwinden. Oder es können die Grundtöne konsonant sein, aber die Obertöne derselben eine mehr oder weniger scharfe Dissonanz erzeugen. In solchem Falle ist die Dissonanz geringer als im vorigen, und sie richtet sich in ihrer Stärke nach der Intensität der dissonierenden Obertöne, also in der Regel nach der Ordnungszahl derselben, da bei den meisten musikalischen Klängen die Stärke der Obertöne mit der Höhe abnimmt. Zu Dissonanzen der Obertöne müssen gerade solche Klangintervalle leicht Anlaß geben, welche sich einem einfachen Verhältnis der Schwingungszahlen annähern, ohne aber dasselbe vollständig zu erreichen. Jenen einfachen Intervallen entsprechen nämlich regelmäßig übereinstimmende Obertöne. So ist z. B. für das Verhältnis Grundton und Quinte (c : g) die Duodecime des Grundtons (g') zugleich die Oktave der Quinte, also ein coinzidirrender Oberton beider Klänge. Werden nun die beiden Töne um einige Schwingungen verstimmt, so werden deshalb zwischen den beiden Grundtönen keine Schwebungen bemerkt, aber die Obertöne g' sind für beide Klänge nicht mehr identisch, sie müssen daher Schwebungen mit einander bilden, deren Zahl genau der Anzahl von Schwingungen entspricht, um welche die beiden Grundtöne von einander abweichen. In einem ähnlichen Verhältnis stehen noch weitere Obertöne der beiden Klänge. So findet man z. B. für das Verhältnis Grundton und Quinte, daß außer der Duodecime oder dem dritten Partialton des Grundtons noch der 5te, 7te, 9te u. s. w. mit dem 4ten, 6ten, 8ten u. s. w. der Quinte zusammenfällt. Alle diese Obertöne müssen daher auch, sobald sie nicht mehr genau coinzidieren, Schwebungen mit einander bilden. Mehrere neben einander herlaufende Klänge müssen also um so genauer in ihren Grundtönen auf harmonische Intervalle gestimmt sein, je mehr sie von Obertönen begleitet sind. Die Konsonanz der Obertöne ist daher auch das hauptsächlichste Mittel, um Klänge nach harmonischen Intervallen zu stimmen, ein Umstand, welcher die allgemeine Verwechslung von Konsonanz und Harmonie teilweise erklärt78).
78) Über die Dissonanz der Obertöne bei verschiedenen Intervallen vgl. HELMHOLTZ a. a. O. S. 287 f.
Gleich den Obertönen können endlich auch
die Kombinationstöne Schwebungen hervorbringen. Bei einfachen, der
Obertöne entbehrenden Klängen sind die Schwebungen der Kombinationstöne
eine häufige Ursache der Dissonanz, da bei musikalischen Zusammenklängen
die primären Töne selten einen so geringen Unterschied der Schwingungszahlen
besitzen, daß Schwebungen derselben möglich sind. Bei komplizierteren
Verbindungen zusammengesetzter Klänge aber ist, wie man hieraus sieht,
in der mannigfachsten Weise Gelegenheit zur Erzeugung von Dissonanz gegeben,
indem zuerst zwischen den Grundtönen, dann zwischen den Obertönen,
endlich zwischen den Kombinationstönen und den Bestandteilen der primären
Klänge Schwebungen entstehen können. So setzt sich denn meistens
eine Störung des Zusammenklanges aus Dissonanzen verschiedenen Grades
zusammen; der Störungswert jeder einzelnen derselben bemißt
sich erstens nach der relativen Stärke der schwebenden Partialtöne
und zweitens nach der Zahl ihrer Schwebungen. In letzterer Beziehung läßt
sich nur angeben, daß das Maximum der Störung etwa bei 30 Schwebungen
in der Sekunde erreicht ist und von da nach beiden Seiten rasch abnimmt;
ein quantitatives Maß für den Störungswert einer gegebenen
Dissonanz läßt sich aber, wegen der Mannigfaltigkeit der zusammenwirkenden
Faktoren, bis jetzt nicht aufstellen.
Unsere Lichtempfindungen unterscheiden wir
nach drei veränderlichen Bestimmungen: 1) Nach der Qualität
der Farbe oder dem Farbenton. 2) Nach der Sättigung
der Farbe oder dem Grad, in welchem eine Farbenempfindung dem Weiß
sich nähert. Wir nennen nämlich eine Farbe um so gesättigter,
je weniger Weiß ihr beigemischt ist; das Weiß selbst nebst
seinen Intensitätsabstufungen bis zum Schwarz kann in diesem Sinne
als der geringste Sättigungsgrad einer jeden Farbe betrachtet werden.
3) Nach der Lichtintensität oder der Stärke der
Empfindung. Von diesen drei Modalitäten der Lichtempfindung ist im
allgemeinen die erste, der Farbenton, von der Wellenlänge, die zweite,
die Sättigung, von der Beimengung von Licht anderer Wellenlänge,
die dritte, die Lichtstärke, von der Schwingungsamplitude abhängig.
Farbenqualität, Sättigung und Lichtstärke sind nun aber
nicht, wie z. B. die Höhe und Stärke der Töne, unabhängig
veränderliche Bestandteile der Empfindung. Doch wollen wir von diesem
Punkte, auf den wir unten zurückkommen werden, zunächst absehen,
und jene drei Eigenschaften vorläufig so untersuchen, als wenn sie
wirklich völlig unabhängig von einander variiert werden könnten.
Demnach werden wir der Untersuchung der Qualität hier nur die einfachen
oder gesättigten Farben zu Grunde legen, das Weiß aber,
obgleich es mit demselben Recht wie jede Farbe als eine Empfindungsqualität
betrachtet werden kann, soll erst bei der Sättigung zur Sprache kommen,
weil es in der Stufenfolge der Sättigungsgrade einer Farbe den der
vollkommenen Sättigung gegenüberstehenden Grenzfall bildet. Endlich
die Intensitätsabstufungen des Weiß werden nebst den Intensitäten
der Farben an dritter Stelle besprochen werden.
Es gibt nur einen einzigen Weg, um einfache Farbenempfindungen
in vollständiger Sättigung herzustellen: er besteht in der Zerlegung
des gewöhnlichen gemischten oder weißen Lichtes durch Brechung
in die einzelnen einfachen Lichtarten von abgestufter Wellenlänge
und Brechbarkeit79). Läßt man
durch einen Spalt im Fensterladen eines verdunkelten Zimmers einen Sonnenstrahl
auf ein dreiseitiges Flintglasprisma fallen, so wird der weiße Strahl
in Folge der verschiedenen Brechbarkeit der Lichtarten von verschiedener
Wellenlänge, die ihn zusammensetzen, in eine Reihe farbiger Strahlen,
ein Spektrum, aufgelöst. Das Licht von der größten Wellenlänge
wird am schwächsten, das Licht von der kleinsten am stärksten
gebrochen. Jenes empfinden wir Rot, dieses Violett, und zwischen beiden
folgen Orange, Gelb, Grün, Blau80),
Indigblau stetig aufeinander (Fig.
87)81).
Ein in der Richtung der aus dem Prisma austretenden Strahlen blickendes
Auge nimmt diese Farbenreihe unmittelbar als ein subjektives Spektrum
wahr. Bringt man an Stelle des Auges eine Sammellinse von geeigneter Stärke
und hinter dieser einen weißen Schirm an, so wird auf dem letzteren
ein objektives Spektrum in Form eines farbigen Bandes entworfen.
Durch wiederholte Brechung in mehreren hinter einander aufgestellten Prismen
lassen sich die einzelnen Spektralfarben noch vollständiger von einander
isolieren82). Alle auf anderem Wege, nicht
durch Zerlegung des Sonnenlichtes, gewonnenen Farben besitzen keine vollständige
Sättigung, so also namentlich auch diejenigen, welche in Folge der
Absorption entstehen, die gewisse Strahlen des weißen Lichtes bei
der Brechung und Reflexion erfahren. Von farbigen Gläsern oder farbigen
Pigmenten kommt daher immer Licht verschiedener Brechbarkeit, wie durch
Zerlegung solchen Lichtes mittelst des Prismas sich zeigen läßt.
79) Die Zerlegung durch Beugung oder Interferenz liefert keine hinreichend vollständige Trennung und daher keine vollkommen gesättigten Farben.
80) Für das reine Blau wird häufig der Ausdruck Cyanblau (Cyaneum nach Newton) angewandt.
81) Die folgende kleine Tabelle enthält die aus den
Interferenzversuchen berechneten Wellenlängen in Hunderttausendteilen
eines Millimeter und die entsprechenden Schwingungszahlen in Billionen
auf die Sekunde. Die FRAUNHOFER'sche Linie, aus deren Umgebung der Farbenton
genommen wurde, ist in Klammer beigefügt.
Wellenlänge. Schwingungszahl.
Rot (B) . . . . 6878 450
Rot (C) . . . . 6564 472
Gelb (D) . . . . 5888 526
Grün (E) . . . . 5260 589
Blau (F) . . . . 4843 640
Indigblau (G) . . . . 4291 722
Violett (H) . . . . 3928 790
Bei Abblendung des übrigen Spektrums läßt
sich noch eine kleine Strecke jenseits der dunkeln Linie L, welche
das gewöhnlich sichtbare Violett begrenzt, eine Farbe erkennen, das
Ultraviolett, welches bis zu einer Linie R reicht, die einer Wellenlänge
von 3108 (Schwingungszahl 912) entspricht. Das Rot läßt sich
unter günstigen Umständen bis zu einer Linie A mit der
Wellenlänge 7617 (Schwingungszahl 412) erkennen. Im Spektrum des Rubidiumdampfes
erscheinen aber noch etwas jenseits von A zwei intensiv rote Linien.
82) Die bezüglichen Methoden vgl. bei Helmholtz, physiologische Optik S. 261 f., oder in meiner med. Physik S. 235 f.
Die einfachen Farben des prismatischen Spektrums bilden eine Reihe stetig in einander übergehender Empfindungen. Es fehlen zwar in dem Spektrum gewisse Stufen der Brechbarkeit, wie sich an den dunkeln Linien, von denen dasselbe durchzogen ist, den FRAUNHOFER'schen Linien, erkennen läßt. Aber diesem Wegfall gewisser Wellenlängen des objektiven Lichtes entspricht keine Unstetigkeit der Empfindung, denn die Farben zu beiden Seiten einer jeden dunkeln Linie erscheinen vollkommen gleich. Die Abstufung in der Qualität der Empfindung geschieht langsam genug, daß für sie jene Unstetigkeit in der Abstufung der Wellenlängen nicht in Rücksicht fällt. Die Mannigfaltigkeit der einfachen Farben kann demnach, ähnlich der Tonreihe, durch eine Linie dargestellt werden. Jede qualitativ bestimmte Farbenempfindung bildet einen Punkt dieser Linie, von welchem man stetig durch allmälige Übergänge zu jedem beliebigen andern Punkte derselben gelangen kann. Aber die Farbenlinie unterscheidet sich von der Tonlinie zunächst dadurch, daß eine bestimmte, den Abstufungen des äußeren Reizes entsprechende Stufenfolge der Empfindungen nicht nachweisbar ist. Eine Farbenskala, in dem Sinne wie es eine Tonskala gibt, existiert nicht83). Wollten wir die Farbenreihe in ähnlicher Weise quantitativ abstufen wie die Tonreihe, so könnten wir dazu nicht endliche Intervalle sondern, wie bei der Intensitätsmessung, nur eben merkliche Unterschiede verwenden84). Sodann zeigen die Farbenempfindungen die bemerkenswerte Eigentümlichkeit, daß die zwei an den beiden Enden des Spektrums stehenden Farben, das Rot und Violett, in ihrer qualitativen Beschaffenheit sich wieder einander nähern, demnach sich ähnlich verhalten wie zwei im Spektrum benachbarte Farben, z. B. Rot und Orange oder Blau und Indigblau. Die Farben bilden also nicht, wie die Töne, eine Linie, die immer in derselben Richtung fortschreitet, sondern das Ende dieser Linie nähert sich wieder ihrem Anfang. Dies bedeutet offenbar, daß die genannte Linie keine gerade ist, sondern eine irgendwie gekrümmte oder geknickte Form hat. Die Verwandtschaft zwischen den beiden Endfarben des Spektrums tritt am deutlichsten darin zu Tage, daß, wenn man dieselben mischt, eine Farbe entsteht, welche alle möglichen Übergangstöne zwischen Rot und Violett enthält. Diese Farbe ist das Purpur. Dasselbe liegt dem Rot näher, wenn in der Mischung das Rot überwiegt (Karmesinrot), es nähert sich dem Violett, wenn von dieser Farbe mehr in die Mischung eingeht (eigentliches Purpur). Hiernach läßt sich die Mannigfaltigkeit der einfachen Farben als eine gekrümmte Linie darstellen, deren Enden sich nähern, am einfachsten als eine Kreislinie, der ein kleines Bogenstück zum vollständigen Kreise fehlt: nimmt man die durch Mischung der Endfarben des Spektrums erzeugbaren Farbentöne hinzu, so wird damit auch dieser Bogen ergänzt. Unsere Farbenempfindungen bilden nun eine in sich zurücklaufende Linie. Hiermit hängt ein weiterer Unterschied der Farben- von den Tonempfindungen zusammen. Die Farbenlinie läßt sich nicht wie die Tonlinie nach beiden Richtungen ins unendliche fortgesetzt denken, sondern der Umfang der Farbenempfindungen ist ein in sich begrenzter. Ja es scheint, als wenn, falls wir uns die Veränderung des Violett und des Rot, wie sie gegen die Enden des Spektrums hin stattfinden, weiter fortgeführt denken wollten, dies nur in der Richtung der Farbentöne des Purpur geschehen könnte. Doch mag es sein, daß dies mehr auf Erfahrung als auf ursprünglicher Empfindung beruht85). Übrigens ist der Kreis zwar die einfachste Form, die wir für die Farbenlinie voraussetzen können, aber keineswegs die einzige; eine Ellipse oder irgend eine andere gegen ihren Ausgangspunkt zurücklaufende Kurve, ja eine geknickte, irgendwie aus gekrümmten oder geraden Teilen zusammengesetzte Linie, z. B. ein geradliniges Dreieck, würde sie ebenso gut darstellen. Bedingung bei allen diesen Darstellungen bleibt nur, daß die beiden Enden sich wieder nähern und, wenn man die Ergänzung durch Purpur hinzu nimmt, in einander übergehen. Die purpurnen Farbentöne sind aber zugleich die einzigen unter allen Mischfarben, denen keine der einfachen Farben des Spektrums gleich ist. Mit der Ergänzung durch Purpur stellt also unsere Farbenlinie alle überhaupt möglichen gesättigten Farbenempfindungen dar.
83) Die Versuche eine solche nachzuweisen sind vorzugsweise auf Betrachtungen über die so genannte Harmonie der Farben gegründet, der man eine ähnliche Ursache wie der Harmonie der Töne zuschrieb. Der einzige Grund, der sich hierfür aus der Natur der einfachen Farben und Farbenempfindungen entnehmen ließe, wäre etwa der, daß dem äußersten Violett nahezu die doppelte Schwingungszahl als dem Anfang des Rot entspricht. Aber erstens ist dies nicht einmal strenge richtig, da der Umfang des gewöhnlich sichtbaren Spektrums nicht ganz einer Oktave gleichkommt (vgl. die Tabelle Anm. 81), und zweitens enthält jener Umstand noch gar kein Motiv zu einer quantitativen Abstufung der zwischenliegenden Farbentöne. Ebenso wenig läßt sich freilich daraus, daß die gewöhnlich empfindbaren Farben nicht einmal das Intervall einer Oktave umfassen, ein Grund gegen die Analogie mit der Tonskala entnehmen, da eben unter gewissen Umständen die Farbenempfindung noch über das Intervall einer Oktave ausgedehnt werden kann (s. oben a. a. O.). Entscheidender ist die Tatsache, die wir unten kennen lernen werden, daß zwei einfache Farben gemischt eine Empfindung verursachen können, welche der zwischenliegenden einfachen Farbe entspricht, während aus zwei einfachen Tönen niemals wieder eine einfache Tonempfindung entsteht. Zur Widerlegung der Übertragung der Tonintervalle auf die Farbenverhältnisse, welche wohl nur der Autorität newton's ihre Bedeutung verdankt hat, bedarf es übrigens kaum des Hinweises auf diese tiefgreifenden Differenzen zwischen beiden Sinnen. Daß wir die Farbenintervalle nicht in eine ähnliche abgestufte Reihe ordnen wie die Tonintervalle, ist lediglich eine Tatsache der unmittelbaren Empfindung.
84) Nach diesem Prinzip, nicht nach der Analogie mit der Tonskala, wie es mehrfach geschehen ist (Newton, optice lib. I, pars II, Tab. III Fig. 11. HELMHOLTZ, physiol. Optik Taf. IV, Fig. 1), müssen in der Tat die einzelnen Farbentöne des Spektrums nach ihrer Breite bestimmt werden, wenn man eine der Abstufung der Empfindung entsprechende Reihe erhalten will. (Siehe hierüber unten.) Die Abmessungen im Spektrum, die nach der Substanz des brechenden Prismas wechseln, stehen natürlich hierzu in gar keiner Beziehung.
85) Die gewöhnlich nicht sichtbaren brechbarsten Strahlen des Spektrums, die aber bei Ausschluß alles andern Lichtes sichtbar gemacht werden können, die übervioletten Strahlen, erscheinen allerdings nicht purpurfarben, sondern bläulicher als das eigentliche Violett. Aber dies ist kein Widerspruch gegen die Annahme eines Zurücklaufens der Farbenkurve. Denn jener bläuliche Farbenton wird zweifellos durch die Fluoreszenz der Netzhaut bedingt, welche bei den übervioletten Strahlen im Verhältnis zur Intensität der Empfindung ihre größte Stärke erreicht. Das Fluoreszenzlicht ist nämlich weißlich, Weiß mit Violett gemischt gibt aber einen bläulichen Farbenton.
Will man die Farbenlinie ohne Rücksicht auf
die später zu besprechenden Mischungserscheinungen, bloß nach
der Abstufung der Empfindung konstruieren, so ist der Kreis die einfachste
Form, weil der Kreis die einfachste in sich zurücklaufende Linie ist.
Es bleibt dann aber noch die Ausdehnung, die den einzelnen Farbentönen
gegeben werden soll, willkürlich. Sollte hierfür aus der unmittelbaren
Empfindung ein Maß genommen werden, so würde, da wir eine Empfindung
für die Abstufung endlicher Farbenintervalle nicht besitzen, nur übrig
bleiben, ahnlich wie bei der Abstufung der Empfindungsintensität,
von der Empfindung für eben merkliche Unterschiede auszugehen. Nun
herrscht im Gelb die größte Empfindlichkeit für den Wechsel
des Farbentons, dann kommt Blau und Blaugrün; im Grün ist dieselbe
geringer, und ebenso nimmt sie gegen das violette und rote Ende des Spektrums
bedeutend ab. Die größte Bogenlänge auf dem Farbenkreis
würden daher einerseits das Gelb, anderseits das Blau, die kleinste
das Rot und Violett und nach ihnen das Grün einnehmen. Es sind dies
die nämlichen Farben, welche, wie wir unten sehen werden, auch bei
den Erscheinungen der Farbenmischung eine ausgezeichnete Rolle spielen.
In Fig. 88 ist diese
Abstufung durch die Breite der einzelnen Sektoren angedeutet. Genauer ergeben
Versuche von MANDELSTAMM folgende Verhällniszahlen
für die Unterschiedsempfindlichkeit der einzelnen Farbentöne:
Im Rot (Linie C)
Gelb (D) Gelbgrün
(D bis E)
Grün (E)
1/19
1/465
1/205
1/214
Grünblau (b bis F)
Blau (F) Indigblau
(G) 86)
1/400
1/410
1/270
86) Nach MANDELSTAMM (Archiv f. Ophtbalmologie XIII, 2 S. 399) ist nämlich der relative Zuwachs der Wellenlänge, der erfordert wird, damit ein Unterschied im Farbenton wahrgenommen werde, im Gelb bei der FRAUNHOFER'schen Linie D = 0,00215, im Blau bei F und zwischen b und F im Blaugrün = 0,00244 - 0,00250, im Grün bei E = 0,00467, zwischen D und E = 0,00488, bei G im Indigo = 0,0037, endlich am größten bei C im Rot = 0,0528; an der violetten Grenze waren sichere Bestimmungen nicht mehr möglich. Hieraus sind die obigen Verhältniszahlen berechnet. In Fig. 88 sind natürlich diese Maßverhältnisse nicht eingehalten, sondern es ist nur durch die ungefähre Breite der Sektoren die Größe der Empfindungsabstufung für die einzelnen Farben angedeutet worden. Um für das Purpur die entsprechenden Zahlen zu gewinnen, müßte man die eben merklichen Mischungsänderungen von Rot und Violett als Maße der Unterschiedsempfindlichkeit benutzen, es liegen jedoch hierüber noch keine Versuche vor.
Unter den einfachen Farben gibt es einzelne, die
durch eine bestimmtere Qualität sich auszeichnen, so daß die
andern unmittelbar als Übergangsstufen zwischen ihnen empfunden werden,
während ihnen selbst eine durchaus eigentümliche Qualität
zukommt. Als solche Hauptfarben lassen sich nur Rot, Gelb,
Grün und Blau unterscheiden, wie dies auch die Sprache
bezeugt, welche allein für sie besondere Namen geschaffen hat. Schon
das Violett, die Farbe der Veilchen, läßt unmittelbar die Verwandtschaft
einerseits mit Blau, anderseits mit Rot erkennen, und noch zweifelloser
erscheinen die übrigen Farbentöne, wie Indigblau, Orangegelb,
Gelbgrün u. s. w. als Zwischenstufen. Man kann daher diese Farben
auch zum Unterschied von den oben genannten vier Hauptfarben die Übergangsfarben
nennen, wobei jedoch wieder, wenn auch das Violett als Übergangsfarbe
gelten soll, das Purpur zur Ergänzung der Farbenreihe hinzugenommen
werden muß.
Die Tatsache, daß es vier Hauptfarben gibt,
läßt sich aus der objektiven Natur der verschiedenen Lichtqualitäten
natürlich nicht ableiten. Demnach kann der Grund für dieselbe
nur in der subjektiven Natur der einfachen Farbenlinie gelegen sein. Nun
läßt sich, wenn wir die Farbenreihe als eine in sich zurücklaufende
Kurve betrachten, bei der man von unmerklichen zu merklichen und dann zu
immer mehr übermerklichen Unterschieden übergeht, im allgemeinen
begreifen, daß es für jeden Punkt derselben einen andern geben
müsse, der einer Empfindung von der größtmöglichen
qualitativen Verschiedenheit entspricht. Bei der oben angedeuteten Ausmessung
der Bogenlängen des Farbenkreises nach Graden der Unterschiedsempfindlichkeit
sind, wenn man sich die Ergänzung durch Purpur in den entsprechenden
Maßverhältnissen aufgetragen denkt88),
als Punkte der größten Farbendifferenz solche zu betrachten,
welche von den Enden je eines Kreisdurchmessers berührt werden. Die
vier Hauptfarben aber sind jene, welche man erhält, wenn zuerst das
zwischen den Enden des Spektrums gelegene Purpur mit der ihm gegenüberliegenden
mittleren Spektralfarbe Grün durch einen Durchmesser verbunden und
außerdem der hierauf senkrechte Durchmesser gezogen wird: der letztere
verbindet dann die zwei weiteren Hauptfarben Gelb und Blau (Fig.
88). Das Purpur statt des Rot zu wählen, ist deshalb gerechtfertigt,
weil es die gleich ausgeprägte Differenz zu den drei anderen Hauptfarben
zeigt, zugleich aber die subjektive Verwandtschaft der beiden Endfarben
des Spektrums zu einem deutlichen Ausdruck bringt. Ist eine Hauptfarbe
bestimmt, so sind demnach die drei andern von selbst als diejenigen gegeben,
die auf dem nach Einheiten der Unterschiedsempfindlichkeit konstruierten
Farbenkreis um je 90° von einander entfernt sind. Die Bedeutung der
Hauptfarben liegt dann darin begründet, daß dieselben in der
Kurve, welche den Gang der Unterschiedsempfindlichkeit für die verschiedenen
Wellenlängen des Lichtes darstellt, eine ausgezeichnete Stellung einnehmen.
88) Über die Breite, die hierbei dem Purpur zu geben wäre, vergl. obere Anm.
Diese Bedeutung läßt sich auch noch in
folgender Weise zur Darstellung bringen. Man denke sich die Bogenstücke
des Farbenkreises, durch welche die Unterschiedsempfindlichkeit gemessen
wird, in senkrechte Ordinaten verwandelt und auf eine Abszissenlinie aufgetragen,
deren Einheiten eben merkliche Unterschiede der Empfindung sind. Jede Ordinate
soll demnach jenem Unterschied der Wellenlängen, welcher eine eben
merkliche Änderung der Empfindung herbeiführt, umgekehrt proportional
sein. Man erhält so eine Kurve ungefähr von der Form, wie sie
in Fig. 89 dargestellt
ist. Dieselbe erhebt sich beim Rot, erreicht beim Gelb ihr erstes Maximum,
fällt dann im Grün zu einem relativen Minimum, steigt im Blau
zu einem zweiten Maximum und sinkt endlich im Violett wieder. Die drei
ausgezeichneten Punkte dieser Kurve entsprechen den drei gegen die Mitte
des Spektrums gelegenen Hauptfarben, die vierte wird durch die einen übereinstimmenden
Farbenton gebenden Anfangs- und Endpunkte gewonnen. Auch die Form dieser
Kurve macht deutlich, daß die Farbenlinie an und für sich zwischen
endlichen Grenzen eingeschlossen ist, im Unterschied von der Tonlinie,
bei welcher der logarithmische Gang der Funktion zeigt, daß man sich
die Abstufung der Empfindung nach beiden Seiten in's unendliche fortgesetzt
denken kann.
Als Sättigung der Farbe haben wir jene
Eigentümlichkeit der Lichtempfindung bezeichnet, welche durch die
mehr oder weniger bedeutende Beimengung weißen Lichtes zu einer reinen
Spektralfarbe bedingt wird. Das Weiß selbst läßt sich
daher als der geringste Grad der Sättigung betrachten, und als gleichbedeutend
mit Weiß müssen in dieser Beziehung dessen verschiedene Intensitätsabstufungen,
Grau und Schwarz, gelten. Der Begriff einer gesättigten Empfindung
ist übrigens kein vollkommen feststehender, denn er ist von unserer
wechselnden Empfindlichkeit abhängig. Ist z. B. unser Auge für
Licht von einer gewissen Farbe abgestumpft, so kann uns eine geringe Beimengung
derselben entgehen: es kann also ein etwas gefärbtes Licht vollkommen
weiß erscheinen. Auf der andern Seite besitzen die Empfindungen,
welche die reinen Spektralfarben im unermüdeten Auge erzeugen, nicht
die größte Sättigung, welche einer Farbe überhaupt
zukommen kann. Haben wir z. B. unser Auge für grünes Licht ermüdet,
so erscheint das spektrale Rot in den ersten Augenblicken der Betrachtung
gesättigter, als es gewöhnlich vom unermüdeten Auge gesehen
wird. Der Begriff der Sättigung ist also ein Grenzbegriff, dem sich
unsere realen Empfindungen mehr oder weniger annähern können,
ohne daß von einer bestimmten Empfindung sich sagen ließe,
daß sie absolut gesättigt sei. Wenn wir die reinen Spektralfarben,
wie sie dem unermüdeten Auge erscheinen, zum Maß gesättigter
Farbenempfindungen nehmen, so hat dies nur die Bedeutung, daß sie
unter unsern wirklichen Empfindungen in der Tat im allgemeinen am meisten
gesättigt sind. Weiß, Grau oder Schwarz aber nennen wir alle
jene Empfindungen, in denen keine farbige Beimengung mehr wahrnehmbar ist,
und wir sehen hierbei ganz davon ab, ob die objektive Beschaffenheit solchen
Lichtes der des Sonnenlichtes entspricht. Im Gegenteil muß von vornherein
betont werden, daß nicht nur das gemischte Sonnenlicht unter gewissen
Umständen, die großenteils von der wechselnden Empfindlichkeit
des Auges abhängen, farbig, sondern daß auch anderes Licht,
welchem einzelne Wellenlängen des Sonnenlichtes fehlen, weiß
gesehen werden kann. Das Weiß ist lediglich eine Sache unserer Empfindung
und kann daher auch nur nach dieser bemessen werden.
Die gewöhnliche Weise, durch welche aus gesättigten
Empfindungen solche von geringerem Sättigungsgrade entstehen, besteht
in der Mischung der gesättigten Farben. Es ist dies zugleich
der einzige Weg, auf welchem, wenn die Empfindlichkeit der Netzhaut ungeändert
bleibt, die Sättigung der Empfindung ohne gleichzeitige Änderung
der Reizstärke geändert werden kann, der einzige also, der hier
überhaupt in Frage kommt, da uns der Einfluß der Empfindungsintensität
auf die Qualität der Farbenempfindung erst später beschäftigen
soll.
Eine Mischung gesättigter oder nahehin gesättigter
Farben läßt sich nach verschiedenen Methoden bewerkstelligen.
Man kann entweder direkt Spektralfarben mischen, indem man die einzelnen
Strahlen des prismatischen Spektrums wieder durch Brechung vereinigt, oder
man kann das von Pigmenten reflektierte Licht mischen, wobei freilich die
in die Mischung eingehenden Komponenten niemals die Sättigung der
Spektralfarben besitzen. Statt der direkten Mischung der Ätherwellen
lassen sich aber auch gleichsam die Empfindungen mischen, indem man mittelst
des Farbenkreisels in sehr rascher Zeitfolge auf eine und dieselbe Stelle
der Netzhaut verschiedenartige Eindrücke einwirken läßt.
Nach allen diesen Methoden findet man zunächst, daß die Mischung
aller Spektralfarben in dem Intensitätsverhältnis, wie sie das
Sonnenspektrum darbietet, Weiß erzeugt, eine Tatsache, welche nur
den aus der Zerlegung des gemischten Sonnenlichtes in die einzelnen Spektralfarben
folgenden Schluß bestätigt. Man findet aber ferner, daß
derselbe Erfolg durch eine geringere Anzahl, ja bei geeigneter Wahl durch
zwei einfache Farben bereits herbeigeführt werden kann. Zwei
Farben, die im Spektrum einander nahe stehen, geben nämlich zusammen
gemischt einen Farbenton, der auch in der Reihe der Spektralfarben zwischen
ihnen gelegen ist; dieser nimmt, wenn die Farben weiter auseinander rücken,
allmälig eine weißliche Beschaffenheit an, und bei einem bestimmten
Unterschiede der Mischfarben geht, wenn dieselben in den geeigneten Intensitätsverhältnissen
zusammenwirken, die resultierende Farbe in Weiß über. Wählt
man die Distanz der Spektralfarben noch größer, so entsteht
dann wieder eine Farbe, diese liegt aber nicht mehr in der Mitte zwischen
den beiden Mischfarben, sondern zwischen der zweiten (brechbareren) Farbe
und dem Ende des Spektrums, oder sie ist, wenn die Enden des Spektrums
selber gemischt werden, Purpur. Jene Farben nun, welche in den geeigneten
Intensitätsverhältnissen mit einander gemischt Weiß geben,
nennt man Ergänzungsfarben (Komplementärfarben). Auf diese Weise
findet man, das
Rot und Grünblau,
Orange und Blau,
Gelb und Indigblau,
Grüngelb und Violett
einander komplementär sind89).
Das Grün des Spektrums hat keine einfache Farbe sondern Purpur zur
Komplementärfarbe. Aus dieser Zusammenstellung folgt nach dem obigen
von selbst, daß Rot mit einer vor Grünblau gelegenen Farbe,
z. B. Grün, gemischt, je nachdem Rot oder Grün mehr überwiegt,
sukzessiv Orange, Gelb, Gelbgrün gibt, daß dagegen Rot mit Blau
gemischt Indigblau oder Violett hervorbringt, und ähnlich bei den
übrigen Farben. Aus diesen Tatsachen lassen sich nun sogleich Bedingungen
entwickeln, durch welche die Gestalt der Farbenlinie, statt wie oben nach
der Abstufung der Farbenempfindung, vielmehr nach dem gegenseitigen Verhalten
der einzelnen einfachen Farben bei Mischungen näher bestimmt wird.
Man kann z. B. die Farbenlinie so konstruieren, daß je zwei Komplementärfarben
durch eine gerade Linie von konstanter Länge verbunden werden: dann
wird sie wieder zu einem Kreise. In diesem entsprechen aber den einzelnen
Farbentönen andere Bogenlängen, als wenn man wie oben, die Unterschiedsempfindlichkeit
zum Maße nimmt. Sucht man ferner dem Mischungsgesetz einen quantitativen
Ausdruck in der Farbenkurve zu geben, so kann dies folgendermaßen
geschehen. Man stellt die Bedingung, daß, wie im Farbenkreis, alle
zwischen je zwei Komplementärfarbenpaaren gezogenen Geraden in einem
einzigen Punkte sich schneiden, dagegen sollen diese Geraden nicht mehr
einander gleich sondern so bestimmt sein, daß die Entfernung je einer
Komplementärfarbe vom Durchschnittspunkt umgekehrt proportional ist
der Intensität, in welcher sie, spektrale Sättigung vorausgesetzt,
angewandt werden muß, um Weiß zu erzeugen; oder mit andern
Worten: die Teile der Geraden, welche zu beiden Seiten des Durchschnittspunktes
liegen, sollen der komplementären Wirksamkeit der entsprechenden Spektralfarben
direkt proportional sein. Unter dieser Bedingung erhält man die in
Fig. 90 dargestellte
Kurve, welche einem Dreieck sich nähert, aber statt des Winkels an
der Spitze (bei G) einen Bogen hat. Die Grundlinie zwischen R
und V entspricht dem Purpur (P). W ist der Durchschnittspunkt
aller Geraden, die je zwei Komplementärfarben verbinden. Diese werden
sämtlich durch den Punkt W so geteilt, daß z. B. V.V
W = G'.G'W ist, wenn V die Intensität des Violett, G'
die des komplementären Gelbgrün bedeutet, während V W
und G' W die geradlinigen Entfernungen der Punkte V und G'
der Farbenkurve von W bezeichnen. Man kann sich, wie dies schon
NEWTON90) getan hat,
die in W zusammenlaufenden Linien als Hebelarme vorstellen, an welchen
die einzelnen Farben als Gewichte wirken: dann bedeutet W den Schwerpunkt
des Farbensystems, und die Bedingung für die Wahl komplementärer
Farbenintensitäten ist, daß diese als Kräfte betrachtet
mit einander im Gleichgewicht stehen müssen.
89) GRASSMANN , POGGENDORFF's Annalen, Bd. 89, S. 78.
90) Optice lib. I, pars II, prop. VI.
Durch die hier gewählte Form der Kurve wird
noch eine weitere Tatsache ausgedrückt, die bei der Farbenmischung
zur Geltung kommt. Mengt man nämlich zwei Spektralfarben, die nahe
bei einander und zugleich nahe dem einen oder andern Ende des Spektrums
liegen, so hat die resultierende Mischfarbe spektrale Sättigung. Spektrales
Rot und Gelb (R + G b) gemischt geben also ein spektrales
Orange (O), ebenso spektrales Violett und Blau (V + B)
ein spektrales Indigblau (J). Dies ist aber nicht mehr der Fall
bei den Farben, die der Mitte des Spektrums, dem Grün, sich nähern.
Hier entsteht durch die Mischung nahe stehender Farben immer ein minder
gesättigter, also weißlicherer Farbenton, als ihn die zwischenliegende
Spektralfarbe besitzt. Demgemäß verläuft die Kurve einerseits
vom Rot bis zum Gelbgrün (R bis G'), anderseits
vom Violett bis zum Blaugrün (V bis B') geradlinig,
in der Gegend des Grün aber ist sie gebogen.
Die Modifikationen, welche der Farbenkurve gegeben
werden müssen, um das Verhalten der Farben in Mischungen auszudrücken,
führen unmittelbar zur Ergänzung derselben durch die gleichzeitige
Darstellung der möglichen Sättigungsgrade. Bleiben wir beim Farbenkreis
stehen, so läßt sich der Mittelpunkt desselben, in welchem sich
alle je zwei Komplementärfarben verbindende Durchmesser schneiden,
als der Ort des Weiß betrachten (Fig.
88). Die verschiedenen Sättigungsstufen einer Farbe liegen
dann sämtlich auf dem Halbmesser, welcher die der gesättigten
Farbe entsprechende Stelle der Peripherie mit dem Mittelpunkte verbindet.
Denkt man sich den ganzen Kreis in einzelne Ringe geteilt, so enthallen
diese von außen nach innen immer weißlichere Farbentöne,
innerhalb jedes Ringes findet aber ein ebenso stetiger Übergang der
einzelnen Farbentöne in einander statt wie bei den die Peripherie
einnehmenden gesättigten Farben. Man hat also zweierlei stetige Übergänge:
einen in Richtung des Halbmessers von den gesättigten zu den minder
gesättigten Farbentönen, und einen zweiten in Richtung des Winkelbogens
von einem Farbenton zum andern. Je kleiner der auf denselben Winkelgrad
fallende Bogen wird, d. h je mehr man sich dem Mittelpunkt nähert,
um so kleiner werden die Unterschiede der Farbentöne, bis sie endlich
im Mittelpunkt ganz aufhören, denn hier stellt das Weiß für
alle Farben zugleich das Minimum der Sättigung dar. Wie demnach die
Farbentöne für sich genommen ein Kontinuum von einer,
so bilden sie im Verein mit den Sättigungsgraden betrachtet ein Kontinuum
von zwei Dimensionen, und wie die Kreislinie die Farbentöne,
so stellt die Kreisfläche sie und ihre Sättigungen in
der einfachsten Form dar. Auch hier reicht jedoch die Kreisflache nicht
aus, wenn die dargestellte Form zugleich die quantitative Seite des Mischungsgesetzes
ausdrücken soll, sondern dann wird das Farbensystem durch die von
der Kurve in Fig. 90
umgrenzte Fläche versinnlicht. Der Schwerpunkt W ist hier der
Ort des Weiß, und auf den Geraden, die von der Peripherie der Kurve
nach dem Punkte W gezogen werden, liegen die weißlichen Farbentöne.
Die so gewonnene Farbenfläche hat dann nicht bloß für die
Mischung der Komplementärfarben zu Weiß, sondern überhaupt
für die Entstehung beliebiger Mischfarben aus einfachen Farben ihre
Bedeutung. Der an der Stelle f gelegene Farbenton z. B. wird durch
Mischung zweier Farben R und B erhalten, deren Intensitätsverhältnis
durch die Gleichung R. Rf = B. Bf gegeben ist; der nämliche
Farbenton kann aber noch aus anderen Farben, deren Verbindungslinien sich
in f schneiden, gewonnen werden, z. B. aus V und G',
wobei wieder V. Vf = G'. Gf sein muß. Hierin liegt auch der
Grund, daß, wie oben bemerkt, die einfache Farbenlinie geradlinig
bleiben muß, so lange die aus der Mischung zweier Spektralfarben
hervorgehende mittlere Farbe eine spektrale Sättigung besitzt. Denn
in diesem Fall muß eben die gerade Verbindungslinie der gemischten
Farben mit der Farbenlinie selbst zusammenfallen, während sie, wo
die Mischfarbe weißlich ist, nach einwärts von der Farbenlinie
gegen die weiße Mitte zu gelegen ist. Dies kann aber nur. eintreten,
wenn die Farbenlinie einen gekrümmten Verlauf hat. Letzteres ist also
in der Nähe des Grün vorauszusetzen, weil hier aus der Mischung
nahe gelegener spektraler Farben weißliche Mischfarben hervorgehen.
Aus dem obigen Grunde ist auch die dem Purpur entsprechende Verbindungslinie
als eine Gerade anzusehen: die Mischung von spektralem Rot und Violett
erzeugt nämlich niemals weißliche Farbentöne.
Aus den Erscheinungen der Farbenmischung geht hervor,
daß zur Erzeugung aller möglichen Farbenempfindungen keineswegs
alle möglichen Arten objektiven Lichtes erforderlich sind, sondern
daß hierzu eine beschränktere Zahl von Farbentönen genügt.
Diejenigen Farben, welche durch Mischung in wechselnden Mengeverhältnissen
alle möglichen Farbenempfindungen sowie die Empfindung Weiß
hervorbringen können, hat man die Grundfarben genannt. Sowohl
aus der Betrachtung der Komplementärfarbenpaare wie aus der Gestalt
der nach den Mischungserscheinungen konstruierten Farbentafel erhellt,
daß es drei solche Grundfarben gibt. Die Liste der Ergänzungsfarben
zeigt nämlich, daß die zwei an den entgegengesetzten Enden des
Spektrums gelegenen einfachen Farben, Rot und Violett, nahe bei einander
gelegene Komplementärfarben, Grünblau und Grüngelb, besitzen.
Nun muß die Addition von zwei Komplementärfarbenpaaren, wie
Rot + Grünblau und Violett + Grüngelb, ebenfalls Weiß geben,
die Mischung von Grünblau und Grüngelb gibt aber einen grünlichen
Farbenton. Der Addition jener beiden Komplementärfarbenpaare wird
man also die Mischung der drei Farben Rot, Violett und Grün
substituieren können. Ferner kann man alle zwischen Rot und Grün
gelegenen Farben durch Mischung von Rot und Grün, ebenso alle zwischen
Violett und Grün gelegenen durch Mischung von Violett und Grün
erhalten, während Rot und Violett zusammen Purpur geben. Es ist also
klar, daß man aus Rot, Grün und Violett Weiß, die spektralen
Farbentöne und Purpur, sowie deren Sättigungsgrade, d. h. alle
möglichen Licht- und Farbenempfindungen gewinnen kann. Das nämliche
erhellt aus der Betrachtung der Farbentafel in Fig.
90, in der die Lage der Farben am Anfang und am Ende des Spektrums
auf den zwei einen Winkel bildenden Seiten offenbar bedeutet, daß
die Mischung je einer Endfarbe des Spektrums mit jener mittleren Farbe,
welche an die Stelle des Winkels zu liegen kommt, die im Spektrum zwischenliegenden
Farbentöne erzeugt. Jene winkelständige Farbe selbst, das Grün,
ist aber zu Purpur, der Mischung der beiden endständigen Farben, komplementär:
auch diese Konstruktion führt also auf Rot, Grün und Violett
als Grundfarben.
Nimmt man bloß auf den Farbenton, nicht auf
den Sättigungsgrad Rücksicht, so lassen sich auch noch aus andern
als den drei angegebenen Farben Weiß, Purpur und die spektralen Farbentöne
herstellen. So geben z. B. Rot, Grün und Blau oder Orange, Grün
und Violett, überhaupt je drei Farben, welche, wenn man sie durch
gerade Linien verbindet, einen Raum umschließen, der Weiß und
alle im Weiß zusammenmündenden Farbentöne in sich faßt,
alle möglichen Farbenempfindungen. Aber in diesen Fällen sind
alle Mischfarben weißlich. Die drei oben angegebenen Grundfarben
zeichnen sich also dadurch aus, daß durch sie nicht nur überhaupt
alle möglichen Farbentöne, sondern die meisten auch in spektraler
Sättigung hervorgebracht werden können. Die Kombination Rot,
Grün und Blau nähert sich dieser Bedingung ebenfalls in hohem
Grade, da Blau und Rot bei bedeutendem Übergewicht der ersteren Farbe
indigblaue und violette Farbentöne von ziemlich vollkommener Sättigung
ergeben. Indem man von der Vermutung ausging, die Grundfarben seien zugleich
Hauptfarben in dem früher angegebenen Sinne, hat man daher
häufig bei der Konstruktion der Farbentafel der zuerst von newton
aufgestellten Kombination Rot, Grün und Blau den Vorzug gegeben91).
Die Versuche über Mischung der Spektralfarben scheinen aber für
die von thomas young aufgestellte Verbindung Rot,
Grün und Violett zu entscheiden92).
Aber auch durch die Mischung dieser drei Farben kann man nicht alle
einfachen Farben in vollkommen spektraler Sättigung erhalten, sondern
nur gegen den Anfang und gegen das Ende des Spektrums läßt sich
in der unmittelbaren Empfindung nicht entscheiden, ob eine gegebene Farbe
wirklich einfach, oder ob sie aus einer im Spektrum voran- und aus einer
nachstehenden Farbe gemischt ist. Die in der Nähe des Grün aus
zwei benachbarten Farben hervorgehenden Mischungen sind dagegen immer weißlicher
als die entsprechenden spektralen Farbentöne, wie dies hier der gebogene
Verlauf der die Farbentafel umschließenden Kurve andeutet. Demnach
kommt auch der Konstruktion der Farbenempfindungen aus den drei Grundfarben
nur ein Annäherungswert zu. Sollte dieselbe eine reale Bedeutung haben,
so müßten die zwei gegen einander geneigten Linien der Farbenkurve
in einem wirklichen Winkel zusammenstoßen. helmholtz
hat, der Hypothese von th. young folgend, für
die drei Grundfarben diese Bedeutung dadurch zu retten gesucht, daß
er sie als Grundempfindungen auffaßte, welche an und für
sich nicht notwendig mit Farben des Spektrums zusammenfallen müßten,
sondern sich in ihrem Sättigungsgrad von denselben möglicher
Weise unterscheiden könnten. Nimmt man nun an, daß es drei Grundempfindungen
gibt, welche dem Rot, Grün und Violett entsprechen, aber gesättigter
sind als die mit diesen Namen belegten Spektralfarben, so läßt
sich eine Tafel der Farbenempfindungen konstruieren, welche mit der Tafel
der realen Farben nicht identisch ist, sondern dieselbe in sich schließt.
Nach der ursprünglichen Hypothese TH. YOUNG'S,
wonach jede Spektralfarbe alle drei den Grundempfindungen entsprechenden
Nervenfasern erregt, nur je nach der Wellenlänge in verschiedenem
Grade, würde kein einziger Grenzpunkt der ersten Tafel mit einem solchen
der zweiten sich berühren, sondern zwischen jeder einfachen Farbe
und der entsprechenden Grundempfindung würde noch ein Zwischenraum
gesättigter Farbentöne existieren93).
Nach den neueren Versuchen von maxwell und J.
J. müller kommt nun aber für einen großen Teil der
Farbenkurve die Mischfarbe der zwischenliegenden Spektralfarbe auch in
ihrem Sättigungsgrade gleich, so daß einerseits vom Rot bis
zum Gelbgrün und anderseits vom Violett bis zum Blaugrün ein
vollständiges Zusammenfallen der beiden Kurven anzunehmen, und erst
in der Gegend des Grün die Tafel der Empfindungen durch das sich über
die Farbenkurve erhebende Winkelstück, welches in Fig.
90 punktiert angedeutet wurde, zu ergänzen wäre. In
die Sprache der YOUNG'schen Hypothese übersetzt
würde aber dies bedeuten, daß die Annahme einer Miterregung
der beiden andern Nervenprozesse nur für das Grün, nicht für
Rot und Violett erfordert wird94). Daß
aber nur eine der drei Grundfarben eine solche Ausnahmestellung beansprucht,
ist ein für diese Hypothese bedenklicher Umstand, mögen wir sie
nun in ihrer ursprünglichen Form adoptieren oder den dreierlei Nervenfasern
drei Nervenprozesse substituieren. Die Tatsache, daß gerade für
die mittlere der drei Grundfarben jene Ausnahme nötig wird, weist
vielmehr auf eine andere Erklärung hin, welche die Beziehung zwischen
Empfindung und Reiz nicht auf eine Mischung disparater Vorgänge zurückführt,
von denen völlig dunkel bleibt, wie sie sich zu einem einfachen und
stetig abgestuften Erfolg kombinieren sollen. Betrachten wir nämlich,
was an und für sich viel näher liegt, auch hier die Qualität
der Empfindung als unmittelbare Funktion eines möglicher Weise sehr
komplexen, aber immerhin einheitlichen Nervenprozesses, so läßt
die Erfahrung, wonach alle Farbentöne und ihre Sättigungsgrade
ein Kontinuum bilden, vermuten, der zu Grunde liegende Nervenprozeß
stufe ebenfalls kontinuierlich sich ab. Das Mischungsgesetz fügt hierzu
die beiden Sätze: l) daß Wellenlängen, die auf der einen
oder andern Seite von der Mitte der empfindbaren Farben gelegen sind, mit
einander gemischt Empfindungen erzeugen, welche zwischenliegenden Wellenlängen
entsprechen, und 2) daß Wellenlängen, die um die Mitte (G)
der empfindbaren Farben oder nach verschiedenen Seiten von derselben liegen,
weißliche Farbentöne oder Weiß hervorbringen. Unter der
Voraussetzung, daß gleichen Empfindungen gleiche Nervenprozesse zu
Grunde liegen, zeigt der erste dieser Sätze an, die Abhängigkeit
des Nervenprozesses von der Lichtbewegung sei bei den größten
und den kleinsten Wellenlängen eine solche, daß der aus zwei
verschiedenen, aber auf derselben Hälfte des Spektrums gelegenen Wellenlängen
resultierende Nervenprozeß identisch ist mit demjenigen Vorgang,
den die Reizung mit Wellenlängen von der zwischenliegenden Größe
erzeugt. Gegen die Mitte des Spektrums gilt dies aber nur noch, wenn die
gemischten Wellenlängen um sehr kleine Größen von einander
verschieden sind, so daß das betreffende Stück der Farbenkurve
als geradlinig betrachtet werden kann. Hiernach läßt sich nun
der zweite Satz des Mischungsgesetzes einfach auch so ausdrücken:
für jeden Teil der Farbenkurve gibt es einen gewissen Grenzwert des
Farbenunterschieds, bei welchem die resultierende Farbe eine verminderte
Sättigung zeigt. Diese verminderte Sättigung nimmt hierauf zuerst
bis zu einem Maximum zu, dem vollständigen Weiß (dem Punkt der
Komplementärfarbe entsprechend), und dann wieder ab, womit sich die
Farbenkurve als eine in sich zurücklaufende kundgibt. Jener Grenzwert
des Farbenunterschieds, der die verminderte Sättigung eben anzeigt,
ist nun ein Maximum für den Anfang und für das Ende des Spektrums,
ein Minimum für die Mitte desselben. Hierin spricht sich offenbar
ein gesetzmäßiger Gang der Funktion aus. Wo die Farbenempfindung
beginnt, und wo sie wieder aufhört, da ist es zwischen weiteren Grenzen
möglich, durch Mischung von Wellenlängen Empfindungen zu erzeugen,
die zwischenliegenden Wellenlängen entsprechen. Dies wird aber begreiflich,
wenn wir uns erinnern, daß sich im Anfang und am Ende des Spektrums
die Empfindung und, wie wir demzufolge schließen müssen, auch
der Nervenprozeß, sehr viel langsamer ändert als gegen die Mitte
desselben95). Einen solchen Gang der Funktion
wird man nun nicht umhin können als einen gewissermaßen natürlichen
anzusehen, da derselbe nur ausdrückt, daß unser Sinnesorgan
bei jenen Reizen, welche von der unteren und oberen Grenze der Reizbarkeit
ungefähr gleich weit entfernt sind, am genauesten der Abstufung der
äußeren Reize folgt. Dazu macht endlich die vorausgesetzte Korrespondenz
von Empfindung und Nervenprozeß noch die weitere Annahme erforderlich,
daß der letztere an der untern und obern Grenze der Empfindung eine
ähnliche Beschaffenheit besitze, so daß, wenn man die
aus beiden Grenzreizen resultierenden Vorgänge hinzunimmt, auch der
Nervenprozeß wieder zu seinem Ausgangspunkte zurückkehrt.
91) So noch MAXWELL, Phil. transactions 1860 p. 57. Phil. mag. XXI. 1860. p. 141.
92) Das Violett hat th. YOUNG ursprünglich wohl nur
wegen seiner ausgezeichneten Stellung am Ende des Spektrums dem Blau substituiert.
Helmholtz folgte YOUNG, wurde aber später durch Maxwell's Versuche
schwankend (physiol. Optik S. 290, S. 843). Der Angabe Maxwell's, daß
Rot und Blau gesättigtes Indigblau und Violett liefern, ist jedoch
zuletzt J. J. MÜLLER entgegengetreten (Arch. f. Ophthalmologie XV,
S. 248).
93) Nach dieser Voraussetzung ist in der Tat von Helmholtz
in seiner Fig. 120 (physiol. Optik S. 298) die Farbentafel in die hypothetische
Tafel der Grundempfindungen eingetragen worden.
94) Man könnte zwar für letzteres noch die Tatsache anführen, daß die für Grün ermüdete Netzhaut das spektrale Rot oder Violett gesättigter empfindet als gewöhnlich, aber dies erklärt sich hinreichend aus den unten zu besprechenden Gesetzen des Kontrastes.
95) Zwar liegt im Grün noch einmal, wie wir gesehen
haben, ein relatives Minimum, dieses kommt aber gegen die bedeutende Abnahme
der Unterschiedsempflndlichkeit im Rot und Violett gar nicht in Betracht,
es kann mit der starken Krümmung der Farbenkurve zwischen den beiden
Stellen G' und B' (Fig.
90) zusammenhängen.
Das Mischungsgesetz, nach welchem wir durch Licht
von dreierlei Wellenlängen Licht- und Farbenempfindungen, die allen
möglichen Wellenlängen entsprechen, in annähernder Vollständigkeit
hervorbringen können, beruht also im Grunde wesentlich darauf, daß
die Beziehung zwischen Nervenprozeß und Reiz fortwährend in
einer und derselben Richtung sich ändert, ausgenommen an der Stelle
des oben bezeichneten Wendepunktes. Wir können uns diesen Gang der
Funktion auch folgendermaßen veranschaulichen. Wir denken uns den
Punkt W der Farbentafel (Fig.
90) als Mittelpunkt eines Polkoordinatensystems, denken uns
also von diesem Punkte Radien nach allen möglichen Stellen der Farbenkurve
gezogen und die Winkel, welche dieselben mit einander bilden, vom Radius
W R an gezählt, so dass die positiven Werte derselben in der
Richtung des Verlaufs der spektralen Farbenkurve wachsen. Die Zunahme des
Polarwinkels soll der Abnahme der Wellenlänge von der Grenze des äußersten
Rot ab entsprechen. Da die den kürzesten Wellenlängen zugehörigen
Empfindungen des Violett sich wieder der Empfindungsgrenze der größten
Wellenlänge nähern, so muß die Kurve in der Gegend der
Mitte des Spektrums einen Wendepunkt haben, und nach dem Mischungsgesetz
für die Wellenlängen von Rot bis Gelbgrün und von Grünblau
bis Violett müssen die beiden gegen den Wendepunkt verlaufenden Schenkel
der Kurve einen nahehin geradlinigen Verlauf nehmen. Die so gewonnene Kurve
besitzt also im allgemeinen die Gestalt der Farbenlinie in Fig.
90. Die nach unten zwischen den Radien W R und W V
gelegenen Winkelwerte können entweder als solche, welche die obere
Empfindungsgrenze überschreiten, oder als solche, welche die untere
nicht erreichen, betrachtet werden: die hier liegenden Empfindungen können
nicht mehr durch einfache ultrarote oder ultraviolette Wellenlängen,
sondern nur durch Mischung roter und violetter Strahlen hervorgebracht
werden; durch sie wird dann die Kurve der einfachen Farbenempfindungen
eine in sich geschlossene. Mit diesem in dem Zurücklaufen der Farbenlinie
begründeten Gang der Funktion stehen nun aber auch die weiteren Mischungserscheinungen,
die hauptsächlich in der Existenz der Komplementärfarbenpaare
ihren Ausdruck finden, in Verbindung. Nicht gesättigt ist vermöge
der Form der Farbenkurve immer die Empfindung, die aus der Mischung solcher
Farben hervorgeht, zwischen denen die Kurve nicht geradlinig verlauft.
Da nun die ganze Kurve in sich geschlossen ist, so muß es für
jeden Punkt der Farbenlinie einen zweiten Punkt geben, bei welchem die
Sättigung der Mischfarbe auf ein Minimum gesunken ist, um bei weiterem
Fortschritt sich wieder in entgegengesetztem Sinne zu ändern. Dieses
Minimum der Sättigung oder die Empfindung Weiß wird für
zwei Punkte dann vorhanden sein, wenn der zwischen ihnen gelegene Teil
der Kurve das Maximum der Richtungsänderung erreicht hat, d. h. wenn
die von W aus gezogenen Radiusvektoren mit einander einen Winkel
von 180° bilden. Auf diese Weise gelangen wir zu derselben Bestimmung
des Ortes der Komplementärfarben wie früher.
Statt des Mischungsgesetzes ließe sich der
Konstruktion der Farbenfläche noch ein anderes Verhältnis zu
Grunde legen, durch welches dieselbe zu einem direkteren, Ausdruck des
Systems unserer Lichtempfindungen wird. Wie sich nämlich die Farbenlinie
nach der Abstufung der Unterschiedsempfindlichkeit für Farbentöne
einteilen läßt, so kann man auch die Abmessungen der Farbenflache
nach der Unterschiedsempfindlichkeit für Sättigungsgrade ausführen.
Eine Farbe, die eine größere Zahl eben merklicher Abstufungen
durchläuft, bis sie in Weiß übergeht, würde hiernach
in größere Entfernung von dem Punkte der Farbentafel, welcher
dem Weiß entspricht, zu verlegen sein. Direkte Messungen hierüber
besitzen wir nicht. Es ist aber wohl anzunehmen, daß diejenigen einfachen
Farben, welche durch eine geringere Menge von zugemischtem Weiß in
ihrer Sättigung merklich geändert werden, an und für sich
eine größere Sättigung besitzen, also auch in größere
Entfernung von dem Weiß verlegt werden müssen. So findet man
denn in der Tat, daß die verschiedenen Spektralfarben von sehr verschiedener
Sättigung sind. Violett und Blau sind z. B. gesättigter als Rot,
dieses ist wieder gesättigter als Orange und Gelb. Die erstgenannten
Farben zeigen daher auch bei einer geringeren Zumischung von Weiß
schon eben merkliche Unterschiede der Sättigung 96).
Nun verhalten sich aber die Farben, wenn sie zu Mischungen benutzt werden,
in völlig entsprechender Weise. Von einer gesättigteren Farbe,
also z. B. von Blau, ist eine geringere Quantität erforderlich, am
eine merkliche Farbenänderung der Mischung hervorzubringen, als von
einer minder gesättigten Farbe, z. B. von Gelb, und ebenso muß,
wenn eine gesättigte und eine weniger gesättigte Farbe zusammen
komplementär sind, von der ersteren weniger genommen werden, um Weiß
zu erzeugen. Wenn man die Abstufungen der Sättigung zu Grunde legt,
so muss also dem Weiß ungefähr dieselbe Stelle angewiesen werden,
die es nach den Mischungsversuchen einnimmt, und auch in ihrer allgemeinen
Gestalt wird die Farbentafel mit der nach dem Mischungsgesetze konstruierten
wahrscheinlich übereinstimmen. Denn je weiter in der Fig.
90 eine Farbe vom Weiß entfernt ist, um so gesättigter
ist dieselbe, und eine um so größere Zahl von Stufen zwischen
Weiß und dem gesättigten Farbenton lassen daher auf der das
Weiß mit dem peripherischen Punkt verbindenden Geraden sich auftragen.
96) AUBERT, Physiologie der Netzhaut S. 145.
Aus der Form der Farbentafel läßt endlich noch ein wesentlicher Unterschied zwischen Sättigungsgrad und Farbenton sich erkennen. Während nämlich die Farbentöne eine in sich zurücklaufende Linie bilden, haben die Sättigungsgrade nur einen fest bestimmten Endpunkt, das Weiß: die von hier ausstrahlenden Radien können aber beliebig über die Fläche der realen Farben hinaus verlängert gedacht werden. In der Tat können wir uns irgend einen Farbenton nicht nur gesättigter vorstellen, als er im Spektrum ist, sondern wir können sogar unter Umständen solche gesättigtere Empfindungen hervorbringen, indem wir nämlich das Auge zuvor für die komplementären Farbentöne ermüden97). Der Sättigungsgrad der Spektralfarben bildet also nur eine tatsächliche, an und für sich schon vermöge der wechselnden Reizbarkeit der Netzhaut etwas veränderliche Grenze, über die hinaus ein jeder im Weiß der Farbentafel beginnende Farbenstrahl, ebenso wie die Tonlinie über ihre obere oder untere Grenze, in's unendliche fortgesetzt gedacht werden kann. Dies führt uns auf eine allgemeinere Darstellungsform für das System der Farben und ihrer Sättigungsgrade, als die oben gegebene ist. Denkt man sich nämlich in der Farbenfläche der Fig. 90 ein anderes System von Farbenempfindungen konstruiert, welchem als Empfindungen von größter Sättigung solche Farben entsprechen, die einen geringeren Sättigungsgrad als die Spektralfarben besitzen, so wird dieses neue System durch eine Kurve umgrenzt, welche der Kurve R G V ähnlich ist, und in welcher W wieder die nämliche relative Lage zu den einzelnen Punkten der Grenzkurve einnimmt. Von den einzelnen Linien W R, W V u. s. w. muß man also Stücke abziehen, die ihrer Größe proportional sind, um die neue Kurve zu erhalten. Die Veränderungen, welche die Farbenkurven bei geändertem Sättigungsgrad sukzessiv erfahren müssen, um fortan ein zusammengehöriges System mit richtiger Abmessung der komplementären Farbentöne zu bilden, lassen sich daher darstellen, wenn man sich alle Farbentöne mit ihren Sättigungsgraden auf einer Kegeloberfläche abgetragen denkt, von der das System der Spektralfarben ein horizontaler Durchschnitt ist. Von hier aus kommen, gegen die Spitze des Kegels, Farbentöne von immer geringerer Sättigung, die in der Spitze selbst in Weiß übergehen; weiter gegen die Basis aber, welche letztere man sich unendlich entfernt denken kann, wird man zu Farbensystemen von überspektraler Sättigung gelangen. Somit bilden die Farbentöne samt ihren Sättigungsgraden ein Kontinuum von zwei Dimensionen, das, wenn man die einfachste Form wählt, als ein ebenes Kontinuum von begrenztem Umfang dargestellt werden kann, und dessen Grenze durch die Linie der spektralen Farbentöne gebildet wird. In seiner allgemeinsten Form und mit Rücksicht auf die ideale Möglichkeit unendlich vieler Sättigungsgrade bildet aber das System der Farben eine gekrümmte Oberfläche mit wechselndem Krümmungsmaß, also ein nicht-ebenes Kontinuum von zwei Dimensionen, welches deshalb in dem unserer Anschauung gegebenen Raum nur unter Zuhilfenahme der dritten Dimension dargestellt werden kann 98).
97) Siehe oben.
98) Vergl. hierzu die Lehre vom Baum in Kap. XVI.
Die Intensität der Lichtempfindung darf
innerhalb gewisser Grenzen als ein von Farbenton und Sättigung unabhängiger
Bestandteil angesehen werden, da eine nach Farbe und Sättigungsgrad
bestimmte Empfindung verschiedene Grade der Stärke besitzen kann.
Zwar werden wir sogleich sehen, daß dieser Satz wesentliche Einschränkungen
erfährt. Betrachten wir aber vorläufig die Lichtstärke als
eine für sich veränderliche Größe, so ist klar, daß
dieselbe dem nach zwei Dimensionen konstruierten Kontinuum der Farben die
dritte hinzufügt. Beschränkt man sich auf die unser gewöhnliches
Empfindungssystem vollständig darstellende ebene Farbentafel,
wie sie nach der Abstufung der Farben in Ton und Sättigung oder nach
dem Mischungsgesetze konstruiert werden kann, so läßt sich die
einer jeden Lichtqualität entsprechende Abstufung der Intensität
als eine der Farbentafel an der betreffenden Stelle aufgesetzte senkrechte
Linie darstellen. Nehmen wir die einfachste Form, den Kreis, und beginnen
wir mit dem das Weiß darstellenden Mittelpunkt (Fig.
88), so wird also die hier aufgesetzte Senkrechte alle Stufen
des Weiß durch Grau bis zum Schwarz andeuten. Wollte man ein Maßprinzip
zu Grunde legen, so würde man auch hier. die eben merklichen Unterschiede
als Maßeinheiten betrachten müssen. Die Unterschiedsempfindlichkeit
für die Helligkeit der Farben ist nun, analog der Unterschiedsempfindlichkeit
für den Farbenton, in der Mitte des Spektrums am größten
und nimmt von da nach beiden Enden, am meisten aber im Rot, ab. Aus den
Versuchen von LAMANSKY99)
ergeben sich nämlich folgende Werte der Unterschiedsschwelle:
Im Rot
Orange Gelb
Grün Blau
Violett100)
1/70
1/78
1/286
1/286
1/212
1/109
Für weißes Licht schwanken, wie wir früher
in Kap. VIII gesehen haben, die Bestimmungen von 1/100
bis 1/167101); die
hier geltende Zahl scheint also zwischen den für die Farben gewonnenen
äußersten Werten ungefähr in der Mitte zu stehen.
99) Archiv für Ophthalmologie XVII, I, S. 131.
100) Vergl. damit die Werte der Unterschiedsschwelle
für Farbentöne auf S. 378.
101) Vgl.oben.
Versucht man es nun, die Intensitätsabstufungen aller Farben und ihrer Mischungen als eine der Farbenfläche hinzugefügte Höhendimension zu behandeln, so stellt sich aber alsbald heraus, daß diese Konstruktion nicht für jede Qualität unabhängig durchgeführt werden kann. Die Empfindung Rot z. B. wird bei Abschwächung der Lichtintensität nicht bloß in ihrer Stärke sondern immer zugleich in ihrem Farbenton und in ihrer Sättigung vermindert, bis sie endlich in Schwarz, also in dieselbe Empfindung übergeht, welche der geringsten Intensität des weißen Lichtes entspricht. Das nämliche stellt sich bei allen andern Farbenempfindungen, welchen Ton und welchen Sättigungsgrad sie auch besitzen mögen, heraus. Nur die Grenze der Lichtstärke, bei welcher der qualitative Unterschied der Empfindung aufhört, ist für die einzelnen Farben eine etwas verschiedene, indem, wie früher (Kap VIII) bereits bemerkt wurde, die blauen Farbentöne erst bei einer geringeren Lichtintensität in Schwarz übergehen als die roten und gelben. Das System der Farbenempfindungen kann daher, wenn man dieselben von der ihnen im Spektrum zukommenden Intensität an allmälig bis zum Minimum ihrer Stärke verfolgt, nicht durch einen Zylinder sondern, falls man den Kreis als Farbentafel benutzt, nur durch einen Kegel mit kreisförmiger Basis dargestellt werden, dessen Spitze dem Schwarz entspricht. In den einzelnen parallel zur Basis geführten Schnitten folgen dann von unten nach oben die lichtschwächeren Farben und in der Mitte das Grau in stetiger Abstufung auf einander. In analoger Weise lassen sich auch diejenigen Veränderungen darstellen, welche die Lichtempfindung erfährt, wenn die objektive Lichtstärke nicht vermindert, sondern vermehrt wird. Die Beobachtung zeigt nämlich, daß es eine bestimmte Lichtstärke gibt, bei welcher die Sättigung der einfachen Farben des prismatischen Spektrums am größten ist. Diese dem Maximum der Sättigung entsprechende Lichtintensität, welche wahrscheinlich nicht für alle Farben dieselbe ist, wurde bis jetzt noch nicht näher bestimmt. Fest steht aber, daß von derselben ausgehend der Sättigungsgrad nicht nur durch Abnahme sondern auch durch Zunahme der Lichtintensität sich vermindern kann. Wie im ersten Fall schließlich alle Farben in Schwarz übergehen, so nähern sie sich im zweiten alle dem Weiß. Es kann hier aber allerdings dieses Minimum der Sättigung selbst nicht so leicht wie bei Abnahme der Beleuchtung erreicht werden, weil durch so bedeutende Lichtstärken das Organ Not leidet. Der Grenzwert ist also in diesem Fall eigentlich nur ein virtueller, welchem sich die wirkliche Empfindung wegen der begrenzten Reizempfänglichkeit der Netzhaut annähert, ohne ihm je vollständig gleich zu kommen. Denken wir uns demnach, der Farbenkreis stelle das System der Farbenempfindungen bei den dem Maximum der Sättigung entsprechenden Lichtstärken dar, so wird der dem Schwarz korrespondierenden Spitze, in welcher bei verminderter Lichtstärke schließlich alle Empfindungen zusammenlaufen, auf der andern Seite der Kreisflache eine dem intensivsten Weiß entsprechende Spitze gegenüberliegen, in welcher sich bei gesteigerter Lichtstärke alle Empfindungen vereinigen. Das ganze System der Lichtempfindungen kann also durch einen Doppelkegel dargestellt werden, bei welchem der die beiden Kegelhälften begrenzende Kreis die Farben der größten Sättigung enthält. Statt des Doppelkegels kann man natürlich auch eine Doppelpyramide oder, als einfachste Form, eine Kugel wählen, in deren Äquatorialebene die Farben der größten Sättigung und die daraus durch Mischung herstellbaren Sättigungsstufen liegen, während der eine Pol dem intensivsten Weiß, der andere dem dunkelsten Schwarz entspricht, welche durch weitere Vermehrung oder Verminderung der Lichtstärke nicht weiter verändert werden können (Fig. 91). Auf der die beiden Pole verbindenden Linie sind alle möglichen Lichtabstufungen vom absoluten Weiß bis zum absoluten Schwarz gelegen102). Legt man statt des Farbenkreises diejenige Farbenfläche zu Grunde, die sich aus dem Mischungsgesetz ergibt (Fig. 90), so wird das vollständige System der Farbenempfindungen durch eine von dieser Farbentafel aus konstruierte Doppelpyramide dargestellt. Nun haben wir gesehen, daß die nämliche Figur zugleich die Abstufungen der Sättigungsgrade versinnlicht, insofern die Farbentöne, die eine größere Abstufung zulassen, weiter von dem Punkte des Weiß entfernt sind. Dasselbe Maßprinzip läßt sich auch auf die Intensitätsabstufungen anwenden, indem man denjenigen Farben der Tafel, welche eine größere Zahl von Lichtstufen durchlaufen, bis sie ins Schwarz übergehen, eine größere geradlinige Entfernung vom Punkte des intensivsten Schwarz gibt, ebenso denjenigen, welche mehr Abstufungen bis zum Weiß durchlaufen, eine größere Entfernung von diesem. Solches sind aber in beiden Fällen die Farben von kleinerer Wellenlänge, wie aus der Tatsache hervorgeht, daß die blauen und violetten Farben bei einer geringeren Lichtstärke noch wahrgenommen werden, aber auch erst bei einer größeren dem Weiß sich nähern, als die roten und gelben. Wenn daher in der Doppelpyramide der Farben die Linie, welche Weiß und Schwarz verbindet, auf dem Punkte Weiß der Farbenfläche senkrecht steht, so gelangt diese Abstufung von selbst zum Ausdruck, da nun die Linien, welche von der Seite des Rot und Gelb zu den beiden Spitzen gezogen werden, kürzer sind als jene, die von den Endfarben des Spektrums ausgehen. Wollte man schließlich nicht bloß die reellen, sondern die überhaupt denkbaren Sättigungsgrade berücksichtigen, so würde dies zu einer Konstruktion führen, welche geometrisch nicht mehr realisiert werden kann, da die Farbenfläche, zu der die dritte Dimension gefunden werden soll, eine krumme Oberfläche ist, ein nicht-ebenes Kontinuum von drei Dimensionen aber die Grenzen unserer Anschauung überschreitet103).
102) Um bei der Konstruktion des Farbensystems zugleich die Lichtstärken zu berücksichtigen, fügte zuerst lambert der gewöhnlichen Farbentafel die dritte Dimension hinzu und konstruierte so eine Farbenpyramide, in deren Spitze er das Weiß verlegte. (lambert, Beschreibung einer mit dem CALAU'schen Wachse ausgemalten Farbenpyramide. Berlin, 1772.) Diese Konstruktion fußt auf dem Übergang aller Farbenempfindungen in Weiß bei verminderter Sättigung. Die Konstruktion in einer Kugel, welche den Übergang in Weiß und in Schwarz gleichzeitig darstellt, ist zuerst von dem Maler Philipp Otto Runge ausgeführt worden. (Die Farbenkugel oder Konstruktion des Verhältnisses aller Mischungen der Farben zu einander. Hamburg 1810.) Auch die Konstruktion einer Doppelpyramide der Farben hat derselbe angedeutet. (Ebend. S. 8.) CHEVREUL (exposé d'un moyen de definir et de nommer les couleurs. Paris, 1861. Atlas) teilt zehn Farbenzirkel mit, in denen sehr schön die Übergänge der gesättigten Farben zu Schwarz dargestellt sind. Eine besondere Figur (Taf. II) gibt für eine Farbe, das Blau, in 20 Abstufungen die Übergänge einerseits in Schwarz und anderseits in Weiß. Alle diese Arbeiten verfolgen übrigens hauptsächlich künstlerische Interessen.
103) Vgl. Kap. XVI und oben.
Unsere reellen Lichtempfindungen bilden, wie aus dieser Darstellung hervorgeht, eine stetige Mannigfaltigkeit von drei Dimensionen. Der wesentlichste Unterschied desselben von dem System der Tonempfindungen besteht darin, daß es ein in sich geschlossenes Kontinuum ist, während die Tonlinie zwar vermöge der beschränkten Reizempfänglichkeit unserer Organe gewisse Grenzen hat, hiervon abgesehen aber ins unbegrenzte ausgedehnt gedacht werden kann. Diese Geschlossenheit des Farbensystems, welche in der Darstellung desselben durch eine geschlossene geometrische Form, Kugel oder Doppelpyramide, ihren Ausdruck findet, ist begründet einmal in der geschlossenen Form der einfachen Farbenkurve, und sodann in der wechselseitigen Beziehung von Sättigung und Lichtstärke, welche von einander abhängige Bestimmungen der Empfindung sind. Durch diese Beziehung wird daher das ganze System der Lichtempfindungen ein in sich geschlossenes Raumgebilde von drei Dimensionen104). Jene Wechselbeziehung zwischen Sättigung und Lichtstärke ist die Ursache, daß wir in der reinen Empfindung Intensitäts- und Qualitätsunterschiede des Lichtes nicht sicher zu unterscheiden vermögen. So hielten die Alten und hielt noch goethe in seiner Farbenlehre Weiß und Schwarz nicht für Stärkegrade sondern für Grundqualitäten der Lichtempfindung.
104) Mit der Darstellbarkeit verliert dasselbe aber allerdings auch seine Geschlossenheit, wenn man sich nicht mehr auf die reellen Sättigungsgrade beschränkt, sondern die denkbaren hinzunimmt. Dies steht damit im Zusammenhang, daß die Sättigungsgrade und Intensitäten aus ganz anderem Grunde zwischen endlichen Grenzen eingeschlossen sind als die Farbentöne. Hier bilden die Empfindungen an sich eine geschlossene Kurve, dort setzt nur das reale Verhältnis unseres Sinnesorgans zu den objektiven Reizen gewisse Grenzen. Zwar führt auch die Abhängigkeit der Sättigung von der Intensität zu den zwei den beiden Minimis der Sättigung entsprechenden Grenzen, welche den Polen des Weiß und Schwarz auf der Farbenkugel entsprechen. Aber statt der im Äquator aufgetragenen Maximalsättigungen der realen Farben lassen sich beliebig größere Sättigungsgrade denken. Der Äquator kann also, wenn man sich diese Dinge durch eine geometrisch mögliche Konstruktion versinnlichen will, etwa zu einem Zylinder von unbestimmter Länge ausgezogen vorgestellt werden , auf dessen beiden Grenzflächen sich erst die größten Sättigungen der realen Farben befinden.
Aus der oben festgestellten Abhängigkeit der
Farbenempfindung von der Lichtstärke erhellt, daß man von einer
beliebigen Farbe zur Empfindung Weiß oder Schwarz auf doppeltem Wege
gelangen kann: einmal durch Mischung des farbigen Lichtes mit andersfarbigem,
wobei man am einfachsten die Komplementärfarben wählt, und sodann
durch bloße Vermehrung oder Verminderung der Lichtstärke; im
letzteren Fall wird aber immer zugleich die Stärke der Empfindung
verändert. Hiermit stehen nun eine Reihe von Erscheinungen im Zusammenhang,
welche wir auf eine veränderte Reizbarkeit der Netzhaut beziehen
müssen, und welche ebenfalls für den Lichtsinn durchaus charakteristisch
sind.
Für alle unsere Sinnesempfindungen gilt innerhalb
gewisser Grenzen der in der physiologischen Mechanik der Nerven begründete
Satz, daß ein Reiz, der auf einen durch vorangegangene Erregung ermüdeten
Nerven wirkt, denselben Erfolg hat, wie ein schwächerer Reiz, der
den unermüdeten Nerven trifft. Dieser Satz hat nun da, wo Intensität
und Qualität völlig von einander unabhängige Bestandteile
der Empfindung sind, z B. bei den Tönen, durchaus keinen Einfluß
auf die qualitative Bestimmtheit derselben. Anders ist es bei den Lichtempfindungen.
Lassen wir eine Farbe, z. B. Rot, auf die Netzhaut einwirken, so verliert
die Empfindung allmälig ihre qualitative Bestimmtheit, und sie nähert
sich je nach der Lichtstärke dem Grau oder Schwarz, ja sie kann ganz
in letzteres überzugehen scheinen. Dies läßt unmittelbar
aus dem obigen Gesetz der Ermüdung sich ableiten, nach welchem die
Empfindung nach längerer Dauer des Eindrucks allmälig dem Pol
des Schwarz sich annähern muß. Die Ermüdung hat also hinsichtlich
der Qualität der Empfindung den nämlichen Erfolg, den die Zumischung
einer gewissen Quantität komplementären Lichtes ausüben
würde. Bleibt das Auge nicht auf dem Eindruck Rot ruhen, sondern geht
es, nachdem derselbe merklich an Sättigung verloren hat, zu einem
neuen Reize über, welcher dem gewöhnlichen weißen Lichte
entspricht, so zeigt sich auch hier die Empfindung verändert. Die
Netzhaut empfindet nun von den verschiedenfarbigen Strahlen, aus denen
sich das Weiß zusammensetzt, die roten in relativ verminderter Sättigung,
d. h. so als wenn ihnen die Komplementärfarbe beigemischt wäre:
es sieht daher das Weiß in einer zu Rot komplementären, also
grünlichen Färbung105). Auf diese
Weise erzeugt jeder Farbeneindruck, wenn er längere Zeit angedauert
hat und dann weißes oder weißliches Licht auf die Netzhaut
trifft, ein komplementäres Nachbild. Für rote Eindrücke
ist dieses Nachbild grünblau, für violette grüngelb, für
grüne purpurn u. s. w. gefärbt106).
In den ersten Augenblicken nach einem stattgehabten Eindruck tritt jedoch
das komplementäre Nachbild in der Regel nicht sogleich oder wenigstens
nicht in seiner vollen Stärke hervor, weil die Erregung der Netzhaut
im allgemeinen den Reiz überdauert, so daß eine Empfindung von
gleicher Beschaffenheit, ein gleichfarbiges Nachbild, zurückbleibt.
Dieses letztere ist namentlich dann deutlich zu beobachten, wenn der Lichteindruck
nur kurze Zeit gedauert hat: das gleichfarbige Nachbild vergeht in diesem
Falle oft, ohne von einem komplementären gefolgt zu sein. Hat dagegen
der Reiz etwas länger eingewirkt, so ist zuerst das gleichfarbige
Nachbild und dann das komplementäre wahrnehmbar. Der Übergang
der gleichen in die komplementäre Farbe wird beschleunigt, wenn der
nachfolgende Lichteindruck eine bedeutende Helligkeit hat. Am deutlichsten
und dauerndsten sind daher die gleichfarbigen Nachbilder im dunkeln Gesichtsfeld
des geschlossenen Auges; doch geschieht auch hier jener Übergang,
indem die schwache Helligkeit des dunkeln Gesichtsfeldes immerhin analog
einem äußeren Lichtreize wirkt.
105) FECHNER, POGGENDORFF'S Annalen, Bd. 50, S. 200, 427.
106) Siehe die Komplementärfarbenpaare auf S. 382.
Das komplementäre Nachbild einer Farbe ist entweder positiv oder negativ. Positiv nennt man dasselbe, wenn es in gleicher Helligkeit wie der ursprüngliche Eindruck erscheint, negativ, wenn es in verminderter Helligkeit gesehen wird107). Bei weitem am häufigsten ist das komplementäre Nachbild negativ, erscheint also dunkler als das Objekt. Dies erklärt sich, wenn man annimmt, daß es in der Regel auf Ermüdung, oder, wie wir es mit Rücksicht auf unsere Darstellung des Farbensystems ausdrücken können, darauf beruht, daß die Empfindung in Folge der abgestumpften Reizbarkeit dem Pol des Schwarz auf der Farbenkugel sich nähert. In manchen Fällen ist aber das komplementäre Nachbild positiv, d. h. es scheint die gleiche oder eine größere Helligkeit als das ursprüngliche Objekt zu besitzen. Man kann daher positiv gleichfarbige und positiv komplementäre Nachbilder unterscheiden: die ersteren sind einfache Nachwirkungen der Reizung, während die letzteren auf einer Veränderung der Reizbarkeit beruhen. Die negativen Nachbilder sind stets komplementär, und sie sind immer durch die Ermüdung verursacht. Die gewöhnliche Folge der Erscheinungen bei farbiger Lichtreizung ist daher, daß der Eindruck zunächst ein positiv gleichfarbiges Nachbild hinterläßt, welches dann in ein negativ komplementäres übergeht. Wird die Netzhaut nicht mit farbigem, sondern mit weißem Lichte gereizt, so zeigt natürlich auch das Nachbild keine Farben- sondern bloß Helligkeitsunterschiede: es ist dann nur noch positiv oder negativ, ersteres, wenn es anscheinend gleiche, letzteres wenn es geringere Helligkeit als das ursprüngliche Objekt hat108).
107) Die gewöhnliche Definition lautet: positiv sind solche Nachbilder, in denen die hellen Partieen des Objekts ebenfalls hell, die dunkeln dunkel erscheinen; negativ solche, in denen die hellen Partieen des Objekts dunkler, die dunkeln heller erscheinen. (Helmholtz, physiol. Optik, S. 358.) Aber bei dem Nachbild einer weißen oder farbigen Fläche ist die Helligkeit der Umgebung lediglich durch den Kontrast bestimmt. Ist das Nachbild eines hellen Objekts hell, so erscheint daher durch Kontrast seine dunklere Umgebung im Nachbild ebenfalls dunkel, ist das Nachbild aber dunkel, so erscheint durch den Kontrast die Umgebung heller als im ursprünglichen Bilde. Ein ähnlicher Kontrast findet nun auch dann statt, wenn im Objekte selbst hellere und dunklere Stellen wechseln. Die helleren Stellen sind es, die, weil von ihnen vorzugsweise die Lichtreizung ausgeht, zunächst die Nachwirkung der Erregung bestimmen. Will man daher die Nachbilderphänomene unabhängig von den Kontrasterscheinungen definieren, so muß man von der dunkeln Umgebung oder den dunkleren Stellen der leuchtenden Fläche, welche in der Empfindung immer erst relativ bestimmt werden, abstrahieren.
108) Das ganze System der Nachbilderscheinungen läßt sich hiernach in folgender Übersichtstafel zusammenfassen:
Das positive komplementäre Nachbild läßt sich aus dem Gesetz der Ermüdung nicht ableiten, und eine zureichende Erklärung ist überhaupt für dasselbe noch nicht gefunden109). Die scheinbare Helligkeit dieses Nachbildes ist nicht selten größer als diejenige des ursprünglichen Objekts, aber dasselbe wird augenblicklich verdunkelt und damit das positive in das negativ komplementäre Nachbild umgewandelt, wenn man größere Lichtmengen in das Auge eintreten läßt. Betrachtet man z. B. eine helle Flamme durch ein rotes Glas lang genug, damit das positiv gleichfarbige Nachbild nicht auftreten kann, und schließt man nun das Auge, so erscheint in dem dunkeln Grund des Gesichtsfeldes ein außerordentlich intensiv grünes Nachbild der Flamme. Öffnet man das Auge und sieht auf eine weiße Fläche, so wird das Nachbild augenblicklich verdunkelt. Dieselbe Netzhautstelle, die bei schwacher Lichtreizung scheinbar eine gesteigerte Erregbarkeit erkennen läßt, zeigt demnach bei starker Lichtreizung verminderte Erregbarkeit: in beiden Fällen aber wird gemischtes Licht in dem zur ursprünglichen Farbe komplementären Tone gesehen. Offenbar muß daher in Bezug auf die Erregbarkeit für die verschiedenen Farbenstrahlen des gemischten Lichtes in beiden Fällen der nämliche Zustand bestehen: auch beim positiv komplementären Nachbild muß Ermüdung für die ursprünglich gesehene Farbe vorhanden sein. Daß trotzdem das Nachbild hell auf dunkelm Grunde erscheint, können wir hier nur auf den Kontrast beziehen, der überhaupt bei diesen Versuchen die Helligkeitsverhältnisse von Bild und Umgebung bestimmt. Wird ein farbiges Objekt auf gleichmäßig grauem Grund gesehen, so erscheint durch den Kontrast das Objekt heller, der Grund dunkler, als sie in Wirklichkeit sind. Hierdurch erklärt es sich denn auch, daß die positiv komplementären Nachbilder nur bei geschlossenem Auge oder im Dunkeln wahrnehmbar sind, alsbald aber in negative überspringen, wenn eine stärkere Erleuchtung des Gesichtsfeldes eintritt. Durch diesen Wechsel werden nur die Bedingungen des Kontrastes, keine der sonstigen die Empfindung bestimmenden Verhältnisse geändert 110).
109) Die positiv komplementären Nachbilder sind von Purkinje, zuerst beobachtet und dann namentlich von Brücke studiert worden (Denkschriften der Wiener Akademie III, S. 95), der sie bis in die neueste Zeit gegen die Allgemeingültigkeit der von FECHNER aufgestellten Theorie, nach der alle Nachbilder auf Ermüdung beruhen, anführte (vgl.brücke in moleschott's Untersuchungen IX, S. 13). Helmholtz hielt das positive komplementäre Nachbild für eine Mischerscheinung, welche beim Wechsel des gleichfarbigen und des gewöhnlichen negativ komplementären Nachbildes entstehe (physiol. Optik S. 384), aber er beobachtete diese Nachbilder immer erst, nachdem das objektive Licht längere Zeit aufgehört hatte zu wirken, während die von Brücke geschilderten Erscheinungen des positiv komplementären Nachbildes unmittelbar beim Schließen des Auges im dunkeln Gesichtsfelde eintreten. Es ist daher zweifelhaft, ob helmholtz bei seiner Erklärung überhaupt die positiv komplementären Nachbilder PURKINJE'S und Brücke's im Auge gehabt hat.
110) Vergl. die unten folgenden Auseinandersetzungen über den Kontrast.
Im Ganzen beruhen somit die Nachbilderscheinungen
hauptsächlich auf zwei Momenten, die in verschiedenen Fällen
bald gemischt, bald von einander isoliert zur Geltung kommen: erstens auf
dem direkt durch den Lichtreiz hervorgerufenen Erregungsvorgang, der den
Reiz immer merklich überdauert, und zweitens auf der veränderten
Reizbarkeit der Netzhaut, welche, nachdem der Erregungsvorgang vorüber
ist, eine kürzere oder längere Zeit noch zurückbleibt. Diese
veränderte Reizbarkeit verursacht unter allen Umständen das komplementäre
Nachbild, sei es negativ oder positiv; das unmittelbare Fortwirken der
Erregung dagegen kommt als gleichfarbiges Nachbild zur Erscheinung.
Das letztere kann nun unter Umständen einen
verwickelteren Verlauf darbieten, wenn der Lichtreiz nicht einfarbig sondern
gemischt war. In diesem Fall dauert nämlich die Erregung nicht immer
in der gleichen Lichtbeschaffenheit an, sondern es tritt ein Farbenwandel
ein, welcher darauf hinweist, daß die verschiedenen Farben, aus denen
sich das gemischte Licht zusammensetzt, Netzhautreizungen von verschiedenem
Verlauf hervorbringen. Wir wollen diese Erscheinung als farbiges
Abklingen kurz dauernder Lichtreizungen bezeichnen111).
111) Gewöhnlich wird sie "farbiges Abklingen der Nachbilder" genannt. Die obige Benennung scheint mir aber zweckmäßiger, um das Zusammenwerfen mit andern Nachbilderscheinungen zu vermeiden, da die kurze Dauer der Reizung bei den Versuchen, die uns hier speziell beschäftigen, durchaus wesentlich ist.
Schließt man nach momentanem Anblicken eines hell leuchtenden weißen Objekts das Auge, so wandelt sich das anfänglich positive weiße Nachbild durch Blau, Violett, Rot in das negative graue Nachbild um112). Eine ähnliche Erscheinung wird am Farbenkreisel beobachtet, wenn man der Scheibe desselben abwechselnd schwarze und weiße Sektoren gibt und eine Umdrehungsgeschwindigkeit wählt, bei welcher dieselben noch nicht zu einem gleichmäßig grauen Eindruck zusammenfließen. Man sieht dann ein farbiges Flimmern, indem bei mäßiger Geschwindigkeit jedem schwarzen Sektor eine rötliche Färbung vorangeht und eine bläuliche oder grünliche nachfolgt; bei etwas größerer Rotationsgeschwindigkeit dehnt sich die rötliche Färbung vollständig über die weißen, die blaue über die schwarzen Sektoren aus113). Diese Erscheinungen hat HELMHOLTZ aus der YOUNG'schen Hypothese erklärt, indem er für jede Art Nervenfasern einen verschiedenen Verlauf der Erregung voraussetzt. Er nimmt nämlich an, in den rot empfindenden Fasern sinke die Erregung anfänglich am schnellsten, worauf sie dann aber lange Zeit brauche, um vollständig zu verschwinden. In den grünempfindenden Fasern soll sie anfangs am langsamsten und zuletzt am schnellsten abnehmen, während die violetten ein mittleres Verhalten darbieten, wie dies die rechts von m gezeichneten Kurven in Fig. 92 versinnlichen. Hier bedeuten die horizontalen Abszissen die Zeit. Die ausgezogene Kurve stellt das Sinken der Erregung für die grünen Fasern, die punktierte für die violetten und die unterbrochene für die roten dar114). Beim Abklingen eines positiven Nachbildes sollen nun die Farben in derjenigen Reihe sich folgen, in welcher die Erregungen der einzelnen Fasergattungen abklingen. Zuerst also würde Grün überwiegen, dann käme (etwa bei 1) ein blauer Farbenton, hierauf Purpur (2) und zuletzt reines Rot (3), wobei übrigens der Grad der Ermüdung die Erscheinungen etwas modifizieren muß. Eine andere Erklärung fordert das farbige Flimmern der schwarzen und weißen Sektoren des Farbenkreisels. HELMHOLTZ nimmt an, das Maximum der Erregung falle nicht für alle Farben auf denselben Augenblick, sondern für Rot und Violett früher als für Grün115). Dem widerspricht aber das Resultat direkter Versuche, wonach bei der Reizung mit rotem Licht das Maximum der Empfindung bedeutend später als bei blauem erreicht wird116). In der Tat beweist nun auch die Tatsache, daß bei der schnellsten Rotation, bei welcher noch Farbenerscheinungen wahrnehmbar sind, die weißen Sektoren rötlich, die schwarzen blau gesehen werden, keineswegs das schnellere Ansteigen der roten Erregung, sondern, da der Verlauf der durch einen weißen Sektor hervorgebrachten Lichtreizung um so früher durch den darauf folgenden schwarzen Sektor unterbrochen wird, je schneller der Kreisel rotiert, so wird die Farbe des schwarzen Sektors mit beschleunigter Rotation den früheren Stadien des Ansteigens der Reizung sich nähern. Grün und Violett müssen also schneller das Maximum erreichen als Rot, da die schwarzen Sektoren bei schneller Rotation eine blaue, d. h. aus Grün und Violett gemischte Färbung annehmen. Die weißen Sektoren müssen dann durch Kontrast rötlich erscheinen117). Diese Wirkung des Kontrastes ist es, deren Nichtberücksichtigung wesentlich jene umgekehrte Deutung der Erscheinung veranlaßte, welche helmholtz gegeben hat. Rotiert die Scheibe langsamer, so fällt das ganze Anwachsen der Erregung, falls man nicht sehr intensives Licht wählt, in die Zeit, in welcher je ein weißer Sektor vor dem Auge vorübergeht: die schwarzen Sektoren erscheinen daher an ihren Grenzen etwas gefärbt, die weißen aber werden nun in ihrem ersten Abschnitt bläulich, in ihrem letzten rötlich gesehen. So ergibt sich denn, daß die Farbenempfindungen in derselben Reihenfolge zu ihrem Maximum ansteigen, in welcher sie wieder auf null herabsinken: zuerst erreicht nämlich die grüne, dann die violette und zuletzt die rote Empfindung ihr Maximum, wie dies in Fig. 92 links von m angedeutet ist. In einem Stadium a des ganzen Reizungsvorgangs muß hier, ähnlich wie bei 1, ein bläulicher Farbenton vorherrschen. Befindet sich nun gleichzeitig eine andere Stelle derselben Netzhaut in einem dem Zeitpunkt b entsprechenden Stadium der Reizung, so wird hier im Kontrast zu der vorigen ein rötlicher Farbenton empfunden. Läßt sich hiernach der ganze Verlauf der durch rotes, grünes oder violettes Licht bewirkten Reizung ungefähr durch die drei in Fig. 92 dargestellten Kurven versinnlichen, so liegt aber hierin keinerlei Beweis für die YOUNG'sche Hypothese. Mindestens ist die Annahme ebenso einfach, daß diese Unterschiede des Verlaufs lediglich von der Beschaffenheit der objektiven Reize abhängen, daß also grünes Licht in jeder Opticusfaser eine Reizung auslöst, die, von ihrer qualitativen Beschaffenheit abgesehen, in der Form der ersten Kurve verläuft, ebenso wie die zweite und dritte den durch violettes und rotes Licht bewirkten Reizungsvorgängen entsprechen. Für zwischenliegende Farben, z. B. Blau oder Gelb, würde dann auch die Reizungskurve eine zwischenliegende Form haben. Diese Anschauung macht überdies die Tatsache verständlicher, daß die Endfarben des Spektrums, wie in der Empfindung, so auch in dem Verlauf der von ihnen hervorgebrachten Reizung sich wieder nähern. Bei der Voraussetzung spezifisch verschiedener Endorgane ist ein solches Zusammentreffen auffallender, da die Verschiedenheit der Empfindung eben nur aus der Verschiedenheit der gereizten Nervenfasern abgeleitet wird. Dagegen bedarf diejenige Theorie, welche annimmt, jede Opticusfaser sei durch Licht aller Wellenlängen reizbar, allerdings einer andern Annahme, welche für die Anhänger der spezifischen Endorgane hinwegfällt: sie muß nämlich eine Superposition der Reizungsvorgänge statuieren, welche der Superposition der Lichtwellen entspricht. Ähnlich wie bei der Brechung im Prisma die verschiedenen Wellenlängen, die im weißen Lichte zu einer resultierenden Bewegung zusammenwirken, von einander gesondert werden können, so sind auch die einzelnen monochromatischen Reizungen, aus denen die Empfindung Weiß resultiert, unter Umständen von einander trennbar. Einen Fall dieser Art haben wir in der Tat in dem farbigen Abklingen weißer Lichteindrücke vor uns. So lange die einzelnen Reizungsvorgänge in gleicher Höhe andauern, kommt eine resultierende Reizung zu Stande, in der nichts von ihren Komponenten zu merken ist: diese werden aber, teilweise wenigstens, wahrnehmbar, wenn man die Reizung so einrichtet, daß sie deutlicher in ihrem Verlaufe verfolgt werden kann.
112) FECHNER, Poggendorff's Annalen, Bd. 50, S 445.
113) FECHNER, ebend., Bd. 45, S. 227.
114) Helmholtz, physiol. Optik, S. 372.
115) Helmholtz, physiol. Optik, S. 380, 381.
116) LAMANSKY, Archiv f. Ophthalmologie XVII, 1 S. 132.
117) Siehe die unten folgenden Erörterungen über
den Kontrast.
Wir sind genötigt gewesen, in den obigen Erörterungen, ebenso wie schon früher (s. o.), der von thomas young entwickelten Hypothese über die Entstehung der Lichtempfindungen, welche gegenwärtig, namentlich unter dem Einfluß der Lehre von den spezifischen Sinnesenergien, zur herrschenden geworden ist, entgegenzutreten. Was die Nachbilderscheinungen betrifft, so konnte es zunächst nur die Absicht sein zu zeigen, daß hier alle Erfahrungen ohne die Hilfe jener Hypothese vollkommen ebenso folgerichtig erklärt werden können als mit ihr. Ein entscheidender Wert kann den zuletzt angeführten Beobachtungen weder im einen noch im andern Sinne zuerkannt werden. Die wirklichen Gründe gegen die YOUNG'sche Annahme liegen ganz anderswo, nämlich vor allem in ihrem Zusammenhang mit den unhaltbar gewordenen spezifischen Sinnesenergien118), und sodann in den auf (s. o.) hervorgehobenen Folgerungen aus der Gestalt der nach dem Mischungsgesetz konstruierten Farbenkurve. Zu letzterem Punkte treten hier nur die in Fig. 92 ausgedrückten Erfahrungen über den verschiedenen Verlauf der einzelnen Reizungsvorgänge einigermaßen ergänzend hinzu. Wegen der Bedeutung des Gegenstandes für die ganze Lehre von der Empfindung wollen wir aber bei dieser Gelegenheit noch einige andere Erfahrungen, die zu der YOUNG'schen Hypothese in Beziehung stehen, kurz besprechen, nämlich die Folgen lange dauernder monochromatischer Reizungen und die Beobachtungen über Farbenblindheit.
118) Vergl. Kap. V.
Läßt
man in beide Augen längere Zeit nur einfarbiges Licht dringen, z.
B. rotes, indem man mehrere Stunden lang eine rote Brille trägt, so
werden die Netzhäute für Rot dergestalt ermüdet, daß
sie einige Zeit diese Farbe überhaupt nicht mehr empfinden. Gesättigtes
Rot sieht schwarz, weißliches Rot grau oder weiß aus; blaue
oder grüne Farbentöne werden dagegen wie gewöhnlich unterschieden.
Wenn nun der Eindruck Weiß aus der Reizung rot-, grün- und violettempfindender
Nervenfasern besteht, so muß es für die erste dieser drei Klassen
vollkommen gleichgültig sein, ob die Netzhaut bloß durch rotes
oder ob sie durch weißes Licht gereizt wird: in beiden Fällen
werden die rotempfindenden Nervenfasern gleich stark erregt und müssen
daher gleich stark ermüden. Letzteres ist aber nicht der Fall, sondern
in der einfarbigen Beleuchtung ist offenbar die Netzhaut für Rot viel
mehr ermüdet. Man könnte zwar behaupten, dies sei nur scheinbar,
in der weißen Beleuchtung seien alle Nervenfasern gleichmäßig
ermüdet, es bleibe aber eben deshalb unser Urteil über das Verhältnis
der einzelnen Farben ungeändert. Doch erstens würde hieraus zwar
eine Schwächung der roten Empfindung, aber kaum eine längere
Zeit bestehen bleibende totale Aufhebung derselben verständlich, und
zweitens scheint jener Erklärung das entschiedene Ermüdungsgefühl
und die abnorme Reizbarkeit, welche einer solchen monochromatischen Reizung,
namentlich mit rotem Lichte, folgt, zu widersprechen.
Die wesentlichste
Stütze der YOUNG'schen Hypothese hat man in den Beobachtungen an Farbenblinden
zu finden geglaubt. In der Regel besteht die so genannte Farbenblindheit
darin, daß die Empfindlichkeit der Netzhaut für Rot vermindert
oder gänzlich aufgehoben ist. Den betreffenden Individuen erscheint
daher ein dunkles Rot vollkommen schwarz, und sie verwechseln leicht rote
und gelbe mit grünen Farbentönen. In der Regel scheint mit der
Rotblindheit zugleich eine verminderte Empfindlichkeit für Violett
verbunden zu sein, das als ein dunkles Blau erscheint. Es mag sein, daß
in einzelnen Fällen die verminderte Empfindlichkeit für Violett
mehr noch als diejenige für Rot in die Erscheinung tritt. Auch läßt
sich, wie E. Rose119)
zuerst beobachtet hat, durch Santoninvergiftung ein auf Violettblindheit
hindeutender Zustand herbeiführen. Die Seitenteile der Netzhaut sind,
wie SCHELSKE120) nachwies,
normaler Weise für Rot unempfindlich. Bei der Atrophie des Sehnerven
tritt ferner als erste Erscheinung eine mehr oder minder ausgeprägte
Rotblindheit auf; ebenso in vielen Fällen einfacher Amblyopie121).
Nach der YOUNG'schen Hypothese führt man diese Erscheinungen einfach
darauf zurück, daß eine bestimmte Klasse von Endorganen, in
der Regel die roten, zuweilen auch die violetten, mangeln oder, bei erworbener
Farbenblindheit, gelähmt werden. Auf den Seitenteilen der Netzhaut
sollen die roten Endorgane regelmäßig fehlen. Es ist nun, wenn
die dreierlei Nervenfasern, wie YOUNG annimmt, einander gleichwertig in
der Netzhaut verteilt sind, schon auffallend, daß fast immer nur
eine Klasse derselben, nämlich die der roten, höchstens noch
zuweilen die der violetten, wahrscheinlich niemals aber die der grünen,
mangelt; denn die bisher berichteten Fälle so genannter Grünblindheit
sind von sehr zweifelhafter Art, und es haben dabei wahrscheinlich meistens
Verwechslungen mit Rotblindheit obgewaltet122).
So hat preyer über zwei Fälle angeblicher Grünblindheit
berichtet, welche nach der gelieferten Beschreibung nicht sicher von Rotblindheit
zu unterscheiden sind123).
Denn der Umstand, daß die Individuen zwar oft grün gefärbte
Gegenstände als rot, nie aber rote als grün bezeichneten, gibt
durchaus kein zuverlässiges Kriterium, da die Benennung gleich aussehender
Farben bei angeborener Farbenblindheit ganz und gar Sache der Gewohnheit
ist. Ebenso wenig entscheidet die Tatsache, daß das rote Ende des
Spektrums unverkürzt gesehen wurde, da solches auch in Fällen
entschiedener Rotblindheit vorkommt124).
Eine vorübergehende, auf ein Auge beschränkte Grünblindheit
hat ferner woinow beobachtet125).
Dieselbe war von einem Reizungszustand des ganzen Auges begleitet, welcher
sich namentlich in einer abnormen Empfindlichkeit gegen Rot und Orange
äußerte. Möglicher Weise handelt es sich in diesem Fall
nicht sowohl um eine primäre Affektion der lichtempfindenden Teile
als um eine Veränderung, welche das einfallende Licht beim Gang durch
das Auge erfuhr. Normaler Weise ist nämlich das die Netzhaut treffende
Licht durch die blutführenden Teile des Auges etwas rötlich gefärbt126),
eine Färbung, die in Folge von Congestivzuständen wahrscheinlich
bedeutend zunehmen kann. Hierdurch muß aber die Farbenempfindung
in einer ähnlichen Weise alteriert werden, als wenn man durch ein
rotes Glas sieht, d. h. es muß die Empfindlichkeit für Grün
abnehmen. Analoge Unterschiede der Empfindung können, wie zuerst maxwell
bemerkt hat, auch durch die mehr oder minder starke Pigmentierung des gelben
Flecks entstehen. Ist nämlich der gelbe Fleck sehr pigmentreich, so
rücken alle zwischen Grün und Violett gelegenen Empfindungen
weiter gegen Violett, die zu Gelb komplementäre Grundfarbe, hin: ein
grünliches Blau wird also z.B. von einem solchen Auge rein blau, das
reine Blau dagegen wird von einem ungewöhnlich pigmentarmen Auge grünblau
gesehen127). M. SCHULTZE
vermutete, das mit partieller oder totaler Violettblindheit verbundene
Gelbsehen, welches nach Santoningenuß eintritt, beruhe auf einer
vorübergehenden stärkeren Pigmentierung des gelben Flecks128).
Hiergegen spricht jedoch, daß nach den Versuchen von ROSE129)
und HÜFNER130)
zuweilen Violettsehen als primäre Erscheinung des Santoninrausches
beobachtet wird. Man hat deshalb hier im Anschluß an die YOUNG'sche
Theorie eine primäre Reizung und sekundäre Abstumpfung der violetten
Endorgane angenommen131).
Wenn nun aber auch die Erscheinungen auf den ersten Blick eine Herleitung
aus der YOUNG'schen Theorie zulassen, so ist doch eine Tatsache schwer
mit derselben zu vereinbaren: dies ist die mit der Violettblindheit immer
verbundene teilweise Unerregbarkeit für rotes Licht. Betrachtet man
dagegen die Erregung einer jeden Endfaser des Sehnerven einfach als Funktion
der Wellenlänge, so wird es vollkommen begreiflich, daß es Netzhäute
gibt, die gerade für die an der unteren und oberen Reizgrenze gelegenen
Lichtwellen, nämlich in der Regel für Rot, zuweilen auch vorzugsweise
für Violett, nicht reizbar sind, und daß ebenso auf den Seitenteilen
der Netzhaut, die überhaupt eine geringere Empfindlichkeit besitzen,
die untere Reizgrenze erst bei einem kleineren Wert der Wellenlänge
beginnt, also relative Rotblindheit existiert. Bestände endlich die
gewöhnliche Rotblindheit in einem Mangel oder in einer fehlenden Erregbarkeit
roter Endorgane, so müßten nach der durch die Mischungsversuche
von maxwell und J. J. müller festgestellten Form der Farbenkurve (Fig.
90) die Farbentöne von Grün bis Violett dem farbenblinden
Auge in vollkommen ebenso genauer Abstufung, wie dem normalen erscheinen.
Dies ist aber nicht der Fall, sondern das Violett erscheint den Rotblinden
wie ein dunkles Blau132).
Ein gewisser Grad von Violettblindheit scheint demnach immer mit der gewöhnlichen
Rotblindheit verbunden zu sein, ähnlich wie eine teilweise Rotblindheit
mit der Abstumpfung für Violett im Santoninrausch. Dies wird begreiflich,
wenn wir erwägen, daß die Rückkehr der Empfindung zu ihrem
Anfangspunkt auf eine Rückkehr des Nervenprozesses hinweist. Die Tatsache,
daß die Farbenblindheit die beiden Endfarben gleichzeitig trifft,
ist also wohl in denselben Ursachen begründet, welche auch die in
sich zurücklaufende Gestalt der Farbenkurve bedingen.
119) Virchow's Archiv XIX S. 522, XX S.
245.
120) GRAEFE's Archiv für Ophthalmologie IX 3, S.
39.
121) LEBER, Archiv f. Ophthalmologie. XV, 3, S. 45, 86.
122) Auch bei der von goethe so genannten Akyanoblepsie (Blaublindheit) handelt es sich offenbar nur um Fälle von Rotblindheit. (Farbenlehre. Didactischer Teil, 113. Nachgelassene Werke Bd. 12, S. 62.) Ältere Autoren reden ferner von einer Achromatopsie, gänzlichem Mangel der Farbenempfindung. Es ist aber sehr zweifelhaft, ob ein solcher Zustand wirklich existiert; jedenfalls fehlt durchaus der exakte Nachweis.
123) Pflüger's Archiv für Physiologie I, S. 299.
124) Über einen Fall dieser Art, wo die Rotblindheit plötzlich entstanden war, berichtet Tyndall, phil. mag. vol. XI, p. 139. Seebeck unterscheidet überhaupt zwei Klassen von Rotblinden: solche, die das prismatische Spektrum vollständig sehen, nur einzelne Teile desselben (namentlich Rot und Grün) mangelhaft unterscheiden, und andere, die den roten Anfang des Spektrums gar nicht empfinden. Bei letzteren war nach Seebeck's Beobachtungen immer die Farbenunterscheidung mangelhafter, namentlich kamen auch zwischen den vom Grün bis Violett gelegenen Farben Verwechselungen vor. (Poggendorff's Annalen, Bd. 42, S. 212.)
125) Archiv für Ophthalmologie. XVI 2, S. 246.
126) Brücke, Denkschriften der Wiener Akad. Math.-naturw.
Cl. III, S. 97.
127) Maxwell, Phil. trans, for 1860, p. 76.
128) M. SCHULTZE, über den gelben Fleck der Retina.
Bonn 1866.
129) Virchow's Archiv, Bd. 30, S. 446.
130) Archiv f. Ophthalmologie XIII 2, S. 311.
131) HÜFNER, a. a. 0., S. 312 f.
132) Vergl. Seebeck, Poggendorff's Annalen Bd. 42, S. 177. dastich, Verhandl, der königl. böhm. Gesellschaft der Wissensch. 1. Juli 1867, S. 9. Die von Seebeck untersuchten Farbenblinden bezeichneten Violett als dunkelblau. dastich fand für den seinen am Farbenkreisel die Farbengleichungen: 30 Blau + 380 Schwarz = 11 Weiß + 349 Violett, und 113 Grün + 145 Blau + 102 Schwarz = 56 Weiß + 304 Violett. Siehe auch PREYER, PFLÜGER'S Archiv I, S. 321 f. Ebenso erscheint das spektrale Violett auf den Seitenteilen der Netzhaut dunkelblau. (SCHELSKE, a. a. O.)
Die Nachbilder und die übrigen auf veränderliche
Reizbarkeit hinweisenden Erscheinungen lehren, daß die Lichtempfindung
eine Funktion nicht bloß der Wellenlänge sondern auch des jeweiligen
Zustandes der Netzhaut ist. Alle bisherigen Beobachtungen bezogen sich
aber darauf, daß die Reizbarkeit einer gegebenen Netzhautstelle teils
durch die bleibenden Eigenschaften derselben, wie individuelle Reizempfänglichkeit,
Lage in Bezug auf das Netzhautzentrum, teils durch vorangegangene Reizungen,
welche sie getroffen haben, bestimmt ist. Daneben zeigen nun weitere Erfahrungen,
daß die Lichtempfindung, welche durch Reizung einer Netzhautstelle
entsteht, zugleich Funktion des Reizungszustandes ist, in welchem sich
andere, namentlich benachbarte Stellen befinden. Die hierdurch entstehenden
Erscheinungen hat man als Kontraste bezeichnet.
Legt man von zwei schwarzen Objekten gleicher Beschaffenheit,
z. B. von zwei aus mattschwarzem Papier geschnittenen Quadraten, das eine
auf einen weißen, das andere auf einen grauen Hintergrund, so erscheint
das erste dunkler als das zweite. Ebenso sieht ein weißes Objekt
auf schwarzem Grunde heller als das nämliche Objekt auf grauem Grunde
aus. Hieraus geht hervor, daß die Helligkeit, in der ein Netzhauteindruck
empfunden wird, nicht bloß von seiner eigenen Lichtstärke, sondern
auch von der Lichtstärke seiner Umgebung abhängt, indem unsere
Empfindung um so mehr in einem bestimmten Sinne ausgeprägt ist, je
mehr sie in der Umgebung durch die Beschaffenheit des dort stattfindenden
Eindrucks nach entgegengesetzter Richtung bestimmt wird. Ebendeshalb hat
man die Erscheinung einen Gegensatz oder Kontrast der Empfindungen
genannt. In ähnlichem Sinne werden die letzteren beeinflußt,
wenn farbige Eindrücke und gleichzeitig in der Umgebung andersfarbige
Eindrücke stattfinden. Wie die Helligkeitsempfindung um so größer
ist, je stärker der Gegensatz zur Helligkeit der Umgebung, so ist
die Farbenempfindung um so gesättigter, in je größerem
Gegensatze sie sich zur Farbenempfindung umgebender Netzhautstellen befindet.
Die Farben des größten Gegensatzes sind aber die auf der Farbentafel
einander gerade gegenüberliegenden Komplementärfarben. Jede Farbe
wird daher dann in größter Sättigung empfunden, wenn die
umgebende Netzhaut von einem komplementärfarbigen Eindruck getroffen
wird. Um also die einzelnen Farben im Maximum ihrer Sättigung erscheinen
zu lassen, muß man z. B. Rot auf grünblauem, Gelb auf violettem,
Grün auf purpurrotem Grunde betrachten. Augenscheinlich besteht hier
eine Beziehung zwischen den Kontrasterscheinungen und den Nachbilderphänomenen.
Eine gegebene Netzhautstelle ist dann in einen Zustand versetzt, in welchem
sie zur möglichst gesättigten Empfindung einer Farbe disponiert
ist, wenn man sie zuvor für die Komplementärfarbe ermüdet
hat. Man hat daher auch die durch Ermüdung hervorgerufene Veränderung
als sukzessiven Kontrast bezeichnet und davon die eigentlichen Kontrasterscheinungen,
welche auf der Wechselbeziehung jeder empfindenden Stelle zu ihrer Umgebung
beruhen, als simultanen Kontrast unterschieden. Wie mit Farben,
verhält es sich mit Lichtintensitäten. Die Empfindlichkeit für
einen hellen Lichteindruck wird durch voraufgehende Lichtentziehung, also
durch Anblicken eines dunkeln Objektes, vergrößert, und ein
lichtarmes Objekt erscheint in tieferem Dunkel, wenn das Auge zuvor durch
Licht ermüdet ist. Der sukzessive kann natürlich neben dem simultanen
Kontrast bestehen, da beide ganz verschiedene Vorgänge sind. Man kann
zuerst einer Netzhautstelle durch Reizung ihrer selbst und hierauf, während
der Eindruck stattfindet, durch Reizung ihrer Umgebung mit komplementärem
Lichte oder mit entgegengesetzter Lichtintensität die möglichst
große Empfindlichkeit für einen gegebenen Lichtreiz verleihen.
Jeder Eindruck wird daher dann am entschiedensten in der ihm eigenen Farbe
und Helligkeit empfunden, wenn er ebensowohl durch sukzessiven
wie durch simultanen Kontrast gehoben ist.
Man kann leicht beobachten, daß es sehr mannigfaltige
Grade des Kontrastes gibt. Wie wir eine Netzhautstelle in verschiedenem
Maße für eine bestimmte Farbe ermüden und hierdurch die
Reizbarkeit für die ihr komplementäre vergrößern können,
indem wir kürzer oder länger, in größerer oder geringerer
Sättigung den ermüdenden Farbeneindruckwirken lassen: so sind
auch beim simultanen Kontrast die verschiedensten Abstufungen möglich.
Diese sind, wenn es sich um Farbenkontraste handelt, von dem Sättigungsgrad
der kontrastierenden Farben, und wenn es sich um Helligkeitskontraste handelt,
von der Lichtstärke der Eindrücke abhängig. Legt man ein
weißes Objekt von immer gleicher Beschaffenheit, z. B. ein Quadrat
aus weißem Papier, auf verschiedene neben einander gestellte dunkle
Flächen, die von vollkommenem Schwarz durch dunkles Grau bis zu Lichtgrau
abgestuft sind, so erscheint das weiße Objekt in abgestufter Helligkeit,
auf dem schwarzen Grunde am hellsten, auf dem lichtgrauen Grunde am wenigsten
hell. Variiert man nun aber nicht bloß die Helligkeit des Grundes,
sondern auch diejenige des Objektes, so bemerkt man, daß ein lichtgraues
Papier auf schwarzem Grunde in seiner Helligkeit verhältnismäßig
viel mehr gehoben erscheint als ein weißes Papier auf demselben schwarzen
Grunde: beide Papiere erscheinen nämlich vollkommen gleich weiß.
Es geht aus dieser Beobachtung hervor, daß der Kontrast bei einer
gewissen Helligkeitsdifferenz der Eindrücke sein Maximum erreicht,
von wo an er dann wieder abnimmt.
Bei farbigen Eindrücken läßt sich
der Grad des Kontrastes in doppelter Weise variieren: erstens indem man
den Farbenton der kontrastierenden Eindrücke verändert, und zweitens
indem man mit dem Sättigungsgrad derselben wechselt. In ersterer Beziehung
wurde schon hervorgehoben, daß Komplementärfarben das Maximum
des Kontrastes geben. Dieser vermindert sich daher, ob man die Farbentöne
einander näher oder entfernter wählt. Für die Empfindung
läuft beides wegen der geschlossenen Gestalt der Farbenkurve auf dasselbe
hinaus: hier sind alle nicht komplementären Farben einander näher
als die Ergänzungsfarben, und die Hebung durch den Kontrast vermindert
sich mit dieser Annäherung. Dabei bestehen, so lange man nur den Farbenton
ändert, die Sättigung aber konstant erhält, die eintretenden
Veränderungen ebenfalls nur in Änderungen des Farbentons. Ist
also das Maximum des Kontrastes dann erreicht, wenn die beiden Farben einander
komplementär sind, wo sie beide in der größten Reinheit
des Farbentons gesehen werden, so ändert sich dies mit der Verschiebung
der beiden Farben dergestalt, daß der Ton einer jeden in einem Sinne
modifiziert erscheint, welcher der Annäherung an das nächstliegende
Komplementärfarbenpaar entspricht. Nennen wir mit brücke
133) diejenige Farbe, welche durch eine
andere beeinflußt wird, die induzierte, diejenige dagegen,
welche den Einfluß ausübt, die induzierende, so lassen
sich die Erscheinungen der Farbeninduktion durch Kontrast am zweckmäßigsten
in der Weise studieren, daß man von derjenigen Farbe, welche man
als induzierte benützen will, Objekte von gleicher Größe
und Farbe, also z. B. Papierstücke, die mit möglichst gesättigten
Pigmenten bemalt sind, auf eine Reihe neben einander gelegter größerer
Papierstücke legt, die ungefähr nach den Hauptfarben des Spektrums
abgestuft sind. Man kann dann das farbige Objekt als die induzierte, den
andersfarbigen Hintergrund als die induzierende Farbe betrachten. Legt
man auf diese Weise z. B. rote Papierstücke neben einander auf einen
orange, gelb, gelbgrün, grün, grünblau u. s. w. gefärbten
Hintergrund, so erscheint das Rot in völlig unverändertem Farbenton
auf seinem komplementären, also dem blaugrünen Hintergrund. Schon
auf grünem erscheint es etwas in Purpur verändert, auf Gelbgrün,
Gelb, Orange nimmt es allmälig einen violetten und selbst bläulichen
Schimmer an, wogegen es sich auf Blaugrün, Blau u. s. w. mehr dem
Orange und Gelb nähert. In ähnlicher Weise bleibt Grün unverändert
auf dem ihm komplementären Purpur; auf den gegen das Ende des Spektrums
gelegenen Farben nimmt es einen gelblichen, auf den gegen den Anfang gelegenen
einen bläulichen Farbenton an. Achtet man gleichzeitig auf den Farbenton
des Grundes, so bemerkt man übrigens, daß regelmäßig
auch dieser, und zwar in entgegengesetztem Sinne verändert erscheint.
Während also z. B. Rot auf gelbem Hintergrunde einen bläulichen
Schein annimmt, erhält der gelbe Hintergrund selbst einen grünlichen
Schimmer. Jede induzierende Farbe wird somit durch diejenige, auf welche
sie induzierend wirkt, immer zugleich selbst induziert. Wir können
uns diesen wechselseitigen Einfluß beim Kontraste am einfachsten
veranschaulichen, wenn wir zwei Farbenkreise konzentrisch zu einander konstruieren,
beide aber um 360° gegen einander gedreht denken, so daß jeder
Farbe am einen Kreise die Komplementärfarbe am andern entspricht (Fig.
93)134). Denken wir uns nun
die eine der einander induzierenden Farben durch ein Segment des innern
Kreises repräsentiert, so geben die zusammentreffenden Segmente des
äußeren und inneren Kreises immer die Richtung der Veränderung
an. Wählen wir z. B. Grün auf rotem Grunde, so bedeutet dies,
da Grün mit Purpur, Rot mit Blaugrün zusammenfällt, daß
das Grün so modifiziert ist, als wenn ihm Blaugrün, das Rot so,
als wenn ihm Purpur beigemischt wäre. Wählen wir aber Grün
auf purpurrotem Grunde, so bezeichnet das Zusammentreffen beider in Fig.
93, daß sie sich in ihrem Farbenton unverändert bestehen
lassen. Als allgemeine Regel für den Farbenwechsel in Bezug auf den
Farbenton gilt also der Satz, daß jede Farbe im Sinne ihrer Komplementärfarbe
verändernd wirkt. Dies ist der Grund, weshalb man die Komplementärfarben
auch Kontrastfarben genannt hat.
133) Denkschriften der Wiener Akademie. Math.-naturw.
Cl. III, S. 98.
134) A. Rollett, Wiener Sitzungsberichte. März 1867.
Außer vom Farbenton ist die Kontrastwirkung
von der Sättigung der Farben abhängig. In dieser Beziehung
gilt das allgemeine Gesetz, daß eine Farbe um so schwerer durch Kontrast
verändert werden kann, je gesättigter sie ist. Hiervon kann man
sich bei dem oben erwähnten Versuch über die Farbeninduktion
gleichfarbiger Papierstücke auf verschiedenfarbigem Grund leicht überzeugen.
Die Veränderung wird nämlich viel deutlicher, wenn man die farbigen
Papiere mit weißem Seidenpapier oder mit einer Platte aus Milchglas
bedeckt, durch welches die Farben hindurchscheinen, aber in ihrer Sättigung
bedeutend vermindert sind. Jetzt hat z. B. ein rotes Objekt auf indigblauem
Grunde nicht mehr bloß einen gelblichen Schimmer, sondern es sieht
vollständig gelb, der indigblaue Grund aber sieht blaugrün aus.
Während man bei den gesättigten Farben trotz des Kontrastes ziemlich
leicht erkennt, daß die einzelnen aufgelegten Stücke aus demselben
Papier geschnitten sind, ist dies bei den weißlichen Farben nicht
mehr möglich, sondern man hält die Farben für durchaus verschiedene.
Da das Weiß als der geringste Sättigungsgrad
einer jeden Farbe betrachtet werden muß, so sind weiße oder
graue Objekte am günstigsten, um möglichst große Kontrastveränderungen
hervortreten zu lassen. Ein farbloses Objekt wirkt gar nicht mehr induzierend
auf einen andern Farbenton, es selbst empfängt aber von einem solchen
die größte induzierende Wirkung, indem es rein in der Kontrastfarbe,
ohne jede Beimengung einer andern Farbe, gesehen wird. Wir können
uns hiernach diese Abhängigkeit des Kontrastes vom Sättigungsgrad
am einfachsten in folgender Weise vorstellen. Eine Farbe A modifiziert
die auf einer benachbarten Netzhautstelle stattfindende Empfindung so,
als wenn der hier einwirkende Eindruck B mit einer gewissen Menge
zu A komplementärfarbigen Lichtes gemengt wäre. Die Empfindung
B muß daher der Komplementärfarbe zu A um so mehr
sich nähern, je weniger gesättigt ihr ursprünglicher Farbenton
ist, und sie geht vollständig in die Komplementärfarbe über,
wenn jene Sättigung null wird. Ein Versuch, welcher die Kontrastfarben
vorzugsweise lebhaft zur Erscheinung bringt, besteht daher in dem folgenden
von H. MEYER 135)
angegebenen Verfahren. Man bringt auf ein farbiges Papier ein kleineres
graues oder schwarzes Papierstückchen und überdeckt das Ganze
mit einem Bogen durchsichtigen Briefpapiers: es erscheint nun das graue
Feld sehr deutlich in der Kontrastfarbe. (Hierbei wird der Kontrast offenbar
noch dadurch begünstigt, daß das Briefpapier eine gleichmäßige
Fläche herstellt, auf der das Empfindungsurteil nicht durch die Begrenzung
der verschiedenen Objekte gegen einander alteriert wird. Ähnlich starke
Kontrastwirkungen erhält man daher, wenn man durch Spiegelung die
deutliche Begrenzung der Objekte aufhebt, wie in dem Versuch von RAGONI
scina (Fig. 94)136).
Man nimmt eine horizontale und eine vertikale weiße Papierfläche,
zu denen eine farbige Glasplatte unter einem Winkel geneigt ist; auf der
horizontalen Fläche bringt man ein schwarzes Papierstückchen
a an. In Folge dessen empfängt das Auge o von a
her nur reflektiertes Licht, welches fast vollkommen weiß ist, da
es großenteils an der Oberfläche der farbigen Glasplatte reflektiert
wird, überall sonst bekommt es zugleich gebrochenes Licht, welches
durch die Glasplatte stark gefärbt ist. Es erscheint nun der Fleck
a deutlich in der Komplementärfarbe der Glasplatte137).
Man kann diesen Versuch auch in folgender Weise modifizieren. Man nimmt
die vertikale Papierfläche nicht weiß, sondern schwarz, klebt
aber bei b ein weißes Papierstückchen von gleicher Größe
wie a auf, dessen Reflexbild mit a zusammenfällt. Jetzt
erscheint die Farbe der Glasplatte viel gesättigter als im vorigen
Fall, weil nur noch das von ihr durchgelassene Licht ins Auge gelangt:
wieder erscheint die Stelle a deutlich in der Komplementärfarbe.
Aber es tritt nun gleichzeitig zwischen dem hellen Spiegelbild und dem
dunkelfarbigen Grunde ein Helligkeitskontrast auf: das Spiegelbild des
weißen Papierstückchens erscheint daher heller, d. h. minder
gesättigt, als wenn man auch für den Reflex eine gleichförmig
weiße Fläche nimmt, durch welche die Farbe der Glasplatte an
Sättigung vermindert wird. Hieraus geht hervor, daß der Kontrast
nicht bloß mit der Sättigungsabnahme der induzierten Farbe wächst,
so daß er bei der Sättigung null sein Maximum erreicht, sondern
daß er bis zu einer gewissen Grenze auch mit der Sättigungsabnahme
der induzierenden Farbe zunimmt. Diese Grenze wird, falls das in der Kontrastfarbe
gesehene Objekt selbst farblos ist, dann erreicht, wenn die induzierende
Farbe hell genug ist, um mit dem induzierten Objekt Helligkeitskontrast
zu geben, und wenn sie doch noch hinreichende Sättigung besitzt, um
einen deutlichen Farbeneindruck zu verursachen. Das induzierte farblose
Objekt aber muß einerseits hinreichend dunkel sein, um Helligkeitskontrast
mit dem lichteren Grunde zu geben, anderseits muß es doch hell genug
sein, damit überhaupt noch eine Lichtreizung von gewisser Intensität
stattfindet. Die lichtschwächsten Eindrücke können, da sie
nur ein Minimum von Empfindung bewirken, auch in ihrer Empfindungsqualität
durch den Kontrast nicht erheblich geändert werden. So kommt es, daß
ein dunkles Grau auf farbigem Grunde von geringer Sättigung diejenige
Bedingung für den Kontrast darbietet, wobei die Kontrastfarbe in möglichst
großer Sättigung gesehen wird. Vermehrt man die Sättigung
des farbigen Grundes oder die Helligkeit des induzierten Objektes über
diesen günstigsten Punkt, so nimmt in beiden Fällen die Sättigung
der Kontrastfarbe ab. Dasselbe geschieht aber auch, wenn man die Helligkeit
des induzierten Objekts vermindert, weil sich nun die Farbenempfindung
in Folge der geringen Lichtintensität dem Pol des Schwarz nähert.
Hierin liegt die Erklärung für die Wirkung des durchscheinenden
Briefpapiers in MEYER'S Versuch. Bei letzterem erscheint
die Kontrastfarbe dann am meisten gesättigt, wenn man auf ein Papier
von gesättigter Farbe ein kleineres schwarzes Papierstückchen
legt und dann den Briefbogen darüber deckt. Durch den letzteren wird
die Sättigung des farbigen Grundes gerade in zureichendem Grade vermindert
und das Schwarz des Papierstückchens in ein dunkles Grau verwandelt.
Der Kontrast vermindert sich dagegen sehr, wenn man statt des schwarzen
ein weißes Papierstückchen unterlegt. Wählt man anderseits
ein sehr durchscheinendes Seidenpapier zur Bedeckung des schwarzen Papierstückchens
und seines Grundes, so muß man mehrere Bogen desselben über
einander schichten, bis dasjenige Verhältnis der Helligkeit getroffen
ist, bei welchem der Kontrast ein Maximum wird.
135) POGGENDORFF'S Annalen, Bd. 95, S. 170.
136) Helmholtz, physiologische Optik, S. 405.
137) Es ist zweckmäßig hierbei die Glasplatte probeweise hin- und herzudrehen, bis das gespiegelte Licht diejenige Helligkeit hat, bei welcher der Kontrast am schärfsten hervortritt.
Das geeignetste Mittel zur Bestimmung jener Helligkeits- und Sättigungsgrade, welche für den Kontrast am günstigsten sind, bietet der Farbenkreisel138). Gibt man der Scheibe desselben mehrere farbige Sektoren, deren jeder an einer bestimmten Stelle durch ein schwarzes Zwischenstück unterbrochen ist, wie in Fig. 95, wo die farbigen Teile der Sektoren durch graue Schattierung angedeutet sind, so erscheint bei rascher Rotation die ganze Scheibe in einem weißlichen Farbenton, an der Stelle des Zwischenstücks erscheint aber ein Ring in der Komplementärfarbe. Nun läßt sich leicht die Farbe des Grundes an Sättigung vermehren oder vermindern, indem man die Breite der Sektoren größer oder kleiner wählt, und ebenso läßt sich die Helligkeit des Ringes vermehren oder vermindern je nach der Breite, die man dem schwarzen Zwischenstück gibt. Bei einem bestimmten Verhältnis der Sektorenbreite ist aber die Sättigung der Kontrastfarbe am größten. Man findet auch hier, daß dieses günstigste Verhältnis dann erreicht wird, wenn die schwarzen Sektorenstücke für sich, also nach Bedeckung des übrigen Teils der Scheibe, bei rascher Rotation als ein dunkelgrauer Ring erscheinen, die farbigen Sektoren aber eine so schwach gesättigte Farbe erzeugen, daß dieselbe eben noch deutlich zu erkennen ist. Wird der Farbenton durch vergrößerte Sektorenbreite etwas gesättigter gewählt, so nimmt die Sättigung des durch Induktion komplementär gefärbten Ringes ab. Man kann nun diesen seiner vorigen Sättigung wieder näher bringen, wenn man auch die schwarzen Sektorenstücke etwas breiter nimmt, so daß sich dasselbe Helligkeitsverhältnis wie zuvor wieder herstellt. Aber sehr bald erreicht man eine Grenze, wo der graue Ring so dunkel wird, daß dadurch sein Farbenton wieder abnimmt. Nicht bloß das Helligkeitsverhältnis sondern auch die absolute Helligkeit der Eindrücke muß also einen bestimmten Wert besitzen, wenn der Kontrast am stärksten ausfallen soll. Doch läßt dieser Wert, teils wegen der geringen Kontrastunterschiede, die bei der Annäherung an denselben zu beobachten sind, teils wegen der variabeln subjektiven Einflüsse, insbesondere der Netzhautermüdung, keine genauere Bestimmung zu.
138) Helmholtz, physiol. Optik, S. 411.
Auf denselben Bedingungen beruhen die Komplementärfarben, welche graue Schatten auf einem farbigen Grunde zeigen. Helligkeit des Schattens und Sättigung der induzierenden Farbe stehen hierbei meistens in einem für die Erzeugung des Kontrastes günstigen Verhältnis. Dahin gehört die bekannte Erscheinung, daß die Schatten in der rötlichen Beleuchtung der Abendsonne oder des Lampenlichtes grünblau gefärbt sind. In allen möglichen Kontrastfarben lassen sich die Schatten hervorbringen, wenn man Sonnen- oder Lampenlicht durch gefärbte Gläser treten läßt und in dieser farbigen Beleuchtung Schatten entwirft. Die subjektive Natur der so auftretenden Kontrastfarben erhellt deutlich aus einer von FECHNER angegebenen Modifikation dieses Schattenversuchs139). Nimmt man nämlich eine innen geschwärzte Röhre und blickt durch dieselbe auf den farbigen Schatten, so daß aus der Umgebung desselben kein Licht in das Auge eindringt, so erscheint derselbe fortan gerade so gefärbt, als da man ihn mit freiem Auge betrachtete; die Färbung verschwindet aber selbst dann nicht, wenn man durch Wegziehen der gefärbten Glasplatte die farbige Beleuchtung aufhebt oder dieselbe durch eine zweite Glasplatte in eine andersfarbige verwandelt. Betrachtet man umgekehrt einen Schatten in weißem Lichte, der nun rein grau erscheint, durch eine Röhre, und ersetzt man, während das Auge unverrückt durchsieht, die weiße durch eine farbige Beleuchtung, so bleibt trotzdem der Schatten rein grau, falls man nicht etwa an eine Grenze desselben kommt, wo man die umgebende farbige Beleuchtung wahrnimmt, und wo dann augenblicklich die Komplementärfarbe auftritt. Dieser Versuch ist namentlich auch deshalb belehrend, weil er zeigt, wie der induzierende Farbeneindruck sogar beseitigt werden kann, ohne daß seine Wirkung schwindet: nur muß dies allerdings so geschehen, daß erstens der induzierte Eindruck ohne Unterbrechung fortdauert, und daß zweitens keine neue induzierende Wirkung dazu tritt. Die Kontrastfarbe des durch die Röhre betrachteten Schattens verschwindet daher, wenn man einige Zeit das Auge schließt und dann wieder öffnet, oder wenn man an die Grenze des Schattens kommt und die Umgebung in einer neuen Farbe beleuchtet findet. Auch überdauert die Kontrastwirkung stets nur eine gewisse Zeit die Fortdauer des induzierenden Eindrucks. Betrachtet man längere Zeit den Schalten durch die Röhre, so blaßt allmälig die Kontrastfarbe ab und schwindet endlich gänzlich.
139) POGGENDORFF'S Annalen, Bd. 50, S. 438.
Die zuletzt besprochenen Beobachtungen beweisen, daß neben der unmittelbaren Wirkung der einander induzierenden Eindrücke auch die nach früheren Eindrücken festgestellte Beschaffenheit der Empfindung von Einfluß auf den Kontrast ist. Dieses Wechselverhältnis tritt besonders in einer Reihe von Erscheinungen hervor, die wir kurz als Randwirkungen des Kontrastes bezeichnen können. Ein breiter Schatten in einer farbigen Beleuchtung erscheint an seiner Grenze gegen die letztere in deutlicher Kontrastfarbe, nimmt aber mit der Entfernung von der Grenze allmälig ab und verschwindet endlich völlig. Wählt man bei dem MEYER'schen Versuch das untergeschobene schwarze Papier sehr groß, so zeigt es nur noch am Rand deutlichen Kontrast. Am schönsten lassen sich aber die Erscheinungen des Randkontrastes wieder mittelst der rotierenden Scheiben des Farbenkreisels hervorbringen140). Bringt man auf einer weißen Scheibe schwarze Sektoren an, deren Breite sich, wie die Fig. 96 zeigt, von innen nach außen vermindert, so müßten, wenn kein Kontrast stattfände, bei der Rotation graue Ringe erscheinen, deren Helligkeit von innen nach außen abnähme, aber innerhalb eines jeden Abschnitts konstant bliebe. Doch dies ist nicht der Fall, sondern jeder Ring erscheint nach innen, wo der nächste dunklere anstößt, heller, fast weiß, nach außen, wo der nächste hellere anstößt, dunkler. Nimmt man eine Scheibe wie Fig. 95, wählt aber die beiden an die schwarzen Mittelstücke anstoßenden Sektorenabschnitte von verschiedener Farbe, z. B. die inneren rot, die äußeren gelb, so erscheint bei der Drehung auch der mittlere graue Ring in verschiedenen Kontrastfarben, nach innen nämlich grünblau, nach außen violett. Dieselbe Erscheinung läßt sich noch in der mannigfachsten Weise variieren: immer erscheint der Kontrast da am deutlichsten, wo die Helligkeit oder der Farbenton rasch sich ändert; Kontrastwirkungen in entgegengesetztem Sinne lassen sich daher nahe neben einander hervorbringen, wenn man Helligkeit oder Farbenton in nahen Abständen in entgegengesetztem Sinne sich ändern läßt 141).
140) Helmholtz, physiol. Optik, S. 413.
141) Weitere hierher gehörige Versuche siehe bei
Mach , Sitzungsber. der Wiener Akademie Bd. 52, S. 303, Bd. 54, S. 393.
Daß neben der unmittelbaren wechselseitigen Wirkung der Eindrücke auch die nach vorangegangenen Erfahrungen festgestellte Bedeutung derselben von wesentlichem Einflusse auf die Empfindung ist, ergibt sich endlich noch aus solchen Beobachtungen, bei denen durch geeignete Modifikation des Versuchs die unmittelbare Induktion ganz oder fast ganz zum Verschwinden kommt. Hier wird dann die Empfindung lediglich nach Maßgabe früherer Eindrücke festgestellt. Klebt man ein graues Papierstückchen auf eine farbige Glasplatte oder auf ein gefärbtes Papier, und wählt man auch die Helligkeitsverhältnisse möglichst günstig für die Erzeugung der Kontrastfarbe, so erscheint doch das graue Papier in der Nähe betrachtet kaum in einem Anflug der Kontrastfarbe. Begibt man sich aber in größere Entfernung, damit die scharfe Begrenzung verschwinde, so tritt die Kontrastfarbe deutlicher hervor. Hieran trägt die eintretende Verkleinerung des Netzhautbildes nicht die Schuld, wie man sich bei wechselnder Größe des aufgeklebten Papierstücks leicht überzeugen kann. Am deutlichsten zeigt sich dieser Einfluß der Begrenzung beim MEYER'schen Versuch. Legt man in die Nähe der Stelle, an welcher das in der Kontrastfarbe gesehene schwarze Papierstück durch das Briefpapier schimmert, ein graues Papierschnitzel, welches genau dieselbe Helligkeit wie das erste nach seiner Bedeckung mit dem Briefpapier besitzt, so erscheint trotzdem dieses letztere bei naher Betrachtung nur wenig in der Kontrastfarbe142). Die umgekehrte Form des Versuchs ist die folgende: man zieht auf dem Briefpapier, welches die farbige Fläche samt kontrastierendem Fleck bedeckt, eine Grenzlinie um den letzteren; augenblicklich verschwindet dann die Kontrastwirkung und stellt sich nun auch bei Betrachtung aus größerer Ferne nicht mehr ein. Ähnlich verschwindet bei den Versuchen am Farbenkreisel die Kontrastwirkung, wenn man die Stellen, an denen sich die kontrastierenden Teile der Scheibe berühren, durch eine Linie begrenzt, wenn man also in Fig. 95 an den gegen das schwarze Mittelstück gerichteten Sektorenabschnitten schwarze Kreislinien zieht, oder wenn man in Fig. 96 alle einzelnen Sektorenabschnitte durch schwarze Kreislinien von einander trennt. Offenbar sind wir demnach gegen die Kontrastwirkung so lange unempfindlicher, als ein Grund gegeben ist, die einander induzierenden Eindrücke auf gesonderte Objekte zu beziehen. Hier scheint unsere Empfindung teilweise in einen Zustand zu kommen, der ihr abgesehen von der wechselseitigen Induktion verschiedenartiger Eindrücke eigen ist. Diese Befreiung von der Kontrastwirkung kann nur darauf bezogen werden, daß der Grad, bis zu welchem eine Empfindung durch die Eindrücke anderer Netzhautstellen bestimmt wird, etwas veränderlich ist, und daß dabei der Einfluß früherer Eindrücke von gleichfarbiger Beschaffenheit mitwirkt. Die Empfindung Weiß kann einerseits modifiziert werden durch andere gleichzeitige Eindrücke, anderseits aber wirkt auf sie befestigend die Reproduktion gleichartiger Erregungszustände. Die letztere Wirkung wird im allgemeinen da überwiegen, wo wir die Empfindung auf ein besonderes Objekt beziehen und daher von den umgebenden Eindrücken mehr abstrahieren. Das nämliche Moment ist offenbar bei einer interessanten, von helmholtz gefundenen Modifikation der MEYER'schen Versuche wirksam: Wählt man ein graues Papierstückchen aus, welches dem Briefpapier auf der dunkeln Unterlage vollkommen gleich ist, und schiebt man dasselbe dicht neben diese Stelle, so kann bei aufmerksamer Vergleichung der Kontrast völlig verschwinden, kehrt aber sogleich wieder, wenn man das zum Vergleich genommene Papierstückchen entfernt.
142) Helmholtz, a. a. O., S. 404.
Auf die zuletzt erwähnten Erfahrungen gestützt hat man die Kontrasterscheinungen als Urteilstäuschungen betrachtet143). Man ging dabei von der Ansicht aus, die nach Analogie vorausgegangener Eindrücke festgestellte Empfindung sei im Grunde die richtige Empfindung, welche durch die Einflüsse des Kontrastes nur zuweilen gefälscht werden könne. Nun lehren aber gerade die Kontrasterscheinungen, daß wir ein absolutes Maß bei unserer Empfindung der Lichtqualitäten gar nicht besitzen, und der Umstand, daß die Reproduktion früher stattgehabter Eindrücke einen gewissen modifizierenden Einfluß ausübt, kann diesen Satz nicht erschüttern. Wir sind auch im Stande, die absolute Größe eines Gewichtes in unserer Empfindung zu schätzen, indem wir den gegenwärtigen Eindruck mit frühern vergleichen, aber deshalb gibt doch unsere Empfindung in keiner Weise ein absolutes, sondern nur ein relatives Maß, d. h. wir sind jeweils nur im Stande, Druckgrößen im Vergleich zu einander festzustellen. Ähnlich verhält es sich mit unsern Lichtempfindungen. Farben und Helligkeiten bestimmen wir zunächst nur in Relation zu einander. Ein Farbenton erscheint um so gesättigter, in je größerem Gegensatz er sich zu andern Farbeneindrücken befindet. Die relativ größte Sättigung hat er daher dann, wenn er im Verhältnis zu seiner Kontrastfarbe bestimmt wird. Der geringste Sättigungsgrad, d. h. das weiße Licht, erscheint, falls gleichzeitig andere Farbeneindrücke stattfinden, immer noch in einem gewissen Grade der Sättigung, also in der Kontrastfarbe zu jenen gleichzeitigen Eindrücken. Ebenso erscheint die Helligkeit eines Eindrucks um so größer, in je größerem Gegensatze sie zur Helligkeit anderer Eindrücke steht; die relativ größte Helligkeit erreicht darum die Empfindung dann, wenn sie im Verhältnis zum absoluten Dunkel bestimmt wird. Da nun die Sättigung einer Farbe zugleich Funktion der Helligkeit ist, indem sie sich von einem Maximalwert der Sättigung an sowohl mit zunehmender wie mit abnehmender Helligkeit vermindert, so ist es klar, daß auch die Wechselbeziehung der Farbeneindrücke von ihrer Helligkeit oder ihrem Sättigungsgrad abhängig sein muß, wie dies uns in der Tat die Erfahrung bestätigt hat. Neben dieser Wechselbeziehung der gleichzeitig gegebenen Eindrücke übt nun aber allerdings auch die Erinnerung ihren Einfluß auf die Empfindung aus. Wo das erste Moment ganz fehlt, da wird dann bloß nach dem letzteren, mittelst der Reproduktion früherer Eindrücke, die Empfindung festgestellt; und sie kann einen mitbestimmenden Einfluß selbst da noch äußern, wo mehrere Eindrücke in gleichzeitiger Gegenwirkung gegeben sind. Aber der Natur der Sache nach ist die Feststellung der Empfindung nach der wechselseitigen Beziehung gleichzeitiger Reize beim Gesichtssinn das Primäre, die Beziehung auf früher stattgehabte Empfindungen ein Sekundäres, weil hier die Wechselwirkung gleichzeitiger Eindrücke ihrer Sukzession vorangeht. Jene Theorie der Kontrasterscheinungen, welche dieselben auf eine Urteilstäuschung zurückführt, begeht also den Fehler, daß sie den wahren Zusammenhang der Dinge geradezu umkehrt, indem sie das Spätere, die immer unvollkommen bleibende absolute Bestimmung der Empfindungen mittelst der Reproduktionsgesetze, zum Ursprünglichen macht. Daß im Gegenteil die Wechselbeziehung der Eindrücke, wie sie in den Kontrasterscheinungen zu Tage tritt, das Ursprüngliche ist, geht auch klar genug aus der näheren Betrachtung jener Fälle hervor, in denen der Kontrast mit Hilfe der hinzutretenden Reproduktion beseitigt wird. Der Kontrast erscheint überall da, wo die Empfindungen möglichst losgelöst von ihrer Beziehung auf gesonderte Gegenstände in Frage kommen, wogegen der Kontrast unterdrückt wird, sobald man entweder genötigt ist, jeden Eindruck auf ein für sich bestehendes Objekt zu beziehen, das dann die Reproduktion früher gesehener ähnlicher Objekte wachruft, oder sobald man unmittelbar die Vergleichung mit selbständig gegebenen Eindrücken herausfordert. So lange wir es mit der reinen Empfindung zu tun haben, herrscht also unbedingt die wechselseitige Induktion der Reize, diese wird erst beschränkt, wenn wir auf das Gebiet der eigentlichen Vorstellung und der mit der Vorstellung zusammenhängenden Reproduktionsgesetze übergehen. Nur in dem einen Punkte ist die Theorie der Urteilstäuschungen auf der richtigen Spur, daß sie einen psychologischen Erklärungsgrund aufsucht. An objektive, physikalische Ursachen ist bei den Kontrasterscheinungen natürlich nicht zu denken; dies folgt, von der sonstigen Unwahrscheinlichkeit einer derartigen Annahme abgesehen, unmittelbar aus den FECHNER'schen Schattenversucben144). Aber auch eine physiologische Erklärung, also die Zurückführung auf eine unmittelbare physiologische Wechselwirkung gleichzeitig gereizter Netzhautstellen, stößt auf die Schwierigkeil, daß es kaum begreiflich scheint, wie eine solche durch entschieden psychologische Faktoren, wie z. B. die Beziehung des Eindrucks auf ein gesondertes Objekt oder seine Vergleichung mit andern, sei es gleichzeitig, sei es früher gegebenen Eindrücken, beeinflußt werden soll. Wohl aber wird dieser Einfluß dann vollkommen verständlich, wenn wir die unmittelbare Wechselbeziehung der Farben, ihrer Sättigungsgrade und Helligkeiten auf einen psychologischen Grund zurückführen, wo dann das nächste psychologische Resultat leicht durch weitere Momente des psychischen Mechanismus modifiziert werden kann. Ein psychologischer Grund ist es nun, wenn wir jene Wechselbeziehung darin sehen, daß die Qualitäten der Lichtempfindung ursprünglich nur in Relation zu einander bestimmt werden. Es ist dies allerdings ein Motiv, welches gewissermaßen auf der Grenze des Physiologischen steht, so daß es begreiflich wird, wie die Kontrasterscheinungen überall mit der Gewalt ursprünglicher Empfindungen auftreten. Sie sind in der Tat nicht mehr und nicht weniger psychologisch, als es die Empfindungen, diese einfachsten Zustände unseres Bewußtseins, selber sind.
143) Helmholtz, ebend. S. 393.
144) Vgl. FECHNER, Poggendorff's Annalen Bd. 44, S. 121, wo die Meinung verschiedener Beobachter, nach welcher die farbigen Schatten auf objektiven Ursachen beruhen sollten, ausführlich widerlegt ist.
Jede Empfindung ist nach Intensität und Qualität
veränderlich. Die Kontrasterscheinungen bezeugen nun nichts anderes
als die Tatsache, daß die Intensität und die Qualität der
Lichtempfindung stets im Verhältnis zu denjenigen Eindrücken
festgestellt werden, welche gleichzeitig auf andere Stellen derselben Netzhaut
einwirken. Sie lehren, daß alle Lichteindrücke in Beziehung
zu einander empfunden werden. Wir empfinden einen Reiz zunächst
nach seinem Verhältnis zu andern Reizen, die gleichzeitig einwirken,
dann aber auch nach seinem Verhältnis zu andern Reizen, die früher
eingewirkt haben. In letzterer Beziehung haben wir uns aus der Sukzession
zahlreicher Reizungen allmälig ein gewisses, freilich sehr unvollkommenes
und fortwährend durch neue Eindrücke bestimmbares, absolutes
Maß der Lichtqualität gebildet, das unter solchen Umständen,
welche die Treue der Reproduktion begünstigen, verändernd auf
die unmittelbare Empfindung einwirken kann. Aber das eigentliche Gesetz
für die Beziehung der Eindrücke zur Empfindung läßt
sich doch nur aus denjenigen Beobachtungen entnehmen, in welchen die unmittelbare
Wechselwirkung der Empfindungen, unverändert durch die Einflüsse
der Wiedererinnerung zu Tage tritt. Um daher für das Gesetz des Kontrastes
einen quantitativen Ausdruck zu gewinnen, müssen wir zunächst
diese aus der Sukzession der Vorstellungen hervorgehenden Einflüsse
möglichst bei Seite lassen und sodann Kontrasterscheinungen derselben
Art mit Variation derjenigen quantitativ bestimmbaren Elemente, welche
die Lebhaftigkeit des Kontrastes beeinflussen, hervorbringen. Diese Elemente
sind aber Farbenton, Sättigungsgrad und Helligkeit oder, wenn wir
der Einfachheit wegen den Farbenton konstant erhalten, bloß Sättigungsgrad
und Helligkeit. Beide Elemente sind nun, dies steht einer umfangreichen
quantitativen Feststellung im Wege, nicht unabhängig von einander
veränderlich, weil mit der Helligkeit im allgemeinen immer auch der
Sättigungsgrad sich verändert. Es gibt nur einen Grenzfall,
wo dies nicht eintritt: er ist dann vorhanden, wenn die Sättigung
null ist, was der Empfindung Weiß, Grau oder Schwarz entspricht.
Damit sind wir auf das Gebiet der bloßen Helligkeitskontraste
hingewiesen. Nur bei ihnen ist die Empfindung einfach das Resultat des
Helligkeitsverhältnisses der Eindrücke. Hier bieten aber die
Versuche am Farbenkreisel den nabeliegendsten Weg der Lösung dar.
An einer Scheibe, wie der in Fig.
96 abgebildeten, kann man in doppelter Weise die Helligkeit
der einzelnen bei der Rotation gesehenen grauen Ringe verändern: man
kann nämlich entweder das Verhältnis der Helligkeiten der verschiedenen
Ringe zu einander verändern, oder man kann dieses Verhältnis
konstant erhalten, aber die absolute Helligkeit variieren. Ersteres geschieht
dadurch, daß man den verschiedenen Sektorenabschnitten in verschiedenen
Versuchen ein wechselndes Verhältnis der Breite gibt. Man findet,
daß damit auch die Stärke des Kontrastes bedeutend wechselt.
Das Zweite, die Variation der absoluten Helligkeit bei konstant erhaltenem
Helligkeitsverhältnis, kann man dadurch erzielen, daß man immer
dieselbe Scheibe mit den nämlichen Sektoren wählt, sie aber während
der Rotation mit mehr oder weniger intensivem Lichte beleuchtet, oder aber
sie durch graue Gläser betrachtet und so die absolute Helligkeit aller
grauen Ringe gleichmäßig vermindert. Auf diese Weise findet
man, daß die absolute Helligkeit innerhalb sehr weiter Grenzen variiert
werden kann, ohne daß sich die Deutlichkeit des Kontrastes irgendwie
verändert. Erst bei sehr starker Verdunkelung der Scheibe oder bei
blendender Beleuchtung schwindet der Kontrast, indem die Scheibe im ersten
Fall fast ganz schwarz, im zweiten fast ganz weiß gesehen wird145).
Sehen wir aber von diesen Grenzfällen ab, welche offenbar den bei
Untersuchung der Intensität der Empfindung aufgefundenen Grenzwerten
entsprechen, so läßt das Gesetz des Helligkeitskontrastes folgendermaßen
sich formulieren: Der Unterschied der Empfindungen bleibt derselbe,
so lange das Helligkeitsverhältnis der einwirkenden Lichtreize konstant
erhallen wird. Man erkennt unmittelbar, daß dies das nämliche
Gesetz ist, welches allgemein die Abhängigkeit der Empfindungsstärke
von den einwirkenden Reizen beherrscht. Somit ist der Helligkeitskontrast
nur eine besondere Form des psychophysischen Gesetzes, nach welchem der
Unterschied zweier Empfindungen der Differenz ihrer Logarithmen proportional
ist146). Nach der vollständigen
Analogie aller Erscheinungen des Farbenkontrastes wird man aber nicht anstehen,
auf diesen das nämliche Gesetz zu übertragen, wenn auch seiner
direkten experimentellen Nachweisung hier vorerst unüberwindliche
Schwierigkeiten im Wege stehen. In der Tat lehren ja die Kontrasterscheinungen
nichts anderes, als daß wir die Lichteindrücke in der Empfindung
nach ihrem wechselseitigen Verhältnisse bestimmen, ähnlich wie
dies mit den Intensitäten aller Empfindungen und mit den Qualitäten
der Tonempfindung, den Tonhöhen, auch der Fall ist. Im Gebiete des
Lichtsinnes werden die Erscheinungen nur durch das gegenseitige Verhältnis
von Lichtstärke und Farbensättigung verwickelter. Außerdem
bilden sich hier, was mit der Eigenschaft des Auges räumliche Vorstellungen
der Objekte zu erzeugen in Verbindung steht, aus den Residuen früherer
Eindrücke festere Beziehungspunkte für die Beurteilung der neu
einwirkenden Reize, wodurch die einfache Wechselbeziehung der letzteren
gestört werden kann.
145) Ehe bei abnehmender Beleuchtung die volle Verdunkelung der Scheibe eintritt, bemerkt man, daß die Rotationsgeschwindigkeit gesteigert werden muß, um ein kontinuierliches Grau hervorzubringen. Bei derselben Schnelligkeit, bei welcher in stärkerer Beleuchtung die Eindrücke eben verschmelzen, erscheinen also durch graue Gläser die Sektoren noch flimmernd.
146) Mathematisch kann das psychophysische Gesetz für
diesen Fall unmittelbar in folgender Weise abgeleitet werden. Bezeichnen
wir die an der Grenze zweier Helligkeiten H und H' stattfindenden
Empfindungen mit E und E', so läßt sich dem Satz,
daß der Kontrast der Empfindungen derselbe bleibt, wenn das Helligkeitsverhältnis
der einwirkenden Lichtreize konstant erhalten wird, die mathematische Form
geben:
![]()
worin durch das Zeichen f irgend eine näher
zu bestimmende Funktion, z. B.
 .
.
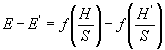 oder
oder 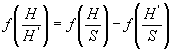 .
.
Die letztere Beziehung ist aber nur dann möglich, wenn die in Rede stehende Function f die logarithmische, oder
Hiermit sind wir aber dahin gelangt, das psychophysische Gesetz wirklich als ein allgemeinstes, wie für die Intensität so wahrscheinlich auch für die Qualität aller Empfindungen gültiges Grundgesetz erwiesen zu haben. Nach seiner psychologischen Bedeutung können wir dasselbe ein allgemeines Gesetz der Beziehung nennen. Denn es drückt aus, daß unsere Empfindung kein absolutes, sondern nur ein relatives Maß der äußern Eindrücke gibt. Reizstärken, Tonhöhen und Lichtqualitäten empfinden wir im allgemeinen nur nach ihrer wechselseitigen Beziehung, nicht nach irgend einer unveränderlich festgestellten Einheit, die mit dem Eindruck oder vor demselben gegeben wäre.
Die Erscheinungen des Kontrastes sind von den früheren Beobachtern stets auf physiologische Veränderungen der Netzhauterregung bezogen und in dieser Hinsicht mit den Nachbildern in Parallele gebracht worden. Wie bei den letzteren sukzessiv die Netzhaut für entgegengesetzte Erregungszustände disponiert werde, so sollte dies beim Kontrast simultan geschehen147), daher auch beide von chevreul als sukzessiver und simultaner Kontrast unterschieden wurden148). fechner zeigte, daß manche Erscheinungen, die man dem simultanen Kontrast zugerechnet hatte, auf einen sukzessiven, auf eine Veränderung der Lichtempfindung durch Nachbilder zu beziehen seien, bewies aber anderseits auch die Unabhängigkeit anderer Kontrasterscheinungen von den Nachbildern und stellte in Bezug auf eines der auffallendsten Kontrastphänomene, die farbigen Schatten, bereits die Mitwirkung eines psychologischen Faktors fest149). Nähere Nachweise über die Bedingungen des Kontrastes wurden von brücke 150) und H MEYER.151) gegeben, wobei namentlich letzterer schon auf die Abhängigkeit vom Sättigungsgrad der Farben aufmerksam machte. Der bisher geltenden physiologischen Theorie setzte endlich helmholtz eine psychologische entgegen152), die zunächst die empiristische Form annahm und sich namentlich auf die MEYER'schen Versuche stützte. Er wies mit Recht darauf hin, daß der Kontrast bedeutend vermindert wird, sobald wir den induzierten Eindruck auf ein gesondertes Objekt beziehen, verkannte aber, wie ich glaube, die wahre Bedeutung der Sättigungsverhältnisse der kontrastierenden Farben, weil er zu sehr an die speziellen Bedingungen des MEYER'schen Versuchs sich hielt. Die kontrasterhöhende Wirkung des bedeckenden Briefpapiers bezieht nämlich helmholtz darauf, daß wir den grauen Fleck scheinbar durch eine farbige Bedeckung sehen sollen. Befindet sich z. B. ein graues Papierstückchen auf rotem Grunde, und decken wir nun ein durchscheinendes Papier darüber, so sollen wir Alles durch ein gleichförmig gefärbtes rosarotes Papier zu sehen glauben: ein Objekt, welches durch ein rosarotes Medium gesehen grau empfunden wird, müsse aber grünlich blau sein, und daher erscheine der graue Fleck in dieser Farbe. Ähnlich ist seine Erklärung des Versuchs von Ragoni Scina mit der spiegelnden Glasplatte. Demzufolge sieht Helmholtz die Kontrasterscheinungen im wesentlichen als Urteilstäuschungen an. Bei den farbigen Schatten vollzieht sich nach ihm diese Täuschung in folgender Weise: Wir sind gewohnt das verbreitete Tageslicht weiß zu sehen; ist nun ausnahmsweise dasselbe nicht weiß, sondern rötlich, so ignorieren wir diese Abweichung ganz oder teilweise; wenn wir aber eine rötliche Beleuchtung weiß sehen, so muß uns ein in Wirklichkeit grauer Schatten so erscheinen, als wenn ihm zu Weiß etwas rotes Licht fehlte, also grünblau. Gegen diese Theorie erheben sich jedoch schon mit Rücksicht auf die Ausführung der Versuche erhebliche Bedenken. Wenn beim MEYER'schen Versuch wirklich die Täuschung obwaltete, daß wir durch ein gefärbtes Papier zu sehen glauben, so müßte der Kontrast um so intensiver sein, je mehr das Papier gefärbt ist, je durchscheinender man also die Bedeckung nimmt: dies ist aber nicht der Fall, sondern man findet, daß eine sehr dünne Bedeckung auf gesättigtem Grunde fast gar keinen Kontrast gibt, daß das bedeckende Papier also offenbar durch die Abnahme der Sättigung wirkt. Ähnlich ist beim Versuch von RAGONI scina diejenige Stellung der Glasplatte die günstigste, bei welcher sich hinreichend viel weißes Lieht beigemischt hat. Was ferner die farbigen Schatten betrifft, so sind dieselben dann ganz besonders deutlich, wenn man die gefärbte Beschaffenheit der Beleuchtung gut erkennt, wenn man also z. B. nur ein beschränktes Feld farbig beleuchtet: der graue Schatten innerhalb dieses Feldes erscheint dann außerordentlich deutlich in der Komplementärfarbe, obgleich man nicht den geringsten Grund hat die Farbe des Feldes mit der des Tageslichtes, gegen welche sie sich deutlich abhebt, zu verwechseln. Auf die Farben- und Helligkeitskontraste an der rotierenden Scheibe des Farbenkreisels sind endlich alle diese Erklärungen gar nicht anwendbar. Die Theorie der Urteilstäuschungen begeht den Fehler, daß sie die Empfindung als etwas Absolutes ansieht, von der dann die Kontrastphänomene auffallende Ausnahmen bilden. Es ist nun allerdings nicht zu bestreiten, daß die Reproduktion früherer Eindrücke oder die direkte Vergleichung mit einem andern, unabhängigen Eindruck die Empfindung beeinflussen kann. Aber es modifiziert dann diese Vergleichung umgekehrt die ursprüngliche Empfindung, welche sich in Qualität und Intensität überall nach dem Verhältnis zu andern Empfindungen feststellt. Darum bilden auch jene Modifikationen der Empfindung durch Reproduktion und Vergleichung keine eigentliche Ausnahme von dem Gesetz der Beziehung, wie wir es oben formuliert haben, sondern es tritt bei ihnen nur die Beziehung zu früheren oder zu unabhängig stattfindenden Eindrücken an die Stelle der für die ursprüngliche Empfindung näher liegenden Beziehung zu den unmittelbar mit einander einwirkenden Reizen. Die gezwungene Deutung, welche die HELMHOLTZ'sche Theorie den meisten Kontrasterscheinungen gibt, ist wohl die Ursache gewesen, daß auch nach Aufstellung derselben eine Reihe von Beobachtern, wie FECHNER153), ROLLETT154), E. MACH155), an der Hypothese einer physiologischen Wechselwirkung der Netzhautstellen festhielten, wenn sie auch für einzelne Fälle das Hereingreifen eines so genannten Urteilsprozesses zuzugeben geneigt waren. Aber der Nachweis, daß eine Netzhautstelle den Reizungszustand der andern direkt beeinflußt, läßt sich nirgends führen, und so muß wohl der psychologische Ursprung der Kontrasterscheinungen zugegeben werden. Auf die Beziehung der letzteren zu dem psychophysischen Gesetz habe ich bereits früher hingewiesen156) , ohne dieselbe aber als eine so unmittelbare zu erkennen, wie ich sie oben nach den Beobachtungen über Helligkeitskontraste darzustellen versuchte; auch schloß ich mich damals im einzelnen noch der HELMHOLTZ'schen Theorie der Kontrasterscheinungen an, auf deren Unhaltbarkeit ich erst durch die oben auseinandergesetzten Tatsachen geführt wurde.
147) Plateau, ann. de chimie et de phys. t. 58, p. 339,
148) CHEVREUL, mém. de l'acad. des sciences.
XI, p. 447.
149) Fechner, POGGENDORFF'S Ann. Bd. 44, S. 221, 513, und Bd. 50, S. 193, 427. Ergänzungen dazu in den Berichten der sächs. Gesellsch. 1860, S. 71.
150) Poggendorff's Ann. Bd. 84, S. 424. Denkschriften
der Wiener Akademie, III, S. 95. Sitzungsber. derselben. Bd. 49, S. 1.
151) POGGENDORFF'S Annalen, Bd. 95, S. 170.
152) Physiologische Optik, S. 388 f.
153) Leipziger Berichte 1860. S. 131.
154) Wiener Sitzungsber. Bd. 55. April 1867. Separatabdruck
S. 21.
155) Ebend. Bd. 52, S. 317. Vierteljahrsschr. f. Psychiatrie
II, 1868. S. 46.
156) Vorlesungen über die Menschen- und Tierseele
I, S. 198.
Auch der psychologischen Bedeutung des psychophysischen Gesetzes im allgemeinen habe ich einen etwas andern Ausdruck zu geben gesucht, als früher. FECHNER, der dieses Gesetz in die Psychologie einführte, hat die Frage nach seiner Bedeutung ganz unerörtert gelassen; er hebt nur hervor, daß es ohne Zweifel als ein zwischen dem Nervenprozeß, der von ihm so genannten psychophysischen Tätigkeit, und der Empfindung gültiges, also im eigentlichen Sinne als ein psychophysisches Gesetz zu betrachten sei, und daß die scheinbaren Ausnahmen von demselben wohl immer auf eine Disproportionalität zwischen Reiz und Nervenprozeß zurückgeführt werden müssten157). Die letztere Bemerkung geht namentlich gegen diejenige Ansicht, welche demselben lediglich die Bedeutung einer empirischen Formel gibt, für die unter Umständen auch andere Näherungsformeln eintreten könnten158). Ich habe versucht die psychologische Natur des Gesetzes anschaulich zu machen, indem ich es auf einen Akt der Vergleichung zurückführte und die Empfindung, insofern sie durch das psychophysische Gesetz bestimmt ist, einen Vergleichungsschluß nannte, als dessen Grundlage die Tatsache angesehen werden müsse, daß wir in der Empfindung im allgemeinen nur ein relatives, kein absolutes Maß der äußern Eindrücke besitzen159). Hierin ist im wesentlichen schon das nämliche angedeutet, was ich oben in der Auffassung des psychophysischen Gesetzes als eines allgemeinen Gesetzes der Beziehung auszudrücken suchte; nur ist in der früheren Darstellung die logische Einkleidung gewählt, von welcher ich hier abgesehen habe, weil sie leicht zu dem Mißverständnisse Veranlassung geben kann, als handle es sich wirklich um Urteile und Schlüsse derselben Art, wie wir sie als Ergebnisse unserer Verstandestätigkeit kennen. Die Möglichkeit einer logischen Einkleidung ist hier wie überall gleichsam eine Probe darauf, daß wir es mit psychologischen Vorgängen zu tun haben; da aber die eigenste Natur dieser Vorgänge durch die logische Form nicht wiedergegeben wird, so ist es wohl zweckmäßiger, in einer psychologischen Darstellung von jener Einkleidung abzusehen. Die allgemeine Frage, wie sich die ursprünglichsten psychischen Prozesse der Empfindung und der Vorstellungsbildung zu den Akten bewußter Verstandestätigkeit verhalten, bewahren wir einem späteren Orte vor160).
157) Psychophysik II, S. 428 f., S. 564.
158) Vgl. Helmholtz, physiologische Optik S, 316 und
AUBERT, Physiologie der Netzhaut S. 68.
159) Vorlesungen über die Menschen- und Tierseele
I, S. 133 f.
160) Vergl. Kap. XVI u. XIX.
Eine Ableitung des psychophysischen
Gesetzes aus dem Prinzip der Zweckmäßigkeit hat J.
J. MÜLLER
versucht161). Das
psychophysische Gesetz sagt nämlich aus, daß 1) der Empfindungsunterschied
derselbe bleibt, wenn das Reizverhältnis konstant erhalten wird, und
daß 2) die Empfindung erst bei einem bestimmten endlichen Wert des
Reizes, dem Schwellenwerte, beginnt, wobei die Größe des Schwellenwertes
offenbar durch die Erregbarkeit der nervösen Organe mitbestimmt wird.
Nehmen wir nun an, es verändere sieh die Empfindung dadurch, daß
bloß der Reiz variiert wird, während die Erregbarkeit, also
der Schwellenwert S des Reizes, derselbe bleibt: dann werden die
durch zwei Reize R und R' erzeugten Empfindungen E
und E' ausgedrückt durch die Formeln
![]() und
und ![]() , also ist der Empfindungsunterschied
, also ist der Empfindungsunterschied
![]() ,
,
d. h. der Unterschied zweier Empfindungen
ist bloß von dem Verhältnis der Reize, nicht von der Reizbarkeit
der nervösen Organe abhängig, da der ihr reziproke Schwellenwert
in der Formel verschwindet. Nehmen wir dagegen an, der Empfindungsunterschied
sei durch veränderte Reizbarkeit, also durch Veränderung des
Schwellenwertes verursacht, so wird
161) Berichte der sächs. Gesellschaft der Wissensch.
Math.-phys. Cl. 1870, S. 328.
162) J. J. MÜLLER hat eine andere, weniger elementare
Ableitung gegeben (a, a. O., S. 330 f.).
Eine physiologische Erklärung des psychophysischen Gesetzes hat endlich J. BERNSTEIN zu geben versucht163). Er vermutet, daß die langsamere Steigerung der Empfindung mit wachsendem Reize in einem Widerstande ihren Grund habe, welcher sich der Fortpflanzung der Erregung entgegensetze, indem er sich dabei auf die Hemmungserscheinungen beruft, die von der zentralen Substanz ausgehen164). Um nun die logarithmische Funktion zu erklären, setzt er voraus 1) daß die Hemmung innerhalb der zentralen Substanz proportional der Größe des Reizes sei, und 2) daß wir die Intensität einer Empfindung nach dem Wege abschätzen, welchen die Erregung im Zentrum zurücklegt. Diese Hypothese scheint mir aber eine außerordentlich geringe innere Wahrscheinlichkeit zu besitzen. Die beiden Voraussetzungen sind eben nur gemacht, um das psychophysische Gesetz zu finden, im übrigen ganz und gar willkürlich. Die psychologische Theorie, die wir oben entwickelt haben, geht dagegen, wie dies auch fechner tut, von der ganz entgegengesetzten und offenbar viel wahrscheinlicheren Annahme aus, daß innerhalb der Grenzen, zwischen denen das Gesetz gilt, Proportionalität zwischen Reiz und Nervenprozeß bestehe. Diese Annahme führt keineswegs, wie bernstein glaubt165), zu dem absurden Schlusse, daß wir für die natürlichen Logarithmen einen angeborenen Sinn haben, sondern die logarithmische Funktion ist eben nur der mathematische Ausdruck für das allgemeine Gesetz der Beziehung, welches unsere Empfindung beherrscht.
163) REICHERT'S und du BOIS Reymond's Archiv. 1868. S.
388. Untersuchungen über den Erregungsvorgang S. 178.
164) Vergl. Absch. I, Kap. VI.
165) REICHERT'S und du BOIS' Archiv a, a, O., S. 392.