Achtes Kapitel.
Intensität der Empfindung.
Daß die Intensität der Empfindung mit der Stärke der
Reizbewegung zu- und abnimmt, ist in allen Sinnesgebieten ein aus der alltäglichen
Erfahrung geläufiger Satz. Wenn die schall- oder lichterzeugende Bewegung
oder die Masse, die auf unsere Haut drückt, vermehrt wird, sehen wir
regelmäßig auch unsere Empfindung wachsen. Diese selbst ist
daher das natürliche Maß für die Intensität der äußern
bewegenden Kräfte, welches ursprünglich von dem Vorgang, den
es messen soll, gar nicht unterschieden wird. So hat sich denn auch lange
Zeit die Annahme als eine selbstverständliche erhalten, daß
die Stärke der Empfindung genau der Stärke des Reizes entspreche,
oder daß mit andern Worten zwischen beiden das einfachste Gesetz
wechselseitiger Beziehung, das der Proportionalität, bestehe1).
Dennoch macht eine nahe liegende Erwägung alsbald begreiflich, daß
diese einfachste Beziehung zwischen Empfindung und Reiz, wenn sie überhaupt
existieren sollte, nur zwischen gewissen Grenzen möglich wäre.
Die unmittelbare Erfahrung lehrt nämlich, daß es einerseits
eine untere Grenze gibt, diesseits welcher die Reizbewegung zu schwach
ist, um eine merkliche Empfindung zu verursachen, und daß anderseits
eine obere Grenze existiert, über die hinaus eine Steigerung der Reizstärke
die Intensität der Empfindung nicht mehr weiter zunehmen läßt.
Man bezeichnet jene erste Grenze als die Reizschwelle, die zweite
wollen wir die Reizhöhe nennen2).
Die Tatsachen der Reizschwelle und der Reizhöhe bedeuten somit, daß
die Empfindung nicht bei einem unendlich kleinen, sondern erst bei einem
endlichen Wert der Reizstarke, dem Schwellenwert des Reizes, beginnt,
und daß sie nicht bis zu einem unendlich großen Wert gesteigert
werden kann, sondern bereits bei einer gewissen endlichen Maximalstärke,
dem Höhenwert des Reizes, zu wachsen aufhört. Sollte sich
demnach die Empfindung proportional dem Reize verändern, so wäre
solches jedenfalls nur zwischen diesen beiden Grenzwerten möglich.
1) Es ist bezeichnend, daß noch derjenige Philosoph,
der den Gedanken der psychischen Messung zuerst zur Ausführung zu
bringen suchte, herbart, jene Annahme als eine selbstverständliche
ansieht, indem er die Behauptung von fries, für die intensiven Größen
des geistigen Lebens könne keine Einheit gegeben werden, mit den Worten
zurückweist: "In der Region, wo die Fundamente der Psychologie liegen
.... wird man ganz einfach sagen, daß zwei Lichter doppelt so stark
leuchten als eins, daß drei Saiten auf einer Taste dreimal so stark
tönen als eine" u, s. w. Werke Bd. 7. S. 358.
2) Der metaphorische Ausdruck Schwelle rührt von
Herbart her. Er nannte diejenige Grenze, welche die Vorstellungen bei ihrem
Bewußtwerden zu überschreiten scheinen, die Schwelle des Bewußtseins.
(Psychologie als Wissenschaft, Werke Bd. 5, S. 541.) Von FECHNER wurde
dieser Ausdruck auf das Empfindungsmaß übertragen. (Elemente
der Psychophysik I, S. 238.) Es scheint mir angemessen für den der
Schwelle gegenüberstehenden maximalen Grenzwert ebenfalls eine kurze
Bezeichnung einzuführen, wofür ich den Ausdruck Reizhöhe
vorschlage.
Die Reizschwelle und Reizhöhe können von den physischen Organisationsverhältnissen
abhängen, oder auf einem Grundgesetz der Empfindung beruhen, also
psychologischen Ursprungs sein, oder sie können endlich in beiden
Bedingungen ihren Grund haben. In der Tat gilt für das Verhältnis
der Vorgänge in den Nervenelementen zu den sie verursachenden Reizen
ebenfalls das Gesetz, daß eine Veränderung jener Vorgänge
oder, wie wir dieselben allgemein bezeichnen wollen, des Nervenprozesses
mit der Veränderung der äußeren Reizbewegung nur zwischen
gewissen endlichen Grenzwerten stattfindet, die wir den physischenSchwellenwert
und den physischen Höhenwert des Reizes nennen können3).
Die Bewegungsvorgänge in den Nerven besitzen nämlich eine gewisse
Trägheit, vermöge deren sie erst in Gang kommen, wenn der verursachende
Reiz eine gewisse Stärke erreicht hat. Anderseits aber ist der Kraftvorrat
der Nervenelemente ein begrenzter; bei einer gewissen Stärke wird
also der Reiz alle überhaupt disponibeln Kräfte auslösen,
so daß darüber hinaus der Nervenprozeß nicht mehr gesteigert
werden kann. Es fragt sich daher, ob der psychische Schwellen- und
Höhenwert des Reizes mit dem physischen zusammenfällt, oder ob
er davon verschieden ist. Diese Erwägung führt unmittelbar auf
eine wichtige Vorfrage. Es ist nämlich klar, daß es fruchtlos
sein würde nach der gesetzlichen Beziehung zwischen Empfindung und
Reiz zu suchen, ohne gleichzeitig der Beziehung zwischen dem Reiz und dem
Nervenprozess einigermaßen gewiß zu sein. Denn was die Empfindung
in uns erregt, ist schlechterdings nur der Nervenprozeß. Wollen wir
die Beziehung zwischen der Stärke der Empfindung und der sie verursachenden
Bewegung feststellen, so müssen wir für letztere den Nervenprozeß
setzen, dem der Reizvorgang erst substituiert werden kann, sobald die Abhängigkeit
zwischen beiden bekannt ist. Im entgegengesetzten Fall würde die Bedeutung
des aufgefundenen Gesetzes zweifelhaft, bleiben, da man dahingestellt lassen
müßte, ob dasselbe zwischen Reiz und Nervenprozeß oder
zwischen diesem und der Empfindung gültig, oder aber ob es eine komplexe
Funktion sei, welche erst in ihre einfacheren Bestandteile aufzulösen
wäre. Das letztere ist natürlich der im allgemeinen wirklich
stattfindende Fall. Doch wird von demselben dann abstrahiert werden können,
wenn das eine jener Teilgesetze die einfache Proportionalität bedeuten
sollte, weil unter dieser Voraussetzung die Form der Funktion dieselbe
bleibt, und nur die speziellen Konstanten sich ändern.
3) FECHNER hat den physiologischen Vorgang in den Nerven-
und Sinneselementen, der zwischen dem äußeren Reiz und der Empfindung
in der Mitte liegt, die psycho-physische Bewegung genannt. (Elemente der
Psychophysik l, S. 10.) Da aber diese Bezeichnung Mißdeutungen zuläßt,
so ziehen wir den Ausdruck Nervenprozeß vor, bei dem man sich übrigens
gegenwärtig halten muß, daß die betreffenden Vorgänge
nicht allein in den eigentlichen Nerven, sondern auch in den mit denselben
zusammenhängenden peripherischen und zentralen Endgebilden ihren Sitz
haben.
Wir besitzen keine Untersuchung, welche die Frage nach der Beziehung
zwischen Reizstärke und Nervenprozeß direkt an den Sinnesnerven
zu beantworten sucht; doch gibt es einige auf die motorischen Nerven bezügliche
Tatsachen, welche hierher gehören. Reizt man nämlich einen mit
seinem Muskel in Verbindung stehenden Bewegungsnerven mit elektrischen
Stromstößen von unveränderlicher Dauer, aber wechselnder
Intensität, so bemerkt man, daß die Zuckung bei einer gewissen
minimalen Stromintensität beginnt und bei einer gewissen maximalen
Stromintensität ihre größte Höhe erreicht: zwischen
diesen beiden Grenzen wachsen aber, falls man die Stromstöße
hinreichend kurz nimmt, um gewisse komplizierte Wirkungen des Stromes auszuschließen,
die Zuckungshöhen mindestens in sehr weitem Umfang den Stromstärken
proportional4). Eine gewisse Bestätigung
gewinnt dieses Resultat durch Versuche über die Ermüdung der
motorischen Nerven. Reizt man einen belasteten und unterstützten Muskel
in konstanten Zeitintervallen mit maximalen Stromstößen, d.
h. mit solchen, die im Anfang Maximalzuckung bewirken, so bilden die in
Folge der Ermüdung abnehmenden Zuckungshöhen eine arithmetische
Reihe, deren konstante Differenz einzig und allein abhängt von der
Größe der Intervalle5). Wie
also bei gleich bleibender Leistungsfähigkeit und variabler Reizstärke
die Beziehung zwischen dieser und der Leistung durch eine gerade Linie
dargestellt werden kann, so läßt sich auch bei gleich bleibender
maximaler Reizstärke und variabler Leistungsfähigkeit die Veränderung
der letzteren in der Zeit durch eine gerade Linie ausdrücken. Das
zweite dieser Gesetze wird zu einem Corollarsatz des ersten, wenn man die
durch die Einfachheit der Beziehung zwischen Ermüdung und Reizintervall
nahe gelegte Annahme macht, der Wiederersatz der bei der Leistung verloren
gegangenen Kräfte erfolge der verflossenen Zeit proportional. Auf
den geschwächten Nerven wirkt nämlich der Maximalreiz offenbar
ebenso wie auf den leistungsfähigen ein schwächerer Reiz ein.
Sobald also bei gleichbleibender Leistungsfähigkeit die Zuckung mit
der Reizstärke geradlinig wächst, so muß auch umgekehrt
bei gleichbleibender Reizstärke und sinkender Leistungsfähigkeit
die Zuckung mit der Zeit geradlinig abnehmen, falls nur wegen Gleichheit
der Reizintervalle die Ermüdung eine gleichförmig fortschreitende
ist.
4) Fick, Untersuchungen über elektrische Nervenreizung.
Braunschweig 1869.
5) Kronecker, Monatsber. der Berliner Akademie. 1870.
S. 631. Sitzungsber. der sächs. Gesellsch. 1871 S. 718.
Man kann nun allerdings einwenden, diese Beobachtungen bezögen
sich zunächst nur auf den Effekt am Muskel, der Nervenprozeß
selbst werde dadurch noch nicht gemessen. In der Tat würde es durchaus
untunlich sein, die Muskelleistung den im Nerven durch den Reiz frei werdenden
Kräften gleich zu setzen. Vielmehr beweist die allgemeine Mechanik
der Reizvorgänge, daß immer nur ein Teil der im motorischen
Nerven geleisteten Reizarbeit in Muskelarbeit übergeht6).
Insbesondere kommt dies auch beim Schwellen- und Höhenwert des Reizes
in Rücksicht. Die Muskelleistung beginnt, wie die Untersuchung der
Reizbarkeitsveränderungen des Nerven durch schwache Reize unmittelbar
beweist, erst wenn die Stärke des Nervenprozesses einen gewissen endlichen
Wert erreicht hat. Ebenso machen es die besonderen Widerstände, welche
sich im Muskel seiner mechanischen Energie entgegensetzen, im höchsten
Grade wahrscheinlich, daß die Zuckung bereits bei ihrem Maximum anlangt,
wo der Nervenprozeß das seinige noch nicht erreicht hat. Aber diese
Verhältnisse bedingen auch hier wieder nur, daß die Konstanten
der Gleichung, die für die Beziehung zwischen Reiz und Nervenprozeß
gültig ist, nicht zu bestimmen sind. Dagegen macht es die große
Einfachheit des Gesetzes selbst außerordentlich wahrscheinlich, daß
die allgemeine Form desselben die nämliche bleibt, ob wir das Mittelglied
des Nervenprozesses einschalten oder nicht. Ist nämlich die Muskelleistung
der Reizstärke einfach proportional, so kann nicht bezweifelt werden,
daß sich dieses Gesetz aus einer einfachen Proportionalität
zwischen Reizstärke und Nervenprozeß und einer eben solchen
zwischen Nervenprozeß und Muskelleistung zusammensetzt7).
6) Vgl. Kap. VI.
7) Das Gesetz der Proportionalität wird nämlich
ausgedrückt durch eine lineare Gleichung von der Form
1) y = ax + c.
Lassen wir in dieser Gleichung y die Reizstärke und
x
die Stärke des Nervenprozesses bedeuten, so bezeichnet die Konstante
c
die Reizstärke füs x = 0, also den Schwellenwert des
Reizes, und von a ist die Geschwindigkeit abhangig, mit der
y
bei wachsendem x zunehmen muß. Die Beziehung zwischen der
Stärke des Nervenprozesses und der Muskelzuckung z läßt
sich durch eine Gleichung von derselben Form ausdrücken, wobei aber
für a und c andere Konstanten zu setzen sind, als
2) x = a' z + c'.
Beide Gleichungen kombiniert ergeben für die Beziehung
zwischen Reizstärke und Muskelzuckung die Gleichung
y = a a' z + (a c'
+ a c),
welcher wieder die einfache Form
3) y = A z + C
gegeben werden kann. Wollten wir hieraus die ursprünglichen
Gleichungen 1 und 2 wiederherstellen, so müßte wenigstens eine
derselben ebenfalls gegeben sein, damit aus A = a a' und C =
a c' + a c die Konstanten a, a' und c, c'
gefunden werden könnten. Indem wir der Beziehung zwischen Reiz und
Nervenprozeß diejenige von Reiz und Muskelleistung substituieren,
erhalten wir somit zwar wegen der Einfachheit der beiden Gesetze dieselbe
Form der Gleichung, aber die betreffenden Konstanten bleiben ihrem absoluten
Werte nach unbekannt.
Die Übertragung der an den motorischen Nerven gefundenen Verhältnisse
auf die Sinnesnerven scheint nun bei der vollständigen Übereinstimmung
der Reizungsvorgänge in beiden hinreichend gerechtfertigt. Übrigens
ist es wahrscheinlich, daß das Gesetz der Proportionalität zwischen
Reiz und Nervenprozeß immerhin nur eine erste Annäherung ist,
die namentlich gegen die Reizhöhe hin merklich ungenau wird, indem
hier der Reizungsvorgang, unmittelbar ehe er seinen Grenzwert erreicht,
allmälig langsamer zunimmt8).
8) Diese aus nachher zu erwähnenden Beobachtungen
über das Verhältnis zwischen Reiz und Empfindung wahrscheinlich
werdende Abweichung findet auch darin gewissermaßen einen Ausdruck,
daß das Gesetz der linearen Funktion y = a x + c
zwar die Tatsache der physischen Reizschwelle, nicht aber die der Reizhöhe
in sich schließt, vielmehr müßte mit wachsendem Reize
y
fortan auch der Nervenprozeß x proportional zunehmen. Es ist
nun offenbar von vornherein wahrscheinlich, daß x diesem Grenzwert
nicht plötzlich, sondern allmälig nahe kommt, so daß die
gerade Linie eigentlich nur einen Teil der ganzen Kurve bildet, wobei jedoch
im allgemeinen innerhalb der Grenzen der gewöhnlich untersuchten Reizstärken
die Funktion mit hinreichender Genauigkeit als eine lineare betrachtet
werden kann.
Das Vorausgegangene berechtigt uns, dem Verhältnis zwischen Nervenprozeß
und Empfindung, welchem allein ein unmittelbares psychologisches Interesse
zukommt, dasjenige zwischen Reiz und Empfindung, welches der Untersuchung
viel leichter zugänglich ist, zu substituieren. Denn das Gesetz der
Beziehung, auf dessen Auffindung es wesentlich ankommt, muß in beiden
Fällen das nämliche sein; die Kenntnis der speziellen Konstanten
aber, die allerdings abweichen werden, besitzt überhaupt nur ein praktisches
Interesse, und im letzteren muß man sogar den Werten, die sich auf
die Beziehung von Reiz und Empfindung beziehen, die größere
Bedeutung zuerkennen, da im praktischen Leben nur das Verhalten unserer
Empfindungen zu den sie verursachenden Reizen, kaum jemals aber der Nervenprozeß
in Rücksicht kommen kann. Die Frage nach der Beziehung zwischen Reiz
und Empfindung läßt sich nun korrekter auch so ausdrücken:
in welchem Verhältnis ändert sich die Empfindung bei einer gegebenen
Veränderung des Reizes zwischen jenen Grenzwerten desselben, innerhalb
deren sie sich überhaupt ändert, nämlich zwischen dem Schwellen-
und Höhenwert?
Daß die Empfindung ihrer Intensität nach
meßbar, die so gestellte Frage also berechtigt sei, geht schon aus
der Existenz des Schwellen- und Höhenwertes hervor. Denn beide bedeuten
intensive Grenzwerte der Empfindung, zwischen denen eine stufenweise Zunahme
derselben stattfindet, und in beiden Grenzfällen kann eine Maßvergleichung
zeitlich oder räumlich getrennter Empfindungen stattfinden. Der Reizschwelle
entspricht die eben merkliche Empfindung oder, wie wir sie kürzer
nennen wollen, die Empfindungsschwelle, der Reizhöhe die Maximalempfindung
oder Empfindungshöhe. Nun können wir von zwei qualitativ
übereinstimmenden Empfindungen zweifellos sagen, daß ihre Intensität
gleich sei, wenn sie entweder der Empfindungsschwelle oder der Empfindungshöhe
entsprechen9). In der Tat findet eine solche
Maßvergleichung immer statt, wenn wir die Reizschwelle oder die Reizhöhe
feststellen. Dort suchen wir jenen Grenzwert des Reizes auf, dessen kleinste
Verminderung die Empfindung zum Verschwinden bringt, d. h. kleiner als
eben merklich, und dessen kleinste Vergrößerung sie mehr als
merklich macht, hier bestimmen wir jenen Grenzwert des Reizes, wo eine
weitere Zunahme des letzteren die Größe der Empfindung nicht
mehr verändert. Im ersten Fall besteht also das Maßverfahren
in einem Abwägen der eben merklichen gegen die unmerkliche und gegen
die übermerkliche Empfindung, im zweiten Fall besteht es noch einfacher
in der unmittelbaren Vergleichung von Maximalempfindungen.
9) Bei qualitativ verschiedenen Empfindungen ist eine
solche Maßvergleichung nicht ohne weiteres statthaft, da die Werte
der Empfindungsschwelle und der Empfindungshöhe für verschiedene
Sinnesqualitäten möglicher Weise abweichende sein können.
Die so ausgeführte Ermittelung der Grenzwerte von Reiz und Empfindung
läßt nun sogleich einige allgemeine Feststellungen zu, welche
von der besonderen Form des für die Beziehung zwischen Empfindung
und Reiz gültigen Gesetzes noch ganz und gar unabhängig sind,
indem sie lediglich aus der Existenz jener Grenzwerte sich ergeben. Zunächst
ist nämlich von der Lage der Reizschwelle die Reizempfindlichkeit
abhängig. Je kleiner die Reizschwelle oder diejenige Reizgröße
ist, welche der Empfindungsschwelle entspricht, um so größer
nennen wir die Empfindlichkeit. Liegt z. B. im einen Fall die Empfindungsschwelle
beim Reize 1, im anderen beim Reize 2, so verhält sich die Empfindlichkeit
wie l : 1/2, oder allgemein: die Reizempfindlichkeit
ist proportional dem reziproken Wert der Reizschwelle. Von der Reizhöhe
dagegen wird eine andere Eigenschaft bestimmt, welche wir die Reizempfänglichkeit
nennen wollen, indem wir darunter die Fähigkeit verstehen, wachsenden
Werten des Reizes mit der Empfindung zu folgen. Je größer also
die Reizhöhe, um so größer nennen wir die Reizempfänglichkeit.
Entspricht z. B. im einen Fall die Empfindungshöhe einem Reize 1,
im andern einem Reize 2, so verhält sich die Empfänglichkeit
wie 1 : 2, oder allgemein: die Reizempfänglichkeit ist proportional
dem direkten Wert der Reizhöhe. Durch das Verhältnis der
Reizempfindlichkeit zur Reizempfänglichkeit ist endlich der relative
Reizumfang bedingt. Dieser wächst natürlich, je mehr die
Reizschwelle sinkt und die Reizhöhe steigt. Liegt z. B. im einen Fall
die Reizschwelle bei 1, die Reizhöhe bei 4, in einem andern die erste
bei 2, die zweite bei 8, so ist beide mal der relative Reizumfang = 4.
Liegt aber in einem dritten Fall die Reizschwelle bei 1/2,
die Reizhöhe bei 4, so ist nun der Reizumfang = 8. Oder allgemein:
der relative Reizumfang ist proportional dem Produkte der Reizempfänglichkeit
in die Reizempfindlichkeit oder dem Quotienten der Reizschwelle in die
Reizhöhe. Bezeichnen wir, um diese Beziehungen festzuhalten, die Reizschwelle
mit s, die Reizhöhe mit h, so ist das Maß
der Reizempfindlichkeit =  ,
das Maß der Reizempfänglichkeil = h, das Maß des
Reizumfangs =
,
das Maß der Reizempfänglichkeil = h, das Maß des
Reizumfangs =  .
.
Der hauptsächlichste Gebrauch, der von diesen
Maßen gemacht werden kann, bezieht sich auf das Verhältnis der
verschiedenen Sinne sowie verschiedener Teile eines und desselben Sinnesorgans
zu einander. Doch hat bis jetzt nur die Reizempfindlichkeit oder die ihr
reziproke Reizschwelle eine etwas eingehende Untersuchung erfahren, und
schon hier stößt man auf Schwierigkeiten, die schwerlich ganz
zu überwinden sind. Diese Schwierigkeiten sind hauptsächlich
von dreierlei Art. Erstens ist es fast unmöglich, alle Reize von unsern
Sinnesorganen auszuschließen, also bei der Ermittelung der Reizschwelle
von einem Reize null zu beginnen. Manche Sinnesorgane, namentlich das Auge
und Ohr, scheinen sich sogar vermöge der nicht zu entfernenden natürlichen
Reize an und für sich schon fortwährend über der
Schwelle zu befinden. Solche Reize können teils in den Strukturbedingungen
der Organe ihren Ursprung haben, so beim Auge, auf dessen Netzhaut der
intraoculäre Druck wahrscheinlich als Reiz wirkt, teils in äußern
Verhältnissen, so beim Ohr und der Haut, wo die nicht zu beseitigenden
Geräusche des eigenen Körpers, die Wärmeausstrahlung u.
s. w. als natürliche Reize wirken. Zweitens ist die Reizempfindlichkeit
der Sinnesorgane eine veränderliche. So nimmt z. B. die Lichtempfindlichkeit
unseres Auges beim Aufenthalt im Finstern fortwährend zu. Sind nun
gleich diese Veränderungen an und für sich von Interesse, so
erschweren sie doch die Gewinnung bestimmter Resultate. Drittens endlich
sind einige Sinnesorgane so außerordentlich empfindlich, daß
im Vergleich damit die Fehler der objektiven Messungshilfsmittel für
die Reizvorgänge bereits merklich in Betracht kommen; solches gilt
z. B. in Bezug auf die Empfindlichkeit des Auges gegen Licht und einzelner
Teile der Haut gegen Temperatureinwirkungen. Unter diesen Umständen
kann es bei der Bestimmung der Reizschwelle überhaupt nur um die Gewinnung
approximativer Mittelwerte sich handeln. So schätzt AUBERT
die Reizempfindlichkeit des Auges ungefähr der Lichtintensität
gleich, die in 5,5 Meter Entfernung ein weißer Papierstreif besitzen
würde, der von einer 300 mal schwächeren Lichtquelle als der
Vollmond beleuchtet würde10). In Bezug
auf die Schallstärke gibt SCHAFHÄUTL an,
daß ein gesundes Ohr den Schall von einem 1 Mgr. schweren Korkkügelchen,
das 1 mm. hoch herabfällt, noch in 91 mm. Entfernung zu hören
vermag11). Der Druck von Gewichten kann
nach Versuchen von aubert und KAMMLER
an
den empfindlichsten Hautstellen (z. B. an Stirn, Schläfe, Vorderarm)
eben noch verspürt werden, wenn er 2 Milligr. erreicht12).
Für die Temperaturempfindungen kann natürlich eine Reizschwelle
nur dann gesucht werden, wenn man als solche die kleinste Änderung
der Eigenwärme der Haut durch Zufuhr oder Entziehung von Wärme
betrachtet. Für diese scheint aber die Haut so empfindlich zu sein,
daß sie merklich eben so genau wie ein gutes Quecksilberthermometer
auf Temperaturänderungen reagiert13),
wonach mindestens 1/10° C. von ihrer eigenen
Temperatur an gerechnet als Reizschwelle gelten dürfte.
10) AUBERT, Physiologie der Netzhaut. Breslau 1865. S.
46. Die Reizschwelle wurde in AUBERT'S Versuchen direkt mittelst eines
Platinadrahtes bestimmt, welcher im absolut finstern Raume durch eine DANIELL'sche
Kette von genau angegebenen Dimensionen zum Leuchten gebracht, und welchem
dann genau diejenige Länge gegeben wurde, bei der das Leuchten eben
merklich war (a. a. O., S. 43). Die so bestimmte Lichtintensität wurde
dann photometrisch mit Tageslicht bei bedecktem Himmel verglichen; der
oben angegebenen Schätzung ist überdies die Annahme zu Grunde
gelegt, die Helligkeit des Mondes und diejenige einer weißen Wolke
seien etwa gleich, was natürlich auch nur sehr ungenau zutreffen wird.
Endlich gilt jene Schätzung nur für das unmittelbar in den verdunkelten
Raum gebrachte Auge. Bei längerem Aufenthalt im Finstern nimmt die
Empfindlichkeit anfangs sehr schnell und dann immer langsamer zu (AUBERT
ebend. S. 39), nähert sich also, wie es scheint, einem konstant bleibenden
Werte, welcher letztere hiernach vielleicht mit größerem Rechte
als die Reizschwelle des Sehorgans betrachtet werden könnte, wenn
nicht alle diese Bestimmungen durch das Eigenlicht der Retina unsicher
würden, durch welches sich das Auge an und für sich schon über
der Schwelle befindet, so daß die Bestimmung der letzteren, wie FECHNER
bemerkt hat, eigentlich unausführbar ist (Elemente der Psychophysik
I, S. 240). Mit Rücksicht hierauf könnte man daran denken, wenigstens
eine obere Grenze für die Reizschwelle der Netzhaut zu finden, indem
man für das Eigenlicht derselben ein objektives Maß aufsuchte.
Da nämlich das Eigenlicht empfunden wird, so wäre anzunehmen,
daß die Reizschwelle jedenfalls noch unter der Intensität desselben
gelegen sei. In der Tat hat nun volkmann die für die Bestimmung der
Unterschiedsschwelle angewandten Schattenversuche, die wir unten besprechen
werden, auch für die Ermittelung des Eigenlichtes zu benutzen gesucht,
und hiernach schätzte er dasselbe der Lichtintensität einer schwarzen
Samtfläche gleich, die aus ungefähr 9 Fuß Entfernung von
einer gewöhnlichen Stearinkerze beleuchtet wird (FECHNER a. a. O.,
I, S. 167). AUBERT nach einer ähnlichen Methode schätzte es gleich
der Erleuchtung eines weißen Papiers durch eine Stearinkerze in 400
Fuß Entfernung (AUBERT a. a. O., S. 65, vgl. hierzu Fechner, Sitzungsber.
der sächs. Ges. d.W. 1864, S. 18). Aber die Voraussetzungen, welche
beiden Berechnungen zu Grunde liegen , sind zu unsicher, als daß
aus den so gewonnenen Werten mehr als das allgemeine Resultat einer jedenfalls
sehr geringen Intensität des Eigenlichtes der Netzhaut entnommen werden
kann, woraus auf der andern Seite auf eine sehr große Lichtempfindlichkeit
derselben zu schließen ist.
11) Abhandl. der Münchener Akad. VII, S. 501. FECHNER,
Psychophysik I, S. 257. Übrigens ist unter allen Sinnen wahrscheinlich
das Gehör derjenige, der sogar bei normaler Beschaffenheit des Organs
die größten individuellen Unterschiede der Empfindlichkeit darbietet.
12) Aubert und Kammler, MOLESCHOTT'S Untersuchungenzur
Naturlehre V, S. 145.
13) FECHNER, Elemente der Psychophysik I, S. 202.
Um die so für die verschiedenen Sinne gewonnenen Werte mit einander
zu vergleichen, müßten die verschiedenen Reizvorgänge auf
ein übereinstimmendes Kraftmaß zurückgeführt sein.
Auch ohne daß dies der Fall ist, wird man übrigens das Auge
als das empfindlichste Sinnesorgan bezeichnen dürfen, woran zunächst
die Temperaturempfindungen der Haut, dann erst die Schall- und zuletzt
die Druckempfindung sich anschließen. Es ist nicht zu bezweifeln,
daß die ausnehmend großen Unterschiede in der Reizempfindlichkeit
dieser Sinne vorzugsweise in den Einrichtungen der Sinnesorgane, beziehungsweise
in der verschiedenen Zugänglichkeit der einzelnen sensibeln Nerven
für die verschiedenen Reizungsvorgänge begründet sind.
Bei jedem einzelnen Sinnesorgan ist die Empfindlichkeit
nicht für alle Reize die nämliche, sondern abhängig von
der Form des Reizes oder der ihr korrespondierenden Qualität
der Empfindung. Tiefe Töne werden erst bei einer bedeutenderen Amplitude
der Schallschwingungen hörbar als hohe; wenn man sich aber der oberen
Grenze der noch wahrnehmbaren Töne nähert, so nimmt ebenfalls
die Empfindlichkeit wieder ab14). Beim
Auge scheint die Reizschwelle für die brechbarsten Farben, also Violett,
Blau, tiefer zu liegen als für die minder brechbaren, Rot, Gelb. Denn
in der Dunkelheit werden blaue Farbentöne noch wahrgenommen, wo rote
bereits vollkommen schwarz erscheinen15).
Doch kommt man auch hier bei den übervioletten Strahlen jedenfalls
zu einem Wendepunkt, von dem an die Empfindlichkeit wieder sehr rasch abnimmt,
weil man sich der Grenze der Farbenwahrnehmbarkeit nähert. Hiernach
scheint es, daß für Ohr und Auge das Maximum der Empfindlichkeit
oder die kleinste Reizschwelle der oberen Grenze der qualitativen Reizskala
näher als der untern gelegen ist.
14) Einzelne unter den hohen Tönen sind noch durch
die akustischen Verhältnisse der schallleitenden Apparate des Ohrs
besonders bevorzugt, jene nämlich, auf welche der Gehörgang Resonanz
gibt. Doch steht dies in keiner Beziehung zu der hier behandelten Frage,
bei der es bloß um die Empfindlichkeit der schallperzipierenden Teile
sich handelt.
15) Helmholtz, physiologische Optik S. 317. Um die Reizschwelle
für verschiedene Farben zu vergleichen, müßten eigentlich
dieselben stets bei gleicher lebendiger Kraft der Ätherschwingungen
untersucht werden. Aber da die minder brechbaren Farben an und für
sich eine größere lebendige Kraft zu besitzen pflegen, so würde
eine solche Korrektion die Unterschiede der Reizschwelle nur noch bedeutender
machen. Übrigens kommt AUBERT nach Versuchen an farbigen Quadraten
auf schwarzem und weißem Grunde, zu denen im Finstern so viel Licht
zugelassen wurde, daß ihre Farbe eben erkannt werden konnte, zum
entgegengesetzten Resultate, wonach das Auge für die minder brechbaren
Strahlen empfindlicher sein soll (Physiologie der Netzhaut S. 127). Es
ist aber möglich, daß in diesen Versuchen der Kontrast mit dem
Grunde von Einfluß gewesen ist.
Bei denjenigen Sinneswerkzeugen, deren
Empfindungen räumlich lokalisiert werden, ist die Empfindlichkeit
außerdem teils nach dem Ort teils nach der Ausdehnung
des Reizes eine veränderliche. In ersterer Beziehung bietet die bedeutendsten
Unterschiede jedenfalls die äußere Haut in Bezug auf ihre Druckempfindlichkeit
dar. Während, wie oben bemerkt, an den empfindlichsten Stellen noch
0,002 Grm. eben verspürt werden, kann dieser Minimalwert an andern
bis auf 0,05 Grm. und darüber steigen16).
Es ist nicht zu bezweifeln, daß diese Differenzen lediglich von der
Dicke der Epidermisschichten herrühren, daher auch bei verschiedenen
Individuen die Lage der empfindlichsten und der unempfindlichsten Stellen
sehr bedeutend wechselt. Ebenso hängt es damit offenbar zusammen,
daß die Empfindlichkeit der Haut für Temperaturen fast gar keine
solchen Unterschiede darbietet17).
Denn Wärme und Kälte können selbst durch die dicksten Epidermisschichten
einwirken; hier finden sich daher nur Unterschiede in Bezug auf die Schnelligkeit,
mit der wir die Zufuhr oder die Entziehung der Wärme wahrnehmen. Bei
der Netzhaut des Auges kann die Empfindlichkeit der verschiedenen Punkte
in doppelter Hinsicht untersucht werden, einmal in Bezug auf Lichtempfindlichkeit
überhaupt, also die Empfindlichkeit für gewöhnliches weißes
Licht, und sodann in Bezug auf die verschiedenen Farbeneindrücke.
In ersterer Beziehung ist nun bis jetzt keinerlei Verschiedenheit nachweisbar;
sollte eine solche existieren, so wird sie jedenfalls durch andere Einflüsse
verdeckt18). Die Farbenempfindlichkeit
nimmt dagegen auf den Seitenteilen der Netzhaut sehr bedeutend ab. Dies
äußert sieh darin, daß die verschiedenen Farben im indirekten
Sehen nicht mehr deutlich unterschieden werden können und daher alle,
je nach der Lichtstärke des Grundes, auf dem man sie betrachtet, entweder
weiß (auf dunklem Grunde) oder schwarz (auf hellem Grunde) erscheinen19).
Darnach handelt es sich aber hier offenbar nicht um eine intensive Reizschwelle
für die Farbenempfindung, sondern um qualitative Verschiedenheiten
der letzteren, die vom Ort des Eindrucks abhängig sind.
16) AUBERT und kammler a. a. O.
17) E. H. WEBER, wagner's Handwörterb. der Physiol.
III, 2. S. 552. Annotationes anatom. Prol. XV, XVI.
18) AUBERT, Physiologie der Netzhaut S. 95. Die Einflüsse,
welche bei der Beurteilung der Empfindlichkeit verschiedener Netzhautpunkte
hauptsächlich in Betracht zu ziehen wären, sind 1) die objektiv
geringere Lichtstärke der auf den Seitenteilen der Netzhaut entworfenen
Bilder, welche dadurch entsteht, daß, je schräger ein Lichtbüschel
einfällt, um so mehr Randstrahlen durch die als Blendung wirkende
Iris abgehalten werden, und 2) der verschiedene Ermüdungszustand der
einzelnen Netzhautpunkte. Da wir uns vorzugsweise der Netzhautmitte zum
Sehen bedienen, so sind in der Regel die Seitenteile unermüdeter.
Hierauf und nicht auf verschiedener Empfindlichkeit beruht es wahrscheinlich,
daß bei astronomischen Beobachtungen zuweilen das indirekte Sehen
benutzt wird, um Sterne von sehr geringer Lichtstärke aufzufinden.
Von Einfluß kann hierbei außerdem der Umstand sein, daß
die Bilder auf den Seitenteilen verwaschen erscheinen, wodurch punktförmige
Objekte zwar lichtschwächer aber größer gesehen werden.
19) PURKINJE , Beiträge zur Kenntnis des Sehens in
subjektiver Hinsicht I, S. 76, II, S. 14. AUBERT a. a. 0. S. 118.
Gegenüber diesen bei den verschiedenen
Sinnesorganen und Sinneseindrücken ziemlich wechselnden Einflüssen
des gereizten Ortes sind mit Bezug auf die Ausbreitung der Reize alle räumlich
auffassenden Sinne gleichmäßig von dem Gesetze beherrscht, daß
ihre Reizempfindlichkeit bis zu einem gewissen Grade mit der Ausdehnung
des Eindrucks zunimmt. Ein örtlich begrenzter Reiz, welcher zu schwach
ist, um Empfindung zu erregen, kann also zur Reizschwelle werden, wenn
eine größere empfindende Fläche von demselben getroffen
wird, oder, wie wir das nämliche Gesetz auch formulieren können:
die intensive kann bis zu einem gewissen Grade durch eine extensive
Reizsteigerung ersetzt werden. So empfinden wir, ob eine Flüssigkeit
wärmer oder kälter als unsere Haut ist, viel leichter, wenn wir
die ganze Hand, als wenn wir etwa bloß einen Finger in dieselbe eintauchen20).
Ebenso wird die Empfindlichkeit der Netzhaut für Lichtintensitäten
größer, wenn die beleuchtete Netzhautstelle zunimmt21).
Übrigens gibt es in jedem dieser Sinnesgebiete eine obere Grenze,
von welcher aus bei weiterer Ausdehnung des Reizes die Reizschwelle nicht
mehr sinkt, und schon bei der Annäherung an diese Grenze wird sie
langsamer abnehmen. Im allgemeinen wird also die Reizschwelle eine solche
Funktion der Ausdehnung des Reizes sein, daß jene mit steigenden
Werten der letzteren sich immer weniger verändert und zuletzt einen
konstanten Grenzwert erreicht. Blicken wir zurück auf die verschiedenen
Einflüsse, die wir nun als bestimmend für die Reizempfindlichkeit
der verschiedenen Sinne kennen gelernt haben, so sind die meisten derselben
zweifellos direkt von den physiologischen Verhältnissen der Sinnesorgane,
und zwar teils von den Verhältnissen der Zuleitung, teils von der
spezifischen Reizbarkeit der einzelnen Endapparate abhängig. Auf die
ersteren ist z. B. die verschiedene Druckempfindlichkeit der einzelnen
Hautstellen, auf letztere höchst wahrscheinlich die verschiedene Empfindlichkeit
des Ohrs und des Auges für verschiedene Töne und Farben zurückzuführen.
Nur ein Einfluß bleibt übrig, der unmöglich aus solchen
wechselnden Bedingungen der Struktur abgeleitet werden kann: dies ist die
zuletzt besprochene Beziehung zwischen Ausdehnung des Reizes und Reizempfindlichkeit.
Wenn eine Stelle a
einer empfindenden Fläche von einem Reize a getroffen wird,
so ist der ausgelöste Nervenprozeß nicht kleiner und größer,
ob gleichzeitig eine zweite Stelle b
getroffen wurde oder nicht22).
Es muß sich also hier um ein allgemein gültiges Gesetz des Empfindens
handeln, wonach einer Intensitätszunahme der Empfindung ein extensives
Wachstum des Empfindens innerhalb gewisser Grenzen äquivalent ist.
In der Tat werden wir sehen, daß sich dieses Gesetz auch weiterhin
bei der Vergleichung verschiedener Empfindungsintensitäten bewährt.
20) E. H. Weber, Handwörterb. d. Phys. III, 2. S.
553. Weber spricht zwar an dieser Stelle nur davon , daß uns warmes
Wasser wärmer erscheint, wenn wir die ganze Hand, als wenn wir bloß
einen Finger in dasselbe eintauchen. Aber man kann sich leicht überzeugen,
daß entsprechende Unterschiede der Reizschwelle existieren.
21) AUBERT, Physiol. der Netzhaut S. 108. volkmann, physiol.
Untersuchungen im Gebiete der Optik I, S. 51. Für die Farbenauffassung
gilt das nämliche Gesetz (AUBERT a. a. O. v. Wittich, med. Zentralbl.
1863, S. 417), doch handelt es sich hier, wie bei der Farbenempfindung
im indirekten Sehen, nicht sowohl um die Reizschwelle der Empfindung als
um die Fähigkeit der qualitativen Unterscheidung. Auch bei den oben
zitierten Versuchen von volkmann ist eigentlich nur der Einfluß der
Extension des Reizes auf die Empfindung von Intensitätsunterschieden
bestimmt worden, es ist aber nicht zu bezweifeln, daß die Reizschwelle
im selben Sinne verändert wird.
22) Sind die Reize in einer verschiedenen Form neben einander
angeordnet, betrachtet man z. B. mit dem Auge leuchtende Objekte von verschiedener
Gestalt, so kann allerdings noch ein physiologisches Moment ins Spiel kommen.
So läßt sich z. B. denken, daß der Eindruck einer hellen
Linie auch intensiv relativ stärker ist als der eines Punktes von
gleicher Helligkeit, weil die Linie jedes der musivisch angeordneten Empfindungselemente
der Retina in seinem ganzen Durchmesser schneidet, während das Bild
des Punktes ein solches nur an einer einzigen Stelle trifft (vgl. VOLKMANN,
physiol. Untersuchungen im Gebiete der Optik I, S. 52). Nimmt man aber
jedesmal Flächen von gleicher Form, die nur in ihrer Größe
verschieden sind, so bleiben solche Einflüsse außer Betracht.
Weit unvollkommener noch als unsere Kenntnis der Reizschwelle für
die verschiedenen Empfindungsgebiete ist diejenige der Reizhöhe
oder jener Reizstärke, welche das Maximum der Empfindung bewirkt.
Hier läßt sich bei dem Mangel aller eingehenden Untersuchungen
nur die Vermutung als eine sehr wahrscheinliche aussprechen, daß
ähnliche Unterschiede existieren. So wird beim Auge die Empfindungshöhe
zweifellos bei einer geringeren Reizstärke erreicht als beim Ohr,
und dieses wird wieder an Reizempfänglichkeit durch die äußere
Haut übertroffen. Auch bezüglich der Qualitäten der Empfindung
finden sich Unterschiede. So erregen tiefe Töne erst bei einer bedeutenderen
Stärke der Schwingungen unser Ohr als hohe; bei der Steigerung der
Farbenreize erreichen die gelben Strahlen am frühesten die Maximalgrenze
des Eindrucks, später die roten und noch später die brechbarsten
Farben des Spektrums23). Hiernach scheint
es, daß, während das Maximum der Reizempfindlichkeit nahe bei
der obern Grenze der Töne und Farben gelegen ist, umgekehrt die Reizempfänglichkeit
bei der unteren Grenze derselben am größten ist. Der Reizumfang,
welcher von dem gegenseitigen Abstand der Schwelle und Höhe des Reizes
abhängt, variiert daher bei den verschiedenen Qualitäten weniger,
als nach der Lage der Reizschwelle oder der Reizhöhe allein erwartet
werden könnte. In der Tat gilt diese Regel auch bei der Vergleichung
der verschiedenen Sinne, insofern diejenigen Sinnesorgane, deren Reizschwelle
tief liegt, auch eine niedrige Reizhöhe besitzen24).
23) Vergl. Kap. IX.
24) Übrigens ist hieraus keineswegs etwa zu schließen,
daß der Reizumfang konstant sei. So müssen beim Gehör die
tiefsten Töne, um nur die Reizschwelle zu erreichen, bereits eine
enorme Schwingungamplitude besitzen. Hier liegen daher ohne Zweifel Reizschwelle
und Reizhöhe einander sehr nahe.
Diese Betrachtungen lehren, daß in den verschiedenen Sinnesgebieten
und selbst noch bei den verschiedenen Qualitäten eines und desselben
Sinnes diejenigen Grenzwerte des Reizes, welche den Grenzwerten der Empfindung
entsprechen, außerordentlich von einander abweichen. Aber dabei bleiben
die Grenzwerte der Empfindung selbst, nämlich die eben merkliche Empfindung
und die Maximalempfindung, überall Größen von gleichem
Werte. Von der Empfindungsschwelle ist dies an und für sich klar:
eine eben merkliche Empfindung hat immer dieselbe Größe, ob
es nun um Farben oder Töne oder irgend andere Empfindungen sich handeln
mag. Wollte man behaupten, die eine eben merkliche Empfindung sei größer
oder kleiner als eine andere, so würde man damit sagen, sie sei größer
oder kleiner als eben merklich. Aber eine nähere Überlegung zeigt,
daß auch die Maximalempfindung eine konstante psychische Größe
sein muß. In jedem Sinnesgebiet ist diejenige Empfindung die möglichst
große, welche das Bewußtsein mehr als jede andere in Anspruch
nimmt. Da nun das Bewußtsein für alle Sinne das nämliche
ist, so muß auch die Empfindungshöhe überall gleich groß
sein25). Nur wenn das Bewußtsein
selbst alteriert wird, so daß es den Sinnesempfindungen nicht mehr
in derselben Weise zugänglich ist, ändern sich auch jene Grenzwerte
der Empfindung. Einen gleichen Zustand des Bewußtseins vorausgesetzt,
hat aber der Empfindungsumfang eine konstante Größe. Die Empfindung
bewegt sich also stets zwischen den gleichen Grenzen, während der
Reiz bei den verschiedenen Sinnen sehr verschiedene Intensitätsgrade
durchlaufen muß.
25) Gegen diese Deduction könnte bezüglich der
Empfindungshöhe dann Einsprache erhoben werden, wenn auch die Empfindungen,
welche durch die möglichst starke Reizung zweier Sinne, also durch
solche Reize, welche die Sinnesnerven alsbald zerstören, herbeigeführt
würden, an Intensität verschieden wären. Dies könnte
aber nur dann stattfinden, wenn die Reizhöhe, d. h. der Reiz, welcher
der Empfindungshöhe entspricht, für irgend ein Sinnesorgan noch
unter jener möglichen Maximalgrenze des Reizes gelegen wäre.
In diesem Fall würde eben die Reizhöhe für das betreffende
Sinnesorgan eine virtuelle sein: sie würde vermöge der besonderen
Strukturverhältnisse des Organs gar nicht erreicht werden können.
Alle physiologischen Erfahrungen sprechen aber dafür, daß die
Reizhöhe überall einen Wert hat, der noch erheblich unter jenem
Grenzwert des Reizes liegt, bei welchem der Sinnesnerv zerstört wird.
Um das Gesetz zu ermitteln, welches zwischen Schwelle und Höbe
die Abhängigkeit der Empfindung vom Reiz beherrscht, ist es erforderlich
für die Veränderung der Empfindung einen Größenwert
zu finden, der sich in ähnlicher Weise unzweideutig feststellen läßt
wie jene zur Bestimmung der Reizempfindlichkeit und -empfänglichkeit
verwendeten Grenzwerte der möglichst kleinen und der möglichst
großen Empfindung. Es gibt aber nur eine einzige Größe,
welche für die Veränderung der Empfindung als eine konstante
und darum unter allen Umständen vergleichbare Größe betrachtet
werden kann: dies ist die Minimalveränderung der Empfindung
oder der eben merkliche Empfindungsunterschied. Lassen wir in verschiedenen
Fällen den Reiz zu- oder abnehmen, so bemerken wir deutlich die Grenze,
wo eben ein Intensitätsunterschied der Empfindung, eine Zu- oder Abnahme
derselben spürbar wird. Ein solcher eben merklicher Intensitätsunterschied
ist wieder aus demselben Grunde, wie die eben merkliche Empfindungsintensität,
ein psychischer Wert von konstanter Größe. Denn wäre ein
eben merklicher Unterschied größer oder kleiner als ein anderer,
so wäre er größer oder kleiner als eben merklich, was ein
Widerspruch ist. Wir können also mit absoluter Sicherheit sagen, daß,
wenn sich in verschiedenen Fällen Empfindungen, wie dieselben auch
qualitativ von einander abweichen mögen, um ein eben merkliches verändert
haben, sie sich in allen diesen Fällen um gleiche Grade ihrer Stärke
verändert haben.
Auch hier handelt es sich demnach darum einen Grenzwert
zu finden, und zwar, ähnlich wie bei der Bestimmung der Empfindungsschwelle,
mit welcher dieses Verfahren am nächsten verwandt ist, einen unteren
Grenzwert. In der Tat kann man die Größen, die hier in Betracht
kommen, wieder als Schwellenwerte bezeichnen. Unsere Aufgabe ist es, zum
Schwellenwert des Empfindungszuwachses den Schwellenwert des Reizzuwachses
zu finden: als solcher ist diejenige Zunahme des Reizes zu betrachten,
welche einer eben merklichen Empfindungszunahme entspricht. Man kann diesen
Wert die Unterschiedsschwelle des Reizes, die dazu gehörige
eben merkliche Empfindungsänderung aber die Unterschiedsschwelle
der Empfindung nennen26). Wie die Empfindungsschwelle,
so ist auch die Unterschiedsschwelle der Empfindung eine konstante Größe.
Ihr werden aber voraussichtlich unter verschiedenen Umständen sehr
verschiedene Werte der Unterschiedsschwelle des Reizes entsprechen, da
sich ja der Reiz bei konstantem Empfindungsumfang je nach dem Sinnesgebiete
zwischen sehr wechselnden Grenzwerten ändert.
26) Der Ausdruck Unterschiedsschwelle ist ebenfalls von
Fechner in die Psychologie eingefürht; gleichbedeutend braucht er
die Bezeichnung Verhä1tnisschwelle. (Elemente der Psychophysik I,
S. 242, 244.)
Die einfachste und naheliegendste Methode, um nun mittelst des gewonnenen
Maßprinzips die Beziehung zwischen Empfindungs- und Reizänderungen
zu finden, besteht darin, daß man direkt, von einer Reizstarke zur
andern übergehend, die einem eben merklichen Unterschied der Empfindung
entsprechenden Werte der Unterschiedsschwelle des Reizes ermittelt. Aber
dieses direkte Verfahren, das man als die Methode der eben merklichen
Unterschiede bezeichnet, bietet, namentlich in gewissen Sinnesgebieten,
einige Unsicherheit in seiner Handhabung. Darüber ob eine Empfindung
eben
merklich von einer andern verschieden sei, können wir leicht zweifelhaft
bleiben, und wir werden daher leicht den Reiz, welcher der Unterschiedsschwelle
entsprechen soll, entweder zu schwach wählen, wo die Empfindung untermerklich
wird,
oder zu stark, wo sie übermerklich wird. Auf diese Weise können
wir nur durch allmäliges Probieren das eben merkliche als den ungefähren
Grenzpunkt zwischen dem unter- und übermerklichen finden. Das so von
selbst sich ergebende Schwanken bei der Feststellung des Reiz- und Empfindungsunterschieds
führt nun zu einigen weiteren indirekten Methoden, die bei geeigneter
Anwendung der direkten Aufsuchung der Unterschiedsschwelle in gewisser
Beziehung überlegen sind27).
27) FECHNER, Elemente der Psychophysik I, S. 71, 94, 120.
Zunächst ist nämlich klar, daß, je kleiner der Unterschied
des Reizes ist, der in der Empfindung merklich wird, um so kleiner auch
derjenige Reizunterschied sein wird, welcher in der Empfindung nicht
mehr merklich ist. Man kann darum auch die Präzision festzustellen
suchen, mit welcher, wenn ein erster Reiz gegeben ist, ein zweiter nach
der Empfindung abgestuft wird, um demselben gleich zu werden. Handelt es
sich z. B. um die Unterschiedsempfindlichkeit für den Druck von Gewichten,
so wird diese nach der Methode der eben merklichen Unterschiede direkt
bestimmt, indem man diejenige Gewichtszulage ermittelt, welche zu einem
gegebenen Gewichte hinzugefügt einen Unterschied der Druckempfindung
hervorbringt. Statt dessen kann man aber auch ein zweites Gewicht so abzustufen
suchen, daß es eine von dem ersten nicht zu unterscheidende Druckempfindung
erzeugt. Die Präzision, mit der dies geschieht, ist umgekehrt proportional
dem durchschnittlich begangenen Fehler; zu dem letzteren muß also
auch die Unterschiedsempfindlichkeit in reziprokem Verhältnisse stehen.
Maßgebende Werte für den Betrag dieses Fehlers erhält man
aber hier der Natur der Sache nach erst aus zahlreichen Einzelbeobachtungen,
da der im einzelnen Fall begangene Fehler von dem einem fortwahrenden Wechsel
unterworfenen Stand des Bewußtseins und andern zufälligen Nebenumständen
mitbestimmt ist, welche erst in einer größern Zahl von Versuchen
sich ausgleichen. Man nennt daher dieses Verfahren die Methode der mittleren
Fehler. Die Anwendung desselben zeigt, daß jene Bedingungen,
die neben der Unterschiedsempfindlichkeit den einzelnen Fehler bestimmen,
bei noch so zahlreichen Beobachtungen sich nicht vollständig ausgleichen,
sondern daß regelmäßig eine konstante Abweichung nach
einer
Richtung übrig bleibt. So werden z. B. die bei der Schätzung
zweier in der Empfindung gleich erscheinender Druckgrößen begangenen
Fehler, so weit sie bloß von der Unterschiedsempfindlichkeit herrühren,
ebenso leicht positiv als negativ sein, d. h. es wird das Gewicht, welches
dem andern gleich gemacht werden soll, durchschnittlich ebenso leicht größer
als kleiner sein. Dies ist nun aber nicht der Fall, sondern man findet
stets, daß in einer noch so großen Zahl von Beobachtungen durchschnittlich
eine größere Neigung besteht, entweder das zweite Gewicht größer
oder es kleiner zu machen als das erste; beides wechselt unter verschiedenen
Umständen, z. B. zu verschiedenen Zeiten oder je nach der Stelle der
Haut, auf welche der Druck einwirkt. Den aus den Beobachtungen unmittelbar
abgeleiteten mittleren Fehler kann man daher gewissermaßen in zwei
Komponenten zerlegen, deren eine immer eine Abweichung in einer bestimmten
Richtung bewirkt, die bei konstant erhaltenen Zeit- und Raumbedingungen
konstant bleibt, und deren andere von der durch die vorige konstante Abweichung
bedingten Mittellage an gleich stark nach der einen und der andern Seite
gerichtet ist. Man zerlegt also den rohen mittleren Fehler in einen
konstanten
Mittelfehler, der teils von dem Stand des Bewußtseins, teils von
noch unerklärten physiologischen Bedingungen abhängt, und in
einen variabeln Mittelfehler, der allein zum Maß der Unterschiedsempfindlichkeit
benutzt werden darf, und der aus dem rohen mittleren Fehler durch Elimination
des konstanten Fehlers gefunden werden muß28).
28) Nach den allgemeinen Prinzipien der Fehleltheorie
läßt sich in einem solchen Fall der rohe Fehler in seine beiden
Partialfehler in derselben Weise wie eine resultierende Kraft in ihre beiden
rechtwinkligen Komponenten zerlegen. Ist also f der rohe, c
der konstante und j der reine variable Fehler
bei einer einzelnen Beobachtung, so hat man
 .
Hier läßt sich c eliminieren, wenn man
mehrere Versuchsreihen ausführt, in denen entweder die mittleren Werte
von j wechseln und die von c konstant
bleiben, oder in denen c wechselt und j
konstant bleibt. Hat man so für jeden einzelnen Versuch aus dem rohen
Fehler f die variabeln j , j',
j"
.
. . berechnet, so ergibt sich der mittlere variable Fehler F, auf
dessen Bestimmung es ankommt, nach dem nämlichen Prinzip aus der Gleichung
.
Hier läßt sich c eliminieren, wenn man
mehrere Versuchsreihen ausführt, in denen entweder die mittleren Werte
von j wechseln und die von c konstant
bleiben, oder in denen c wechselt und j
konstant bleibt. Hat man so für jeden einzelnen Versuch aus dem rohen
Fehler f die variabeln j , j',
j"
.
. . berechnet, so ergibt sich der mittlere variable Fehler F, auf
dessen Bestimmung es ankommt, nach dem nämlichen Prinzip aus der Gleichung
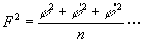 ,
wenn n die Zahl der Beobachtungen ist, oder
,
wenn n die Zahl der Beobachtungen ist, oder
 ,
wofür jedoch, wenn es sich nicht um die äußerste
Genauigkeit handelt, auch das gewöhnliche arithmetische Mittel
,
wofür jedoch, wenn es sich nicht um die äußerste
Genauigkeit handelt, auch das gewöhnliche arithmetische Mittel
 gesetzt werden kann. Vgl. FECHNER, Elemente der Psychophysik
I, S. 120 f.
gesetzt werden kann. Vgl. FECHNER, Elemente der Psychophysik
I, S. 120 f.
Läßt man ferner zwei Reize auf ein Sinnesorgan einwirken,
die so wenig von einander verschieden sind, daß ihnen Empfindungen
von nicht mehr deutlich merkbarem Unterschiede entsprechen, so werden solche
Reize nicht immer als gleich sondern häufig auch als verschieden beurteilt
werden, indem bald der erste Reiz intensiver als der zweite, bald der zweite
intensiver als der erste erscheint. In einer größeren Reihe
von Beobachtungen wird also auf eine gewisse Zahl richtiger eine gewisse
Zahl falscher Urteile kommen. Das Verhältnis der richtigen Fälle
r
zur Gesamtzahl n, der Quotient  ,
wird offenbar um so mehr der Einheit
,
wird offenbar um so mehr der Einheit  sich nähern, je näher man erstens den Reizunterschied dem eben
merklichen bringt, und je größer zweitens die Unterschiedsempfindlichkeit
ist. Läßt man daher in verschiedenen Beobachtungsreihen den
Reizunterschied konstant, so wird der Quotient
sich nähern, je näher man erstens den Reizunterschied dem eben
merklichen bringt, und je größer zweitens die Unterschiedsempfindlichkeit
ist. Läßt man daher in verschiedenen Beobachtungsreihen den
Reizunterschied konstant, so wird der Quotient  ein Maß der Unterschiedsempfindlichkeit. Dieses dritte Verfahren,
welches man als die Methode der richtigen und falschen Fälle
bezeichnet, geht aus der ersten, der direkten Bestimmung der eben merklichen
Unterschiede, unmittelbar hervor, wenn man die Reizunterschiede so klein
nimmt, daß sie nicht völlig die Unterschiedsschwelle erreichen.
Läßt man z. B. sukzessiv zwei Gewichte auf eine Hautstelle drücken,
deren Unterschiede kleiner sind als eben merklich, so können die beiden
Gewichte entweder als gleich oder als ungleich beurteilt werden, und im
letzteren Fall kann das größere oder das kleinere größer
erscheinen. Man hat also richtige, falsche und zweideutige Fälle,
zu welchen letzteren auch diejenigen gehören, in denen das Urteil
zweifelhaft bleibt. Der Quotient
ein Maß der Unterschiedsempfindlichkeit. Dieses dritte Verfahren,
welches man als die Methode der richtigen und falschen Fälle
bezeichnet, geht aus der ersten, der direkten Bestimmung der eben merklichen
Unterschiede, unmittelbar hervor, wenn man die Reizunterschiede so klein
nimmt, daß sie nicht völlig die Unterschiedsschwelle erreichen.
Läßt man z. B. sukzessiv zwei Gewichte auf eine Hautstelle drücken,
deren Unterschiede kleiner sind als eben merklich, so können die beiden
Gewichte entweder als gleich oder als ungleich beurteilt werden, und im
letzteren Fall kann das größere oder das kleinere größer
erscheinen. Man hat also richtige, falsche und zweideutige Fälle,
zu welchen letzteren auch diejenigen gehören, in denen das Urteil
zweifelhaft bleibt. Der Quotient  wird nun gebildet, indem man die zweideutigen Fälle zur Hälfte
den richtigen, zur Hälfte den falschen zurechnet. Es ist im allgemeinen
klar, daß der Quotient
wird nun gebildet, indem man die zweideutigen Fälle zur Hälfte
den richtigen, zur Hälfte den falschen zurechnet. Es ist im allgemeinen
klar, daß der Quotient  größer werden muß, wenn die Unterschiedsempfindlichkeit
zunimmt. Dennoch kann derselbe nicht, wie der reziproke Wert des eben merklichen
Unterschieds oder des mittleren variabeln Fehlers, unmittelbar als Maß
derselben dienen. Denn ein doppelt so großer Wert von
größer werden muß, wenn die Unterschiedsempfindlichkeit
zunimmt. Dennoch kann derselbe nicht, wie der reziproke Wert des eben merklichen
Unterschieds oder des mittleren variabeln Fehlers, unmittelbar als Maß
derselben dienen. Denn ein doppelt so großer Wert von  entspricht keineswegs etwa einer doppelt so großen Unterschiedsempfindlichkeit,
sondern diese ist dann doppelt so groß, wenn der Zuwachs des Reizes,
welcher denselben Wert von
entspricht keineswegs etwa einer doppelt so großen Unterschiedsempfindlichkeit,
sondern diese ist dann doppelt so groß, wenn der Zuwachs des Reizes,
welcher denselben Wert von  herbeiführt, im einen Fall halb so groß ist als in einem andern.
Wenn z.B. in einer ersten Reihe ein Druck P + 0,4 P, in einer
zweiten P + 0, 2 P (wo P den ursprünglichen Druck
bezeichnet) den gleichen Wert für
herbeiführt, im einen Fall halb so groß ist als in einem andern.
Wenn z.B. in einer ersten Reihe ein Druck P + 0,4 P, in einer
zweiten P + 0, 2 P (wo P den ursprünglichen Druck
bezeichnet) den gleichen Wert für  herbeiführten, so würde die Unterschiedsempfindlichkeit hier
doppelt so groß sein als dort. Man muß also, um mittelst dieser
Methode die Unterschiedsempfindlichkeit in verschiedenen Fällen zu
bestimmen, entweder den Reizzuwachs S so variieren, daß
herbeiführten, so würde die Unterschiedsempfindlichkeit hier
doppelt so groß sein als dort. Man muß also, um mittelst dieser
Methode die Unterschiedsempfindlichkeit in verschiedenen Fällen zu
bestimmen, entweder den Reizzuwachs S so variieren, daß  immer gleich bleibt, oder man muß aus den verschiedenen Werten
immer gleich bleibt, oder man muß aus den verschiedenen Werten 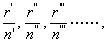 die
man bei konstant erhaltenem Reizzuwachs erhalten hat, berechnen, welcher
Wert S nötig gewesen wäre, um immer dasselbe
die
man bei konstant erhaltenem Reizzuwachs erhalten hat, berechnen, welcher
Wert S nötig gewesen wäre, um immer dasselbe  zu erhalten. Da das erste dieser Verfahren zu umständlich sein würde,
so ist nur das zweite anwendbar29). Die
Unterschiedsempfindlichkeit aber ist dem Werte
zu erhalten. Da das erste dieser Verfahren zu umständlich sein würde,
so ist nur das zweite anwendbar29). Die
Unterschiedsempfindlichkeit aber ist dem Werte  proportional. Auch bei der Methode der richtigen und falschen Fälle
kommt das Gesetz der großen Zahlen zur Anwendung d. h. das Prinzip,
daß veränderliche Bedingungen, welche die Resultate mit beeinflussen,
in einer großen Zahl von Beobachtungen sich ausgleichen. Aber auch
hier gilt solche Ausgleichung nur insofern, als jene Nebenumstände
nicht in einem konstanten Sinne wirksam sind. Dieselben Verhältnisse,
ein gewisser gleich bleibender Stand des Bewußtseins und in gleicher
Richtung wirkende physiologische Bedingungen, die bei der vorigen Methode
einen konstanten mittleren Fehler herbeiführen, bedingen bei der gegenwärtigen
konstante Abweichungen, welche eliminiert werden müssen. Dies geschieht,
indem man verschiedene Beobachtungsreihen ausführt, in denen entweder
S
konstant
bleibt, während die Miteinflüsse wechseln, oder umgekehrt30).
proportional. Auch bei der Methode der richtigen und falschen Fälle
kommt das Gesetz der großen Zahlen zur Anwendung d. h. das Prinzip,
daß veränderliche Bedingungen, welche die Resultate mit beeinflussen,
in einer großen Zahl von Beobachtungen sich ausgleichen. Aber auch
hier gilt solche Ausgleichung nur insofern, als jene Nebenumstände
nicht in einem konstanten Sinne wirksam sind. Dieselben Verhältnisse,
ein gewisser gleich bleibender Stand des Bewußtseins und in gleicher
Richtung wirkende physiologische Bedingungen, die bei der vorigen Methode
einen konstanten mittleren Fehler herbeiführen, bedingen bei der gegenwärtigen
konstante Abweichungen, welche eliminiert werden müssen. Dies geschieht,
indem man verschiedene Beobachtungsreihen ausführt, in denen entweder
S
konstant
bleibt, während die Miteinflüsse wechseln, oder umgekehrt30).
29) Übrigens berechnet man bei demselben nicht direkt
den Reizzuwachs S, bei welchem  konstant bleibt, sondern einen Wert hD, worin h eine in der
Theorie der kleinsten Quadrate als Präzisionsmaß bezeichnete
Größe und D den in der betreffenden Versuchsreihe benutzten
Reizzuwachs bedeutet. Der Wert h, welcher durch Division der für
hD
gewonnenen Zahl mit D erhalten wird, ist dann jenem oben erwähnten
Reizzuwachs S reciprok, also der Unterschiedsempfindlichkeit direkt
proportional. Über die Ableitung von h aus
konstant bleibt, sondern einen Wert hD, worin h eine in der
Theorie der kleinsten Quadrate als Präzisionsmaß bezeichnete
Größe und D den in der betreffenden Versuchsreihe benutzten
Reizzuwachs bedeutet. Der Wert h, welcher durch Division der für
hD
gewonnenen Zahl mit D erhalten wird, ist dann jenem oben erwähnten
Reizzuwachs S reciprok, also der Unterschiedsempfindlichkeit direkt
proportional. Über die Ableitung von h aus  vgl. fechner's Elemente I, S. 104, und ebend. S. 108 f. Tabellen über
die zu wachsenden Werten von
vgl. fechner's Elemente I, S. 104, und ebend. S. 108 f. Tabellen über
die zu wachsenden Werten von  gehörigen Werte hD.
gehörigen Werte hD.
30) Dabei können durch veränderte Versuchsbedingungen
außerdem die verschiedenen Miteinflüsse von einander geschieden
werden. Vgl. Fechner a. a. O. S. 113 f.
Demnach läßt sich als Maß der Unterschiedsempfindlichkeit
benutzen: 1) der reziproke Wert der Unterschiedsschwelle des Reizes:  ,
2) der reziproke Wert des mittleren variabeln Fehlers:
,
2) der reziproke Wert des mittleren variabeln Fehlers:  ,
und 3) der reziproke Wert desjenigen Reizzuwachses, welcher in verschiedenen
Fällen das gleiche Verhältnis
,
und 3) der reziproke Wert desjenigen Reizzuwachses, welcher in verschiedenen
Fällen das gleiche Verhältnis  (richtiger und falscher Fälle) herbeiführt:
(richtiger und falscher Fälle) herbeiführt:  .
Diese drei Maße sind aber nach ihrer absoluten Größe nicht
unmittelbar mit einander vergleichbar. Betrachtet man das gegenseitige
Verhältnis der drei Methoden genauer, so ist nicht zu verkennen, daß
sie alle von der ersten, der Methode der eben merklichen Unterschiede,
ihren Ausgang nehmen. Denn auf den Begriff der Unterschiedsschwelle des
Reizes, welchen diese direkt zu bestimmen sucht, führen auch die beiden
andern hinaus, und sie müssen das, weil die Unterschiedsschwelle das
einzige ist was zwischen den Grenzen der Minimal- und Maximalempfindung
der psychischen Maßbestimmung zugänglich bleibt. Aber die Unterschiedsschwelle
der Empfindung hat nicht jene absolute Konstanz, welche die erste Methode
streng genommen voraussetzt, sondern sie ist je nach dem Stand des Bewußtseins
und äußeren physiologischen Bedingungen fortwährenden Schwankungen
unterworfen. Die zweite und dritte Methode gehen nun von dem Prinzip aus,
daß solche Schwankungen in einer größeren Zahl von Beobachtungen
sich ausgleichen oder gewisse mittlere Abweichungen bedingen, welche wieder
durch Zusammenfassung vieler Beobachtungsreihen eliminiert werden können.
Diese beiden Methoden sind daher der direkten Bestimmung der Unterschiedsschwelle
in doppelter Beziehung überlegen: erstens, indem sie die Unsicherheit
beseitigen, welche der einmaligen Feststellung eines eben merklichen Unterschiedes
als eines Grenzfalles zwischen dem unter- und übermerklichen immer
anhaftet, und zweitens, indem sie den wechselnden Einfluß des Bewußtseinszustandes
und physiologischer Verhältnisse teils unmittelbar, durch Kompensation
nach dem Gesetz der großen Zahlen, teils mittelbar, durch Bestimmung
der davon herrührenden konstanten Fehler und konstanten Miteinflüsse,
zu eliminieren gestatten. Während wir bei der ersten Methode den Grenzwert
bestimmen, wo der Unterschied der Empfindung eben merklich zu werden beginnt,
legt die zweite denjenigen Grenzwert zu Grunde, wo jener Unterschied aufhört
merklich zu sein. Bei der dritten aber wird ein zwischen diesen beiden
Grenzfällen gelegener Wert angenommen, den man willkürlich dem
einen oder andern näher bringen kann, indem man S größer
oder kleiner nimmt, beziehungsweise den Bruch
.
Diese drei Maße sind aber nach ihrer absoluten Größe nicht
unmittelbar mit einander vergleichbar. Betrachtet man das gegenseitige
Verhältnis der drei Methoden genauer, so ist nicht zu verkennen, daß
sie alle von der ersten, der Methode der eben merklichen Unterschiede,
ihren Ausgang nehmen. Denn auf den Begriff der Unterschiedsschwelle des
Reizes, welchen diese direkt zu bestimmen sucht, führen auch die beiden
andern hinaus, und sie müssen das, weil die Unterschiedsschwelle das
einzige ist was zwischen den Grenzen der Minimal- und Maximalempfindung
der psychischen Maßbestimmung zugänglich bleibt. Aber die Unterschiedsschwelle
der Empfindung hat nicht jene absolute Konstanz, welche die erste Methode
streng genommen voraussetzt, sondern sie ist je nach dem Stand des Bewußtseins
und äußeren physiologischen Bedingungen fortwährenden Schwankungen
unterworfen. Die zweite und dritte Methode gehen nun von dem Prinzip aus,
daß solche Schwankungen in einer größeren Zahl von Beobachtungen
sich ausgleichen oder gewisse mittlere Abweichungen bedingen, welche wieder
durch Zusammenfassung vieler Beobachtungsreihen eliminiert werden können.
Diese beiden Methoden sind daher der direkten Bestimmung der Unterschiedsschwelle
in doppelter Beziehung überlegen: erstens, indem sie die Unsicherheit
beseitigen, welche der einmaligen Feststellung eines eben merklichen Unterschiedes
als eines Grenzfalles zwischen dem unter- und übermerklichen immer
anhaftet, und zweitens, indem sie den wechselnden Einfluß des Bewußtseinszustandes
und physiologischer Verhältnisse teils unmittelbar, durch Kompensation
nach dem Gesetz der großen Zahlen, teils mittelbar, durch Bestimmung
der davon herrührenden konstanten Fehler und konstanten Miteinflüsse,
zu eliminieren gestatten. Während wir bei der ersten Methode den Grenzwert
bestimmen, wo der Unterschied der Empfindung eben merklich zu werden beginnt,
legt die zweite denjenigen Grenzwert zu Grunde, wo jener Unterschied aufhört
merklich zu sein. Bei der dritten aber wird ein zwischen diesen beiden
Grenzfällen gelegener Wert angenommen, den man willkürlich dem
einen oder andern näher bringen kann, indem man S größer
oder kleiner nimmt, beziehungsweise den Bruch  der Einheit mehr oder weniger sich nähern läßt. In dem
Moment, wo eben
der Einheit mehr oder weniger sich nähern läßt. In dem
Moment, wo eben  der Einheit gleich wird, geht die dritte in die erste Methode, und sobald
es seinen Minimalwert erreicht, geht sie in die zweite Methode über.
Die Tatsache, daß es für die Bestimmung jener einzigen Veränderlichen
der Empfindung, der Unterschiedsschwelle, nicht bloß eine sondern
drei Methoden gibt, beruht also darauf, daß die Unterschiedsschwelle
der Empfindung einen gewissen Umfang hat, der durch Zustände des
Bewußtseins und äußere Momente in seiner Größe
bestimmt wird. Die Methode der eben merklichen Unterschiede ermittelt den
oberen,
die Methode der mittleren Fehler den unteren Grenzwert, die Methode
der richtigen und falschen Fälle nimmt einen zwischen beiden gelegenen
Punkt an, der durch willkürliche Variation der Versuchsbedingungen
bald näher der unteren, bald näher der oberen Grenze gewählt
werden kann31).
der Einheit gleich wird, geht die dritte in die erste Methode, und sobald
es seinen Minimalwert erreicht, geht sie in die zweite Methode über.
Die Tatsache, daß es für die Bestimmung jener einzigen Veränderlichen
der Empfindung, der Unterschiedsschwelle, nicht bloß eine sondern
drei Methoden gibt, beruht also darauf, daß die Unterschiedsschwelle
der Empfindung einen gewissen Umfang hat, der durch Zustände des
Bewußtseins und äußere Momente in seiner Größe
bestimmt wird. Die Methode der eben merklichen Unterschiede ermittelt den
oberen,
die Methode der mittleren Fehler den unteren Grenzwert, die Methode
der richtigen und falschen Fälle nimmt einen zwischen beiden gelegenen
Punkt an, der durch willkürliche Variation der Versuchsbedingungen
bald näher der unteren, bald näher der oberen Grenze gewählt
werden kann31).
31) Hiernach kann ich FECHNER'S Ansicht über das
Verhältnis der drei Methoden nicht vollständig teilen, wenn er
(Psychophysik I, S. 73) dasselbe so bestimmt, daß bei der Methode
der eben merklichen Unterschiede die Grenze zwischen übermerklichen
und untermerklichen Unterschieden beobachtet, bei der Methode der mittleren
Fehler untermerkliche Unterschiede gemessen und bei der Methode der richtigen
und falschen Fälle übermerkliche Unterschiede gezählt werden,
die nach Zufälligkeiten bald in richtigem bald in falschem Sinne ausfallen.
Vielmehr haben es, wie ich glaube, alle drei Methoden mit der Grenze des
eben Merklichen zu tun , die aber keine scharfe Linie ist, sondern eine
gewisse Ausdehnung besitzt, daher bei ihr ein oberer und ein unterer Grenzwert
sowie irgend ein zwischen diesen eingeschlossener Mittelwert gemessen werden
kann.
Der nächste Ausdruck für das Gesetz, nach welchem sich zwischen
den Grenzen der Schwelle und Höhe mit dem Reize die Empfindung verändert,
wird je nach der Methode, von der man ausgeht, ein verschiedener. Bei der
Methode der eben merklichen Unterschiede findet man, daß der Zuwachs
des Reizes, welcher eine eben merkliche Änderung der Empfindung hervorbringt,
zu der Reizgröße, zu welcher er hinzukommt, immer im selben
Verhältnisse steht. Muß man also zu einem Gewichte 1 ein Gewicht
1/3
zulegen, damit der Druckunterschied eben merklich werde, so muß ein
Gewicht 2 um 2/3, ein Gewicht 3 um 1 wachsen, wenn
ein merklicher Unterschied der Empfindung entstehen soll. Bei der Methode
der mittleren Fehler ergibt sich, daß der mittlere variable Fehler,
welcher beider Vergleichung eines Reizes mit einem andern, von dem er nicht
merklich verschieden ist, begangen wird, stets einen konstanten Bruchteil
des Reizes ausmacht. Es werde z. B., wenn einem Gewicht von der Größe
1 ein anderes gleich gemacht werden soll, ein durchschnittlicher variabler
Fehler von 1/10 begangen, so beträgt dieser
Fehler 2/10, wenn das Gewicht = 2 ist, 3/10,
wenn es = 3 ist, u. s. f. Bei der Methode der richtigen und falschen Fälle
endlich findet sich, daß, wenn nach Elimination der Miteinflüsse
bei der Vergleichung zweier unmerklich verschiedener Reize das Verhältnis  der richtigen Entscheidungen zur Gesamtzahl der Fälle konstant bleiben
soll, die beiden verglichenen Reize stets dasselbe Verhältnis zu einander
behalten müssen. Angenommen, ein Druck 1 verglichen mit einem Druck
1 + 1/5 gebe ein bestimmtes Verhältnis
der richtigen Entscheidungen zur Gesamtzahl der Fälle konstant bleiben
soll, die beiden verglichenen Reize stets dasselbe Verhältnis zu einander
behalten müssen. Angenommen, ein Druck 1 verglichen mit einem Druck
1 + 1/5 gebe ein bestimmtes Verhältnis  ,
so muß der Druck 2 mit einem andern 2 + 2/5,
3 mit 3 + 3/5 verglichen werden, damit wieder dasselbe
Verhältnis
,
so muß der Druck 2 mit einem andern 2 + 2/5,
3 mit 3 + 3/5 verglichen werden, damit wieder dasselbe
Verhältnis  erhalten bleibe.
erhalten bleibe.
Man sieht leicht ein, daß es sich in diesen drei Fällen nur
um verschiedene empirische Ausdrücke für ein und dasselbe Gesetz
handelt, welches wir, da bei der ersten Methode direkt, bei den zwei andern
aber indirekt die dem gleichen Empfindungszuwachs entsprechende Reizänderung
bestimmt wird, allgemein so ausdrücken können: Wenn die Intensität
der Empfindung um gleiche absolute Größen zunehmen soll, so
muß der relative Reizzuwachs konstant bleiben. Oder: Ein Unterschied
je zweier Reize wird als gleich groß empfunden, wenn das Verhältnis
derselben unverändert bleibt. In der durch die Methode der eben
merklichen Unterschiede gegebenen Form ist dieses Gesetz zuerst von E.
H. weber festgestellt, auf dem Wege der zwei andern Methoden ist
es von fechner geprüft und als das WEBER'sche
oder psychophysische Grundgesetz bezeichnet worden32).
32) E. H. Weber, Annotationes anatomicae (Programmata
collecta). Prol. XII (1831). Art. Tastsinn und Gemeingefühl im Handwörterb.
der Physiologie III, 2, S. 481. FECHNER, Abhandlungen der kgl. sächs.
Gesellschaft zu Leipzig. VI. (Math.-phys. Cl. IV) S. 455. Elemente der
Psychophysik. Leipzig 1860.
Bei jeder der drei angegebenen Methoden bedient man sich zur Feststellung
des Grundgesetzes sehr kleiner Empfindungsänderungen, die sich im
allgemeinen zwischen zwei sehr nahe bei einander gelegenen Grenzwerten
bewegen, einem, wo die Änderung merklich zu werden anfängt, und
einem andern, wo sie aufhört dies zu sein. Die Empfindungsänderungen,
deren man sich bedient, sind also verschwindende oder eben erscheinende
Größen. Solche Größen, die gegen endliche Werte eben
verschwinden, pflegt man aber als Differentialgrößenerster
Ordnung zu bezeichnen. Wertänderungen derselben, die für
sie selbst in Betracht kommen, bringen in ihrem Verhältnis gegen endliche
Größen noch keine irgend spürbare Abweichung hervor. Diejenigen
Größen, deren Werte und merkliche Wertveränderungen wieder
gegen die Differentiale erster Ordnung verschwinden, werden dann als Differentiale
zweiter, dritter u. s. w. Ordnung betrachtet. Es ist nun eine charakteristische
Eigentümlichkeit der psychischen Messung, daß die intensiven
psychischen Größen schlechterdings nur an ihren Differentialen
erster Ordnung gemessen werden können. Denn für das Verhältnis
endlicher Empfindungen zu einander haben wir keinen Maßstab, und
solche Empfindungsgrößen, die gegen verschwindende Empfindungen
wieder verschwinden, können auch nicht weiter in Betracht kommen.
Dagegen ist die Differentialempfindung erster Ordnung das natürliche
Maß der Empfindungsänderung, weil sie im Vergleich mit jeder
endlichen Empfindung immer denselbenWert behält, nämlich
verschwindend klein ist, und weil daher auch Änderungen dieser Differentialgröße,
die für sie selbst in Betracht kommen, gegenüber der Intensität
endlicher Empfindungen verschwinden. In der Tat machen wir von der letzteren
Eigenschaft bei den drei Methoden der psychophysischen Messung Gebrauch,
indem wir bei jeder eigentlich eine andere sehr kleine Größe
benutzen, bei der ersten die eben erscheinende, bei der zweiten die eben
verschwindende Änderung, bei der dritten einen zwischen beiden Grenzen
gelegenen Wert, und jeden dieser Werte doch mit vollem Recht als das erste
Differential der Empfindung betrachten dürfen. Obgleich wir nun dergestalt
jeweils nur die Änderungen des Reizes bestimmen können, welche
verschwindenden Änderungen der Empfindung entsprechen, so können
wir doch aus den so gewonnenen Resultaten auch schließen, in welchem
Verhältnis Zuwüchse der Empfindung von endlicher Größe
zu den entsprechenden Zuwüchsen des Reizes stehen. Denn wenn wir bei
einer Kurve ermitteln, wie sich für verschiedene Abszissenwerte k,
2k u. s. w. (s. unten Fig.68)
zu einer verschwindend kleinen Zunahme
dE der Abszisse die entsprechende
Zunahme dR der Ordinate verhält, so läßt sich aus
dem für die verschiedensten Werte von E bestimmten Verhältnis  die ganze Gestalt der Kurve, d. h. die Beziehung, welche zwischen endlichen
Werten von E und R stattfindet, erschließen. In der
Tat haben wir in der allgemeinen Formulierung des psychophysischen Gesetzes
diese Beziehung zwischen endlichen Reiz - und Empfindungsänderungen
bereits vorausgreifend festgestellt. Da nämlich, welchen Wert wir
dem Reiz auch geben mochten, für je eine unendlich kleine Empfindungszunahme
immer dasselbe Verhältnis zwischen Reizzuwachs und ursprünglichem
Reize gefunden wurde, so konnten wir allgemein schließen, daß
überhaupt gleiche absolute Veränderungen der Empfindungen, auch
solche von endlicher Größe, entstehen, wenn der Reiz um gleiche
relative Größen sich ändert. Die mathematische Form der
so für die Beziehung zwischen Empfindung und Reiz festgestellten Funktion
ist die nämliche, wie sie zwischen den Logarithmen und den ihnen zugehörigen
Grundzahlen stattfindet. Die Logarithmen ändern sich um gleiche absolute
Größen, wenn die Grundzahlen um gleiche relative Größen
zunehmen. Es läßt sich daher dem psychophysischen Grundgesetz
der mathematische Ausdruck geben: die Empfindung ist proportional
dem Logarithmus des Reizes. Bezeichnet man die Reizstärke mit
R,
die zugehörige Stärke der Empfindung mit E, den Schwellenwert
des Reizes, also denjenigen, für welchen E = 0 ist, mit a,
endlich mit C eine aus den Versuchen zu bestimmende Konstante, so
wird dieses Gesetz ausgedrückt durch die Gleichung:
die ganze Gestalt der Kurve, d. h. die Beziehung, welche zwischen endlichen
Werten von E und R stattfindet, erschließen. In der
Tat haben wir in der allgemeinen Formulierung des psychophysischen Gesetzes
diese Beziehung zwischen endlichen Reiz - und Empfindungsänderungen
bereits vorausgreifend festgestellt. Da nämlich, welchen Wert wir
dem Reiz auch geben mochten, für je eine unendlich kleine Empfindungszunahme
immer dasselbe Verhältnis zwischen Reizzuwachs und ursprünglichem
Reize gefunden wurde, so konnten wir allgemein schließen, daß
überhaupt gleiche absolute Veränderungen der Empfindungen, auch
solche von endlicher Größe, entstehen, wenn der Reiz um gleiche
relative Größen sich ändert. Die mathematische Form der
so für die Beziehung zwischen Empfindung und Reiz festgestellten Funktion
ist die nämliche, wie sie zwischen den Logarithmen und den ihnen zugehörigen
Grundzahlen stattfindet. Die Logarithmen ändern sich um gleiche absolute
Größen, wenn die Grundzahlen um gleiche relative Größen
zunehmen. Es läßt sich daher dem psychophysischen Grundgesetz
der mathematische Ausdruck geben: die Empfindung ist proportional
dem Logarithmus des Reizes. Bezeichnet man die Reizstärke mit
R,
die zugehörige Stärke der Empfindung mit E, den Schwellenwert
des Reizes, also denjenigen, für welchen E = 0 ist, mit a,
endlich mit C eine aus den Versuchen zu bestimmende Konstante, so
wird dieses Gesetz ausgedrückt durch die Gleichung:
 ,
,
welche, wenn man den Schwellenwert des Reizes = 1 setzt, die einfache
Form annimmt:
E = C. log. R.
Geometrisch läßt sich das psychophysische Grundgesetz auf
doppelte Weise versinnlichen. Trägt man nämlich auf die Empfindungsstärken
als Abszissen die zugehörigen Reizstärken als Ordinaten auf,
so erhält man die in Fig.
68 gezeichnete Kurve, welche eine gewöhnliche Logistik
oder logarithmische Linie ist. Nimmt man dagegen die Reizstärken zu
Abszissen, die zugehörigen Empfindungsstärken zu Ordinaten an,
so erhält man die unten in Fig.
69 dargestellte Linie.
Um die oben gegebene mathematische
Form für das psychophysische Grundgesetz abzuleiten, kann man entweder
sogleich seinen allgemeinsten Ausdruck zu Grunde legen, in der es sich
auch auf endliche Werte der Empfindung bezieht, oder von der Betrachtung
des Differentials der Empfindung nach der vorhin festgestellten Bedeutung
dieses Begriffs ausgehen. Beginnen wir mit dem letzteren, welches eigentlich
allein direkt durch Beobachtung zu bestimmen ist, und bezeichnen wir dasselbe
durch dE, den Reiz durch R und den dem Differential dE
entsprechenden Zuwachs des Reizes durch dR, so läßt sich
das psychophysische Grundgesetz durch die folgende Fundamentalformel
darstellen,

welche ausdrückt, daß jeder
unendlich kleinen Veränderung der Empfindung ein konstantes Verhältnis
von Reizzuwachs und Reiz entspricht.
Um für das Gesetz in seiner Beziehung
auf endliche Empfindungsgrößen einen Ausdruck zu gewinnen, wollen
wir zunächst die geometrische Versinnlichung zu Hilfe nehmen. Wir
denken uns demgemäß die Empfindungszuwüchse als Teile von
gleicher Größe auf eine Abszissenlinie aufgetragen, die korrespondierenden
Reizzuwüchse sollen dann als Zunahmen der Ordinaten erscheinen (Fig.68).
Es sei jeder Abszissenteil =  ,
womit angedeutet werde, daß wir uns die endliche Empfindungsstärke
E
in n Abszissenteile geteilt denken. Die Größe
,
womit angedeutet werde, daß wir uns die endliche Empfindungsstärke
E
in n Abszissenteile geteilt denken. Die Größe  wollen wir mit k, ferner die Ordinate am Nullpunkte mit a,
die darauf folgenden sukzessiv den Abszissenwerten k, 2k, 3k.
. . entsprechenden mit b, c, d . . . bezeichnen.
Nun soll nach dem psychophysischen Grundgesetz gleichen Zuwüchsen
k
immer dasselbe Verhältnis der Ordinaten, zwischen denen jeder Teil
k
eingeschlossen ist, entsprechen. Es ist demnach
wollen wir mit k, ferner die Ordinate am Nullpunkte mit a,
die darauf folgenden sukzessiv den Abszissenwerten k, 2k, 3k.
. . entsprechenden mit b, c, d . . . bezeichnen.
Nun soll nach dem psychophysischen Grundgesetz gleichen Zuwüchsen
k
immer dasselbe Verhältnis der Ordinaten, zwischen denen jeder Teil
k
eingeschlossen ist, entsprechen. Es ist demnach 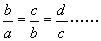 ein konstantes Verhältnis, und die auf einander folgenden Ordinaten
bilden folgende Reihe:
ein konstantes Verhältnis, und die auf einander folgenden Ordinaten
bilden folgende Reihe:
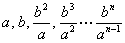 ,
worin a die Ordinate für den
Abszissenwert 0 und
,
worin a die Ordinate für den
Abszissenwert 0 und  dieselbe für den Abszissenwert nk = E ist. Bezeichnen wir die
entsprechende Reizordinate mit R, so ergibt sich, wenn man in den
der Abszisse
E zugehörigen Wert
dieselbe für den Abszissenwert nk = E ist. Bezeichnen wir die
entsprechende Reizordinate mit R, so ergibt sich, wenn man in den
der Abszisse
E zugehörigen Wert  der Ordinate für n den Wert
der Ordinate für n den Wert  einführt, als allgemeine Beziehung zwischen den Abszissen und Ordinaten
der Kurve die Gleichung
einführt, als allgemeine Beziehung zwischen den Abszissen und Ordinaten
der Kurve die Gleichung
 oder, wenn man die willkürlich zu
bestimmende Anfangsordinate a = 1 setzt,
oder, wenn man die willkürlich zu
bestimmende Anfangsordinate a = 1 setzt,
Rk = bE,
woraus die Grundgleichung für
die Beziehung zwischen Empfindung und Reiz entsteht:  E log nat. b = k log. nat.R,
E log nat. b = k log. nat.R,
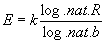 .
.
Diese Gleichung ist von FECHNER als die
psychophysische Maßformel bezeichnet worden, weil sie unmittelbar
zur Messung von Empfindungsgrößen benützt werden kann,
während die Fundamentalformel nur das allgemeine Gesetz des Wachstums
der Empfindung ausspricht. Vor der wirklichen Anwendung der Maßformel
muß aber die Bedeutung der in ihr vorkommenden Konstanten b
und k, sowie die Einheit des Reizes, welche man annimmt, festgestellt
sein. Letzteres ist bereits stillschweigend geschehen, indem wir die dem
Abszissenwerte 0 entsprechende Anfangsordinate a = 1 setzten. Der
Abszissenwert 0 ist nämlich offenbar der Grenzpunkt, wo die Empfindung
überhaupt beginnt, die Empfindungsschwelle, a = 1 bedeutet
also, daß als Einheit des Reizes der Schwellenwert desselben
genommen wurde. In der Tatsache, daß bei jedem logarithmischen
System der Logarithmus der 1 = 0 ist, liegt die Notwendigkeit diese Einheit
zu wählen eingeschlossen. Ferner ist b diejenige Ordinate,
welche dem Abszissenwerte k entspricht. Nun können wir für
die Empfindung, ebenso wie für den Reiz jede beliebige Einheil wählen.
Nehmen wir also k zur Einheit, was in der Annahme, das nk = E
sein
soll, eigentlich schon inbegriffen ist, so wird b diejenige Reizgröße,
welche der Einheit der Empfindung entspricht. Die Wahl der Einheit k
ist vollkommen willkürlich. Die Empfindung selbst gibt gar kein Prinzip
an die Hand, wodurch diese oder jene Empfindungsgröße als die
zweckmäßigere Einheit erschiene. Wohl aber können wir der
Beziehung zum Reiz ein solches Prinzip entnehmen. Offenbar werden wir nämlich
die Einheit der Empfindung am zweckmäßigsten derart bestimmen,
daß ihr Verhältnis zur Einheit des Reizes ein möglichst
einfaches wird. Dies ist aber nach dem zwischen Empfindung und Reiz festgestellten
Gesetz dann der Fall, wenn wir die Einheit der Empfindung so wählen,
daß die ihr entsprechende Reizgröße
gleich ist der
Basis des natürlichen Logarithmensystems, also = 2,7183 .... Bei
jedem Logarithmensystem ist nämlich der Logarithmus der Basis = 1,
setzen wir daher ein solches Verhältnis der Empfindungseinheiten zu
den Reizeinheiten fest, daß für k = 1 b = e
(Basis der natürlichen Logarithmen), also log. nat. b = 1 wird,
so erhält die Maßformel ihre einfachste Form:
E = log. nat. R.
Die Empfindung ist gleich dem natürlichen
Logarithmus des Reizes, wenn man als Einheit des Reizes die Reizschwelle
und als Einheit der Empfindung diejenige Intensität der Empfindung
wählt, welche dem 2,7183fachen Wert der Reizschwelle entspricht.
Die Umformungen, welche man mit dieser
Gleichung vornehmen muß, wenn die Einheiten von Reiz und Empfindung
anders bestimmt werden, liegen auf der Hand. Nehmen wir zunächst als
Einheit der Empfindung nicht die dem 2,7183fachen Wert der Reizschwelle
entsprechende Größe sondern irgend eine andere, so wird die
Maßformel durch folgende Gleichung ausgedrückt werden können:
E = K log. nat. R,
wo K eine von der gewählten
Einheit abhängige Konstante bedeutet. Wird außerdem auch die
Reizeinheit so bestimmt, daß sie nicht dem Schwellenwert des Reizes
entspricht, so haben wir, wenn a den Schwellenwert bedeutet, offenbar
in der obigen Formel nur  statt R zu setzen, um die vorigen Reizeinheiten in die neuen
überzuführen. Will man sich endlich statt der natürlichen
der gewöhnlichen Logarithmen bedienen, so hat man lediglich die Konstante
K
durch den Modul M des Logarithmensystems zu dividieren, d. h. statt
K
eine neue Konstante
statt R zu setzen, um die vorigen Reizeinheiten in die neuen
überzuführen. Will man sich endlich statt der natürlichen
der gewöhnlichen Logarithmen bedienen, so hat man lediglich die Konstante
K
durch den Modul M des Logarithmensystems zu dividieren, d. h. statt
K
eine neue Konstante  einzusetzen33). In
ihrer allgemeinsten Form lautet daher die Maßformel
einzusetzen33). In
ihrer allgemeinsten Form lautet daher die Maßformel
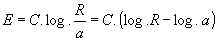
33) Es ist nämlich log. nat. =  Bei den gewöhnlichen Briggischen Logarithmen mit der Grundzahl 10
ist M = 0,434294481.
Bei den gewöhnlichen Briggischen Logarithmen mit der Grundzahl 10
ist M = 0,434294481.
Wir haben hier die Gleichung, welche
das Wachstum der Empfindung mit dem Reiz für unendlich kleine Werte
der ersteren darstellt, und diejenige, welche das Verhältnis beider
Größen zu einander unter Voraussetzung endlicher Werte ausdrückt,
unabhängig von einander entwickelt. Man kann aber die letztere,
die Maßformel, auch unmittelbar aus der ersteren, der Fundamentalformel,
ableiten. Die Gleichung
 gibt nämlich, wenn sie integriert
wird;
gibt nämlich, wenn sie integriert
wird;
E = K log. nat. B + A,
worin die Integrationskonstante A
sich dadurch bestimmt, daß für den Schwellenwert a des
Reizes E = 0 wird, woraus folgt
0 = K log. nat. a + A,
A = - K log. nat. a,
also, wenn man diesen Wert in die erste
Gleichung einsetzt,
E = K (log. nat. R — log. nat. a).
oder, wenn man gewöhnliche Logarithmen
nimmt,
E = C. (log. R — log. a).
Die logarithmische Linie (Fig.
68) stellt die Beziehung zwischen Empfindung und Reiz so dar,
daß durch die Kurve das Wachstum des Reizes versinnlicht wird, welches
gleichen Zuwüchsen der Empfindung entspricht. Wählt man den umgekehrten
Weg, indem man das gleichen Zuwüchsen des Reizes entsprechende Wachstum
der Empfindung durch eine Kurve versinnlicht, so erhält man die in
Fig.
69 dargestellte Linie, die bei einem Punkte a, welcher
der Reizschwelle entspricht, sich über die Abszissenlinie erhebt und
etwa bei einem Punkte m, welcher der Reizhöhe entspricht, ihr
Maximum erreicht. Links von a senkt sich die Kurve unter die Abszissenlinie,
um sich der Ordinatenachse y y' asymptotisch zu nähern. Da
beim Punkte
a, wo die Ordinaten positive Werte annehmen, die Empfindung
eben bewußt wird, so haben offenbar die links von a gelegenen
negativen Werte die Bedeutung unbewußter Empfindungen. Dem Nullpunkt
der Abszissen würde aber eine unendlich große negative Ordinate
entsprechen. Das ganze Wachstum der Empfindung mit dem Reize stellt daher
nach dieser Kurve so sich dar, daß beim Reizwerte null die Empfindung
unendlich tief unter der Schwelle des Bewußtseins liegt, worauf mit
wachsender Größe des Reizes die Empfindungen allmälig endliche,
aber immer noch negative, d. h. unbewußte Werte annehmen, um erst
bei der Reizschwelle a null zu werden: sie treten jetzt über
die Schwelle, gehen mit weiter wachsendem Reize in positive, d. h. bewußte
Größen über, bis endlich ein Grenzwert m des Reizes
erreicht wird, wo weitere endliche Zunahmen desselben keine merkliche Steigerung
der Empfindung mehr bewirken. So führt diese graphische Versinnlichung
von selbst darauf, daß die unter der Empfindungsschwelle gelegenen
Empfindungen als negative Größen dargestellt werden müssen,
die um so mehr wachsen, je weiter sie sich von der Schwelle entfernen,
bis dem Reize null eine unendlich große negative Empfindung entspricht,
d. h. eine solche, die unbewußter ist als jede andere. Daß
auf der andern Seite nicht auch die Empfindung unendlich große positive
Werte erreicht, liegt nicht in dem Gesetz ihres Wachstums sondern nur in
den physiologischen Bedingungen der Reizempfänglichkeit begründet.
Die Empfindung wächst nämlich zwar immer langsamer, aber wäre
man im Stande den Reiz, beziehungsweise den Nervenprozeß, der ja
allein direkt auf die Empfindung wirkt, in's unbegrenzte zu steigern, so
würde auch die Empfindung in's unendliche wachsen. Immerhin liegt
die Tatsache der Empfindungshöhe insofern schon in dem allgemeinen
Gesetz angedeutet, als von einer gewissen Grenze m an einer endlichen
Steigerung des Reizes nur noch eine unendlich kleine Zunahme der Empfindung
korrespondiert. Die drei Fundamentalwerte des Reizes, welche so mit drei
bestimmten Grenzwerten der Empfindung verbunden sind, nämlich der
Reiz null, bei welchem dieselbe negativ unendlich ist, der Reiz a,
bei welchem sie null ist oder aus negativen in positive Werte übergeht,
und der Reiz m, bei welchem sie ihre Höhe erreicht, lassen
auch in der Fig. 68
sich nachweisen. Hier müssen dann, da die Abszissen Empfindungen bedeuten,
die links von der Ordinate a gelegenen Abszissen den negativen,
unbewußten Empfindungen entsprechen. Von da an nähert sich die
Kurve der Reizgrößen asymptotisch der Abszissenlinie und erreicht
dieselbe auf ihrer linken, negativen Seite erst in unendlicher Ferne. Rechts
steigen die Ordinaten immer rascher an, bis bei einer Reizstärke
m
das Wachstum so groß geworden ist, daß erst nach einer unendlichen
Änderung des Reizes ein endlicher, d. h. merklicher Wert der Empfindungsänderung
eintritt. In dem logarithmischen System finden diese Beziehungen darin
ihren Ausdruck, daß der Logarithmus von 0 negativ unendlich, und
der Logarithmus der Einheit, als welche wir in Fig.
68 die Reizschwelle a angenommen haben, = 0 ist. Der
obere Grenzwert m aber findet sich, da Zahlen in's unbegrenzte wachsen
können, nur in der immer kleiner werdenden Differenz der den gleichen
Zahlunterschieden entsprechenden Logarithmen angedeutet.
Außer den
drei genannten Fundamentalwerten des Reizes, von denen die zwei ersten
in der allgemeinen Funktionsbeziehung unmittelbar schon ausgedrückt
sind, der dritte aber durch die physiologischen Verhältnisse mitbedingt
ist, läßt sich noch ein vierter aufstellen, welcher ebenfalls
in der Form des psychophysischen Gesetzes seinen Grund hat und, wenn er
auch nicht von so augenfälliger Bedeutung ist wie die drei ersten,
doch wahrscheinlich für gewisse Eigentümlichkeiten der Empfindung
von Wichtigkeit wird. Betrachten wir nämlich die in der Fundamentalformel
gegebene allgemeinste Form unseres Gesetzes
 ,
so drückt dieselbe augenscheinlich
nicht bloß aus, daß für den ganzen Empfindungsumfang jede
unendlich kleine Änderung der Empfindung proportional ist dem Verhältnisse
,
so drückt dieselbe augenscheinlich
nicht bloß aus, daß für den ganzen Empfindungsumfang jede
unendlich kleine Änderung der Empfindung proportional ist dem Verhältnisse  ,
sondern auch daß, so lange sich die Reizgröße R
nicht
merklich ändert, die unendlich kleine Empfindungsänderung
dE
der unendlich kleinen Reizänderung dR proportional bleibt.
Mit andern Worten: so lange der Reiz merklich konstant ist, kann die Funktionsbeziehung
zwischen Empfindungs- und Reizänderung als eine lineare betrachtet
werden, was in der graphischen Versinnlichung sich darin zu erkennen gibt,
daß jedes kleinste Stück der Kurven
Fig.
68 oder Fig. 69
als Teil einer geraden Linie angesehen werden kann.Nun erkennt man aber
sogleich bei Betrachtung dieser Kurven, daß die Richtungsänderung
im Verhältnis zur Steilheit des Ansteigens an, verschiedenen Punkten
eine sehr verschiedene relative Geschwindigkeit hat. In Fig.
68 ist links von a zwar die Richtungsänderung klein,
aber auch die Steilheit des Ansteigens unendlich gering, die Kurve verläuft
fast parallel der Abszissenlinie; dagegen ist in der Nähe von m
die Steilheit des Ansteigens bedeutend, gleichzeitig aber auch die Richtungsänderung
groß. In Fig.69
kehren diese Verhältnisse sich um: hier ist links von a größte
Steilheit mit schnellster Richtungsänderung und bei m langsamstes
Ansteigen mit kleinster Richtungsänderung. Diejenige Stelle, welche
die geringste relative Geschwindigkeit der Richtungsänderung
zeigt, liegt offenbar in beiden Kurven etwas nach rechts von a: hier
kann das verhältnismäßig größte Stück der
Kurve als eine gerade Linie betrachtet werden, welche, wenn man sie verlängert
denkt, in nicht zu weiter Entfernung die Abszissenachse schneidet. In diesem
Teil der Kurve kann also dR verhältnismäßig die
größten Werte erreichen. ohne daß dE aufhört
proportional zu wachsen. Die diesem ausgezeichneten Punkt entsprechende
Reizgröße wollen wir den Kardinalwert des Reizes, die
ihm entsprechende Empfindung den Kardinalwert der Empfindung nennen.
Da
bei a augenscheinlich die Empfindung rascher, bei m aber
langsamer wächst als der Reiz, so muß der den Kardinalwerten
entsprechende Punkt der Kurve an der Grenze zwischen diesen beiden Verlaufsstücken
liegen: denn die Grenze zwischen dem langsameren und dem schnelleren ist
eben das proportionale Wachstum. Man kann daher den Kardinalwert
des Reizes auffinden, indem man entweder mittelst der Formel E =
log.
nat. R die Werte aufsucht, welche dem E von der Schwelle 1 an
bei wachsenden Werten von R zukommen, und so die Grenze zwischen
dem langsameren und dem rascheren Wachstum von R empirisch ermittelt, oder
indem man durch Rechnung denjenigen Punkt der logarithmischen Kurve bestimmt,
für welchen das Verhältnis
,
sondern auch daß, so lange sich die Reizgröße R
nicht
merklich ändert, die unendlich kleine Empfindungsänderung
dE
der unendlich kleinen Reizänderung dR proportional bleibt.
Mit andern Worten: so lange der Reiz merklich konstant ist, kann die Funktionsbeziehung
zwischen Empfindungs- und Reizänderung als eine lineare betrachtet
werden, was in der graphischen Versinnlichung sich darin zu erkennen gibt,
daß jedes kleinste Stück der Kurven
Fig.
68 oder Fig. 69
als Teil einer geraden Linie angesehen werden kann.Nun erkennt man aber
sogleich bei Betrachtung dieser Kurven, daß die Richtungsänderung
im Verhältnis zur Steilheit des Ansteigens an, verschiedenen Punkten
eine sehr verschiedene relative Geschwindigkeit hat. In Fig.
68 ist links von a zwar die Richtungsänderung klein,
aber auch die Steilheit des Ansteigens unendlich gering, die Kurve verläuft
fast parallel der Abszissenlinie; dagegen ist in der Nähe von m
die Steilheit des Ansteigens bedeutend, gleichzeitig aber auch die Richtungsänderung
groß. In Fig.69
kehren diese Verhältnisse sich um: hier ist links von a größte
Steilheit mit schnellster Richtungsänderung und bei m langsamstes
Ansteigen mit kleinster Richtungsänderung. Diejenige Stelle, welche
die geringste relative Geschwindigkeit der Richtungsänderung
zeigt, liegt offenbar in beiden Kurven etwas nach rechts von a: hier
kann das verhältnismäßig größte Stück der
Kurve als eine gerade Linie betrachtet werden, welche, wenn man sie verlängert
denkt, in nicht zu weiter Entfernung die Abszissenachse schneidet. In diesem
Teil der Kurve kann also dR verhältnismäßig die
größten Werte erreichen. ohne daß dE aufhört
proportional zu wachsen. Die diesem ausgezeichneten Punkt entsprechende
Reizgröße wollen wir den Kardinalwert des Reizes, die
ihm entsprechende Empfindung den Kardinalwert der Empfindung nennen.
Da
bei a augenscheinlich die Empfindung rascher, bei m aber
langsamer wächst als der Reiz, so muß der den Kardinalwerten
entsprechende Punkt der Kurve an der Grenze zwischen diesen beiden Verlaufsstücken
liegen: denn die Grenze zwischen dem langsameren und dem schnelleren ist
eben das proportionale Wachstum. Man kann daher den Kardinalwert
des Reizes auffinden, indem man entweder mittelst der Formel E =
log.
nat. R die Werte aufsucht, welche dem E von der Schwelle 1 an
bei wachsenden Werten von R zukommen, und so die Grenze zwischen
dem langsameren und dem rascheren Wachstum von R empirisch ermittelt, oder
indem man durch Rechnung denjenigen Punkt der logarithmischen Kurve bestimmt,
für welchen das Verhältnis  ein
Maximum ist34). Auf
beiden Wegen findet man, daß der Kardinalwert des Reizes = e,
gleich der Grundzahl der natürlichen Logarithmen ist, wenn manden
Schwellenwert des Reizes = 1 setzt. Wenn also der Reiz das 2,7183.. -fache
seines Schwellenwert es beträgt, so wächst die Empfindung der
Reizstärke proportional. Schon hier können wir aus diesem Resultate
die Folgerung ziehen, daß, wo es sich um die Verwertung der Empfindungen
für die Erkenntnis objektiver Eindrücke handelt, die günstigste
Reizstärke diejenige sein wird, bei welcher der Reiz seinen
Kardinalwert erreicht. Denn die objektiven Eindrücke werden dann am
genauesten aufgefaßt, wenn die Empfindung den Veränderungen
ihrer Stärke genau proportional folgt35).
ein
Maximum ist34). Auf
beiden Wegen findet man, daß der Kardinalwert des Reizes = e,
gleich der Grundzahl der natürlichen Logarithmen ist, wenn manden
Schwellenwert des Reizes = 1 setzt. Wenn also der Reiz das 2,7183.. -fache
seines Schwellenwert es beträgt, so wächst die Empfindung der
Reizstärke proportional. Schon hier können wir aus diesem Resultate
die Folgerung ziehen, daß, wo es sich um die Verwertung der Empfindungen
für die Erkenntnis objektiver Eindrücke handelt, die günstigste
Reizstärke diejenige sein wird, bei welcher der Reiz seinen
Kardinalwert erreicht. Denn die objektiven Eindrücke werden dann am
genauesten aufgefaßt, wenn die Empfindung den Veränderungen
ihrer Stärke genau proportional folgt35).
34) Nach bekannten Regeln der Differentialrechnung ist
diese Bedingung dann erfüllt, wenn das entsprechende Differentialverhältnis  oder
oder  =
0 ist.
=
0 ist.
35) Eine weitere Folgerung, welche aber von
geringerer praktischer Wichtigkeit ist, läßt sich aus der Existenz
des Kardinalwertes in Bezug auf das Verhältnis der Intensität
der Empfindung zur extensiven Einwirkung des Reizes ziehen. Angenommen,
es sei ein Reiz von der Intensität J gegeben, und es sei anheimgestellt,
denselben beliebig auf eine kleinere oder größere empfindende
Fläche zu verteilen. Es wird dann, wenn sich der Reiz über die
n-fache
Oberfläche ausdehnt, die Intensität an jedem Punkte nur  von derjenigen sein, welche der auf die Oberfläche 1 wirkende Reiz
hat. Man kann nun fragen, wie groß bei gegebener Intensität
J
die Oberfläche, über die sich der Reiz ausdehnt, sein muß,
wenn die Summe des Empfindens ein Maximum sein soll, und es ist klar, daß
dieser Fall dann eintritt, wenn die Reizintensität an jedem Punkte
das 2,718 . . . fache der Reizschwelle wird.
von derjenigen sein, welche der auf die Oberfläche 1 wirkende Reiz
hat. Man kann nun fragen, wie groß bei gegebener Intensität
J
die Oberfläche, über die sich der Reiz ausdehnt, sein muß,
wenn die Summe des Empfindens ein Maximum sein soll, und es ist klar, daß
dieser Fall dann eintritt, wenn die Reizintensität an jedem Punkte
das 2,718 . . . fache der Reizschwelle wird.
Die Sinnesreize, die bis jetzt hauptsachlich in Bezug auf ihr Intensitätsverhältnis
zur Empfindung geprüft wurden, sind: Licht, Druck von Gewichten, Hebung
von Gewichten, Temperatureinwirkungen, nur beiläufig Schall. In allen
diesen Fällen hat man das psychophysische Grundgesetz bewährt
gefunden, allerdings aber mit gewissen Einschränkungen, die im Gebiet
des Lichtsinnes am meisten sich bemerklich machen.
Daß unsere Lichtempfindung nicht einfach proportional
der objektiven Lichtstärke sondern langsamer zunimmt, ist aus zahlreichen
Erfahrungen ersichtlich. Der Schatten, welchen ein dunkler Gegenstand im
Mondlichte entwirft, verschwindet, wenn man eine hellleuchtende Lampe in
die Nähe bringt; ein Schatten im Lampenlicht verschwindet hinwiederum,
wann die Sonne zu leuchten beginnt. Ähnlich verschwindet das Licht
der Sterne im Tageslicht. In allen diesen Fällen sind nun die objektiven
Helligkeitsunterschiede gleich groß: das Sonnenlicht fügt zu
dem Lampenschatten und seiner helleren Umgebung, zu dem Sternenlicht und
dem dunkeln Himmelsgrund gleiche absolute Helligkeitsmengen hinzu. Helligkeitsdifferenzen
von konstant bleibender Größe werden also nicht mehr empfunden,
wenn die Lichtintensität zunimmt. Läßt man dagegen, statt
bei gleich bleibender Helligkeitsdifferenz die absolute Lichtintensität
zu steigern, zwei in Vergleich gezogene Helligkeiten immer im gleichen
Verhältnis zu- oder abnehmen, so bemerkt man, daß die Unterschiede
der Lichtempfindung entweder sich gleich bleiben, oder doch jedenfalls
nicht im selben Verhältnis wie die objektiven Lichtintensitäten
sich ändern. Betrachtet man z. B. Wolken von verschiedener Helligkeit
zuerst mit freiem Auge und dann durch verdunkelnde graue Gläser, so
sind in beiden Fällen feine Abstufungen der Helligkeit ungefähr
mit gleicher Deutlichkeit sichtbar36).
Aus dieser Beobachtung ergibt sich schon, daß das psychophysische
Grundgesetz wenigstens als eine annähernde Regel für die Auffassung
von Lichtintensitäten gelten müsse, da dieselbe lehrt, daß
die Empfindungsdifferenz dieselbe bleibt, wenn die verglichenen Helligkeiten
im gleichen Verhältnis zu- oder abnehmen. Das nämliche lehrt
die Vergleichung der photometrisch ausgeführten Helligkeitsmessungen
der Sterne mit dem subjektiven Lichteindruck, den die Sterne hervorbringen.
Nach dem letzteren hat man dieselben, noch ehe man ihre objektiven Helligkeiten
kannte, in Größenklassen, eingeteilt, da ein leuchtender Punkt
um so größer erscheint, je heller er gesehen wird. Dabei hat
sich denn ergeben, daß die scheinbaren Sterngrößen in
arithmetischem Verhältnisse zunehmen, wenn ihre objektiven Helligkeiten
in geometrischem wachsen, eine Beziehung, welche ebenfalls durch das psychophysische
Gesetz ausgedrückt wird37). Direkter
haben BOUGUER und fechner die
Empfindlichkeit für Helligkeitsdifferenzen zu bestimmen gesucht, indem
sie eine weiße Tafel mit zwei Kerzenflammen von genau gleicher Lichtintensität
erleuchteten und einen Stab davor aufstellten, der nun zwei Schatten auf
die Tafel warf. Das eine Licht L' wurde dann bei wechselnder Distanz
des anderen L so weit entfernt, bis der entsprechende Schatten nicht
mehr sichtbar war. Ist s die Entfernung des näheren Lichtes
L,
s' diejenige des entfernteren L', so verhalten sich die
Intensitäten J und J' umgekehrt wie die Quadrate der
Entfernungen, also wie s' 2 : s2.
Ist z. B. L' 10 mal so weit von der Tafel entfernt wie L,
so ist J' = 1/100 J. Nun ist aber J
genau der Lichtstärke in dem vom entfernteren Licht L' herrührenden
Schatten gleich. Im Moment wo dieser Schatten verschwindet ist also der
von L' herrührende Beleuchtungszuwachs J' unmerklich
geworden. BOUGUER fand auf diese Weise, daß
bei verschiedenen Lichtintensitäten der Schatten verschwand, wenn
sein Helligkeitsunterschied 1/64 war. VOLKMANN
fand als Mittelwert 1/10038).
Masson erkannte nach einer andern Methode, bei welcher
er eine rasch rotierende weiße Scheibe mit einem kleinen schwarzen
Sektor anwandte, noch 1/120 39).
HELMHOLTZ
konnte mittelst der MASSON'schen Methode noch deutlich
einen Unterschied Von 1/133, etwas verwaschen 1/150
und
auf Augenblicke sogar
1/167 erkennen. Zugleich aber
fand er, daß dieses Verhältnis nicht ganz konstant war sondern
sowohl für starke wie für schwache Lichtintensitäten sich
änderte, indem gegen beide Grenzen hin die Unterschiedsempfindlichkeit
ab-, also der Helligkeitsunterschied, der eben noch erkannt werden konnte,
zunahm40). Was nun die Abänderung
gegen die obere Grenze betrifft, so erklärt sich dieselbe leicht aus
dem früher hervorgehobenen. Umstande, daß der Nervenprozeß,
der ja die nächste Unterlage der Empfindung ist, eine bestimmte Maximalgrenze
erreicht und wahrscheinlich schon bei der Annäherung an dieselbe langsamer
zunimmt. Die Abweichung gegen die untere Grenze kann möglicher Weise
zum Teil dadurch bedingt sein, daß die Netzhaut sich immer über
der Reizschwelle befindet. Sobald nämlich die zu unterscheidenden
objektiven Helligkeiten so schwach werden, daß das Eigenlicht, der
Netzhaut nicht mehr dagegen verschwindet, so muß die Reizschwelle
notwendig größer erscheinen, als sie ohne diesen Umstand gefunden
würde 41). Aber einerseits ist das
Eigenlicht der Netzhaut zu unbedeutend, anderseits sind die Abweichungen
bei schwachen Helligkeiten viel zu groß, als daß sie hieraus
allein abgeleitet werden könnten; auch greifen sie zum Teil noch auf
größere Beleuchtungsintensitäten über. Dies haben
besonders die von aubert teils mittelst der bouguer-fechner
teils mittelst der MASSON'schen Methode ausgeführten
Versuche gezeigt. Dieselben beweisen, daß die Unterschiedsempfindlichkeit
von einer gewissen mittleren Lichtstärke an, welche derjenigen des
diffusen Tageslichts ungefähr gleichkommt, sowohl bei der Abnahme
wie bei der Zunahme der absoluten Helligkeit sinkt. Während bei gewöhnlicher
Tagesbeleuchtung noch Unterschiede von
1/186 erkannt
wurden, stiegen dieselben von da an bei abnehmender Helligkeit ganz allmälig
bis auf 1/3, und ähnlich nahmen sie mit wachsender
Helligkeit zu42). Es scheint uns aber nicht
gerechtfertigt, hieraus mit aubert zu schließen,
daß das psychophysische Grundgesetz im Gebiet der Lichtempfindungen
überhaupt ungültig sei43). Denn
nicht nur wäre eine solche Ausnahme, nachdem dasselbe Gesetz für
die verschiedensten andern Sinnesempfindungen erwiesen worden ist, höchst
auffallend, sondern es bleibt auch unbestreitbar, daß innerhalb einer
gewissen mittleren Helligkeit die relative Unterschiedsempfindlichkeit
annähernd konstant ist. Man wird also zuerst nachzuforschen haben,
ob jene Abweichungen bei schwacher Lichtstärke nicht aus andern Momenten
erklärt werden können, die das psychophysische Gesetz nicht zu
seinem reinen Ausdrucke kommen lassen, ähnlich wie ja auch die Abweichung
bei stärkeren Helligkeiten hinreichend aus den oben angeführten
Umständen sich erklärt. In der Tat scheint nun ein derartiger
Einfluß der von aubert selbst näher erforschten Adaptation
des Auges zuzukommen. Die Adaptation für Lichtstärken besteht
darin, daß das Auge für jede Helligkeit erst bei längerer
Einwirkung derselben seine größte Empfindlichkeit erreicht.
Wird das Auge plötzlich aus einem dunklen in einen heller erleuchteten
Raum gebracht, so tritt derselbe Effekt ein, der normaler Weise erst den
stärksten Lichtintensitäten, welche die Netzhaut ertragen kann,
zukommt, die Netzhaut wird geblendet, und es werden verhältnismäßig
große Helligkeitsdifferenzen nicht mehr unterschieden. Geht umgekehrt
das Auge aus der Tageshelle in einen sehr schwach beleuchteten Baum über,
so erscheint derselbe anfänglich gleichmäßig dunkel, und
erst allmälig werden die Gegenstände erkannt. Beide Anpassungen,
die an stärkere und die an schwächere Helligkeiten, beruhen wahrscheinlich
auf sehr verschiedenen Ursachen, die wir hier unerörtert lassen können.
Beide müssen aber notwendig bewirken, daß die Unterschiedsempfindlichkeit
beim Wechsel der Beleuchtung herabgedrückt wird. So fand denn auch
AUBERT,
daß bei einer sehr geringen Beleuchtung, bei welcher im Anfang die
Unterschiedsempfindlichkeit = 1/4 war, sie nach längerer
Zeit auf 1/25 sich erhob44).
Ob noch andere Umstände bei den genannten Abweichungen mitwirken,
müssen wir dahingestellt lassen. Sicher ist, daß alle angeführten
Momente, das Eigenlicht der Netzhaut sowie die Adaptation des Auges, die
Unterschiedsempfindlichkeit bei sehr geringen Lichtstärken herabsetzen
müssen. Jene Momente bestehen aber in Veränderungen der rein
physiologischen Bedingungen der Reizbarkeit, können also in das psychophysische
Grundgesetz, sobald man unter demselben die rein psychologische Abhängigkeit
von der Reizstärke versteht, keine Aufnahme finden, wenn sie auch
unter Umständen jenes Gesetz verdecken mögen 45).
36) Fechner, Abhandl. der kgl. sächs. Ges. VI, S.
488.
37) FECHNER ebend. S. 492 und Elemente der Psychophysik
I, S. 158.
38) Fechner. Psychophysik I, S. 148.
39) MASSON, ann. de chim. et de phys. 3. sér. XIV,
p. 129.
40) Helmholtz, physiologische Optik, S. 315.
41) Man hat nämlich dann offenbar in der Gleichung  zu R noch das Eigenlicht der Netzhaut R0 hinzuzufügen, also
zu R noch das Eigenlicht der Netzhaut R0 hinzuzufügen, also  zu
setzen, woraus folgt
zu
setzen, woraus folgt 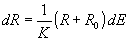 .
.
42) AUBERT, Physiologie der Netzhaut. Breslau 1865. S.
58 f,
43) Ebend. S. 63.
44) Ebend. S. 67.
45) Dies gilt daher auch von der empirischen Formel, welche
helmholtz (physiol. Optik S. 316) dem psychophysischen Gesetz zu substituieren
versucht hat, und welcher höchstens ein praktischer Wert zukommen
könnte. Wegen der Veränderlichkeit der physiologischen Bedingungen
der Erregbarkeit ist es übrigens fraglich, ob eine allgemein gültige
empirische Formel sich überhaupt aufstellen läßt.
Die Unterschiedsempfindlichkeit für den Druck und beim Heben von
Gewichten hat schon E. H. Weber gemessen, und seine
hierher gehörigen Versuche haben die erste Unterlage des psychophysischen
Gesetzes gebildet. Er fand, daß die Unterscheidung nach der bloßen
Druckempfindung erheblich unvollkommener ist, als wenn gleichzeitig, wie
es beim Heben geschieht, das Muskelgefühl hinzugezogen wird. Doch
weichen die einzelnen von weber gefundenen Werte sehr bedeutend von einander
ab, zum Teil, wie es scheint, deshalb, weil in seinen Versuchen bald erst
ein deutlich merkbarer Unterschied, bald schon ein solcher, bei dem noch
einzelne Irrtümer vorkamen, als Maß der Unterschiedsempfindlichkeit
benutzt wurde46). Durch fechner
wurde dann mittelst zahlreicher Versuche über das Heben von Gewichten,
die nach der Methode der richtigen und falschen Fälle angestellt sind,
die Gültigkeit des WEBER'schen Gesetzes bestätigt47).
In weber's und fechner's Hebungsversuchen
sind übrigens die Bewegungsempfindungen nicht vollkommen isoliert
sondern vermischt mit gleichzeitigen Druckempfindungen zur Beobachtung
gekommen; unabhängig von diesen lassen sie sich nur in gewissen pathologischen
Fällen untersuchen, in denen die Hautsensibilität aufgehoben
ist, während die Muskelgefühle erhalten blieben: hier pflegt
dann die Unterschiedsempfindlichkeit für das Heben von Gewichten nicht
verändert zu sein48).
46) Nach einer in den Programm, coll. mitgeteilten Tabelle
(Prol. XII, p. 6, auch abgedruckt bei Fechner, Psychophysik I, S. 139),
welcher Versuche nach der Methode der eben merklichen Unterschiede zu Grunde
liegen, wurde nämlich beim Druck von Gewichten im Mittel eine Differenz
von 10,88, beim Heben eine solche von 2,93 bemerkt, wenn jedesmal von einem
Gewicht von 32 Unzen oder Drachmen ausgegangen wurde, wobei jedoch die
einzelnen Zahlen von diesen Mittelwerten sehr bedeutend abweichen. In der
Abhandlung über Tastsinn und Gemeingefühl ist dagegen angegeben
, daß wir mittelst des Drucks noch eine Differenz von 1/30,
durch Heben eine solche von 1/40 wahrnehmen können (S.
559). Aber diesen Angaben liegen offenbar Versuche zu Grunde, bei denen
noch öfter ein Irrtum der Beurteilung vorkommt, bei denen also das
Verfahren der Methode der richtigen und falschen Fälle sich nähert
(vgl. ebend. S. 547).
47) Elemente der Psychophysik I, S. 183 f.
48) LEYDEN, Virchow's Archiv Bd. 47, S. 325. Bernhardt,
Archiv f. Psychiatrie III, S. 632.
Auch über die Temperaturempfindungen der Haut liegen Versuche von
Weber und von FECHNER nach der Methode der eben merklichen
Unterschiede vor. Dieselben lehren, daß die eben merklichen Unterschiede
der Wärmeempfindung den Temperaturüberschüssen über
eine gewisse, ungefähr der Eigenwärme der Haut entsprechende
Mitteltemperatur innerhalb ziemlich weiter Grenzen proportional sind49).
Dagegen zeigt die Unterschiedsempfindlichkeit für Kälte so bedeutende
Abweichungen von dem WEBER’schen Gesetze, daß
dasselbe hier nicht einmal als eine erste Annäherung betrachtet werden
kann. Diese Abweichungen haben aber ohne Zweifel in der bedeutenden Abstumpfung
der Reizbarkeit durch die Einwirkung der Kälte ihren physiologischen
Grund, wodurch die eben merklichen Temperaturdifferenzen viel rascher als
proportional ihrer Entfernung von der Mitteltemperatur zunehmen. Es handelt
sich demnach hier um dieselbe physiologische Abweichung von dem Gesetze,
wie sie überhaupt nahe dem Höhenwert der Empfindung stattfindet,
nur daß dieselbe diesmal bei minder starken Reizen schon eintritt.
49) Als solche Mitteltemperatur nahm FECHNER das Mittel
zwischen Frostkälte und Blutwärme = 14,77º R. an (a. a.
O. S. 203).
Über die Unterschiedsempfindlichkeit für Schallstärken
liegen bis jetzt nur wenige approximative Versuche vor, welche aber zeigen,
daß das Gehör verhältnismäßig nicht sehr scharf
ist in der Unterscheidung von Intensitäten des Reizes. Nach Versuchen
von RENZ und wolf, mit denen
Beobachtungen volkmann's gut übereinstimmen,
ist nämlich das Verhältnis der absoluten Schallstärken,
welche noch unterschieden werden können, nahezu = 3 : 4 50).
Die Konstanz dieses Verhältnisses zeigt, daß auch hier das psychophysische
Grundgesetz maßgebend ist. So ist denn das letztere für eine
hinreichende Zahl von Empfindungen erwiesen, um es als ein allgemeines
Gesetz, welches das Verhältnis der Sinnesempfindung zur Intensität
des Reizes beherrscht, betrachten zu können. Die allerdings bemerkenswerten
Ausnahmen von demselben lassen sich teils mit Sicherheit teils mit großer
Wahrscheinlichkeit auf physiologische Verhältnisse zurückführen,
die seine strenge Gültigkeit beeinträchtigen. Indem so das Gesetz
selber sich wesentlich nur auf die Beziehung zwischen dem Nervenprozeß
und der Empfindung erstreckt, wird zugleich die psychologische Bedeutung
desselben wahrscheinlich gemacht. Auf diese wird jedoch erst am Ende des
nächsten Kapitels einzugehen sein, nachdem wir zuvor die gesetzmäßigen
Beziehungen, die zwischen der Reizform und der Qualität der Sinnesempfindungen
bestehen, kennen gelernt haben.
50) Fechner, Psychophysik I, S. 176. Benz und Wolf, in
VIERORDT'S Archiv f. physiol. Heilkunde. 1856. S. 188.
