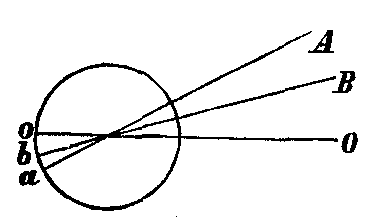
Fig. 15
1.
Die Kenntnis des räumlichen Sehens hat im Verlauf des 19. Jahrhunderts wesentliche Fortschritte gemacht, nicht allein durch den Gewinn an positiver Einsicht, sondern auch durch die Beseitigung der in diesem Gebiete von verschiedenen Philosophen und Physikern, namentlich seit Descartes, angehäuften Vorurteile, wodurch erst die für positive Entdeckungen nötige Unbefangenheit gewonnen werden mußte.
Durch das von Wheatstone4) erfundene Stereoskop konnte man sich leicht überzeugen, daß nicht nur auf identische Netzhautstellen, sondern auch auf andere nicht zu sehr differente Stellen fallende Bilder unter Umständen einfach, und je nach der stereoskopischen Differenz in verschiedener Tiefe gesehen werden. Dies führte nun wieder zu Zweifeln an der Identitätslehre und begünstigte das Auftreten psychologischer Erklärungen des Tiefensehens. So entstand Brückes Theorie des sukzessiven Fixierens beim räumlichen Sehen, welche durch Doves Stereoskopversuche bei Momentbeleuchtung wieder als unhaltbar erwiesen wurde.
4) Wheatstone, Contributions to the theory of vision. Phil. Transact., 1838, 1852.
Panum5) trat solchen Theorien durch gewichtige Überlegungen und trefflich ausgedachte Versuche entgegen. Gestützt auf die Phänomene des binokularen Wettstreites und die hervorragende Rolle der Konturen bei denselben, gelangt er zu der Ansicht, daß das Tiefensehen auf einer Wechselwirkung (Synergie) der beiden Netzhäute beruhe, daß die Tiefenempfindung eine angeborne spezifische Energie sei. Je ähnlicher die beiden monokularen Bilder, namentlich die Konturen, in Form, Farbe und Lage sind, desto leichter verschmelzen sie zu einem binokularen Bilde, dessen Tiefe durch die stereoskopische Differenz bestimmt wird. Diese Tiefe entspricht aber, wie Panum noch meint, der durch die Projektionslinien gegebenen.
5) Panum, Untersuchungen über das Sehen mit zwei Augen, 1858.
Am gründlichsten hat Hering6) mit alten Vorurteilen aufgeräumt. Hering geht von der Ansicht aus, daß der uns unmittelbar gegebene Sehraum von unserem durch besondere Erfahrungen gewonnenen Raumbegriff durchaus zu unterscheiden sei. Wie er durch schlagende Experimente nachweist, ist die Richtung, in welcher wir ein Objekt sehen, von jener der Verbindungslinie zwischen Objekt und Netzhautbild, der Visierlinie oder Projektionslinie, verschieden. Dem Paar der Visierlinien der beiden Augen entspricht eine deren Winkel halbierende Sehrichtung, welche wir von dem Halbierungspunkte der Verbindungslinie beider Augen ausgehend zu denken haben. Um jede Beziehung auf den geometrischen Raum auszuschalten, können wir sagen: Die beiden Augen zusammen sehen dieselbe Breiten- und Höhenanordnung, welche ein einzelnes mitten zwischen denselben liegendes Auge sehen würde. Fixieren wir mit horizontalen Blicklinien und symmetrischer Konvergenz einen Punkt auf der Fensterscheibe, so sehen wir diesen in der Medianebene, zugleich aber in derselben dahinter weit seitwärts abliegende Objekte. Auch bei schwacher Divergenz der Augenachsen sehen wir im stereoskopischen Versuch noch Objekte vor uns, während die Projektionsrichtungen überhaupt nicht mehr zu solchen führen, wenigstens keinen physikalischen oder physiologischen Sinn mehr haben. Auch die gesehenen Entfernungen stimmen nicht zu den Ergebnissen der Projektionslehre. Wenn wir bei horizontalen Blicklinien durch den Müllerschen Horopterkreis vertikale Fäden legen, so erscheint uns der so entstandene Zylinder als eine Ebene. Wir sehen nicht nur das Bild des fixierten Punktes (den "Kernpunkt"), sondern auch den Inbegriff aller sich auf identischen ("korrespondierenden") Stellen abbildender Punkte (die "Kernfläche") als eine in bestimmter Entfernung vor uns liegende Ebene. Diese und viele andere analoge Tatsachen sind nach der Projektionslehre ganz unverständlich. Das Raumsehen führt Hering auf ein einfaches Prinzip zurück. Identische ("korrespondierende") Netzhautstellen haben identische Höhen- und Breitenwerte, symmetrische Netzhautstellen dagegen identische Tiefenwerte, welche letztere von den Außenseiten der Netzhäute nach innen zu wachsen. Tritt wegen Ähnlichkeit der monokularen Bilder in Farbe, Form und Lage Verschmelzung derselben zu einem binokularen Bilde ein, so erhält dieses den Mittelwert der Tiefenwerte der Einzelbilder. Solche Mittelwerte der Einzelbilder spielen überhaupt eine maßgebende Rolle, so auch bei den Sehrichtungen. Diese Andeutungen mögen genügen, da es hier nicht möglich ist, auf die reichhaltigen Einzelarbeiten einzugehen, durch welche Hering7) diesem Kapitel eine sichere Grundlage geschaffen hat. Es sei nur noch bemerkt, daß nach demselben Forscher die beiden Augen als einheitliches Organ aufzufassen sind, deren assoziierte Bewegungen auf einer angeborenen anatomischen Grundlage beruhen, worauf schon Johannes Müller hingewiesen hatte.
7) Unter den an Herings Untersuchungen anknüpfenden Arbeiten jüngerer Forscher sind besonders jene F. Hildebrands von Interesse für die Psychologie.
8) Stumpf, Der psychologische Ursprung der Raumvorstellungen, 1873.
Die phylogenetische Entwicklung, die Variation der Korrespondenz der Netzhäute beim Übergang von einer Tierspezies zur andern, welche Johannes Müller9) untersucht hat, möchte hierfür schon Anhaltspunkte bieten. Vielversprechend scheint ferner die Verfolgung der pathologischen Anomalien bei Schielenden und der Anpassungserscheinungen, welche in diesen Fällen zu beobachten sind10).
9) Vergleichende Physiologie des Gesichtssinnes, S. 106 u. f.
Daß die Raumempfindung mit motorischen Prozessen zusammenhängt,
wird seit langer Zeit nicht mehr bestritten. Die Meinungen gehen nur darüber
auseinander, wie dieser Zusammenhang aufzufassen sei.
Fallen zwei verschiedenfarbige kongruente Bilder
nach einander auf dieselben Netzhautstellen, so werden sie ohne weiteres
als gleiche Gestalten erkannt. Wir können uns also zunächst verschiedene
Raumempfindungen an verschiedene Netzhautstellen gebunden denken. Daß
aber diese Raumempfindungen nicht unabänderlich an bestimmte Netzhautstellen
geknüpft sind, erkennen wir, indem wir frei und willkürlich die
Augen bewegen, wobei die Objekte, obgleich ihre Bilder auf der Netzhaut
sich verschieben, ihren Ort und ihre Gestalt nicht ändern.
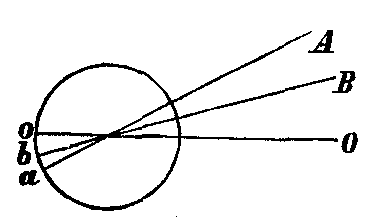
Wenn ich geradeaus vor mich blicke, ein Objekt 0 fixierend, so erscheint mir ein Objekt A, das sich auf der Netzhaut in a, in einer bestimmten Tiefe unter der Stelle des deutlichsten Sehens o abbildet, in einer gewissen Höhe zu liegen. Erhebe ich nun den Blick, B fixierend, so behält A hierbei seine frühere Höhe bei. Es müßte tiefer erscheinen, wenn der Ort des Bildes auf der Netzhaut, bezw. der Bogen o a allein die Raumempfindung bestimmen würde. Ich kann den Blick bis zu A und darüber hinaus erheben, ohne daß an diesem Verhältnis etwas geändert wird. Der physiologische Prozeß also, der die willkürliche Erhebung des Auges bedingt, vermag die Höhenempfindung ganz oder teilweise zu ersetzen, ist mit ihr gleichartig, kurz gesagt, algebraisch mit derselben summierbar. Drehe ich den Augapfel durch einen leichten Ruck mit dem Finger aufwärts, so scheint sich hierbei das Objekt A, der Verkleinerung des Bogens o a entsprechend, in der Tat zu senken. Dasselbe geschieht, wenn durch irgend einen andern unbewußten oder unwillkürlichen Prozeß, z. B. durch einen Krampf der Augenmuskel, der Augapfel sich aufwärts dreht. Nach einer seit mehreren Dezennien bekannten Erfahrung der Augenärzte greifen Patienten mit einer Lähmung des Rectus externus zu weit nach rechts, wenn sie ein rechts liegendes Objekt ergreifen wollen. Da dieselben eines stärkeren Willensimpulses bedürfen als Gesunde, um ein rechtsliegendes Objekt zu fixieren, so liegt der Gedanke nahe, daß der Wille, rechts zu blicken, die optische Raumempfindung "rechts" bedingt. Ich habe vor Jahren11) diese Erfahrung in die Form eines Versuches gebracht, den jeder sofort anstellen kann. Man drehe die Augen möglichst nach links und drücke nun an die rechten Seiten der Augäpfel zwei große Klumpen von ziemlich festem Glaserkitt gut an. Versucht man alsdann rasch nach rechts zu blicken, so gelingt dies wegen der ungenauen Kugelform der Augen nur sehr unvollkommen, und die Objekte verschieben sich hierbei ausgiebig nach rechts. Der bloße Wille, rechts zu blicken, gibt also den Netzhautbildern an bestimmten Netzhautstellen einen größeren Rechtswert, wie wir kurz sagen wollen. Der Versuch wirkt anfangs überraschend. Wie man aber bald merkt, lehren die beiden einfachen Erfahrungen, daß durch willkürliche Rechtswendung der Augen die Objekte nicht verschoben, und daß durch gewaltsame unwillkürliche Linkswendung die Objekte nach rechts verschoben werden, zusammen genau dasselbe. Mein Auge, welches ich rechts wenden will und nicht kann, läßt sich als ein willkürlich rechts gewendetes und durch eine äußere Kraft gewaltsam zurückgedrehtes Auge ansehen. Professor W. James12) wollte der erwähnte Versuch nicht gelingen. Ich habe denselben oft wiederholt und immer bestätigt gefunden. Die Tatsache, glaube ich, steht fest, womit aber natürlich nicht über die Richtigkeit der Auffassung entschieden ist.
11) Kurz nach Abschluß meiner "Grundlinien der Lehre von den Bewegungsempfindungen"
(1875).
12) W. James, The principles of Psychology, II, 509.
3.
Der Wille, Blickbewegungen aufzuführen, oder die Innervation (?), ist die Raumempfindung selbst. Dies ergibt sich ungezwungen aus der angeführten Betrachtung13). Wenn wir an einer Hautstelle ein Jucken oder einen Stich empfinden, wodurch unsere Aufmerksamkeit genügend gefesselt wird, so greifen wir sofort mit dem richtigen Ausmaß der Bewegung dahin. Ebenso drehen wir die Augen mit dem richtigen Ausmaß nach einem Netzhautbild, sobald dasselbe uns genügend reizt, und wir es demnach beachten. Vermöge organischer Einrichtungen und langer Übung treffen wir sofort die zur Fixierung eines auf bestimmter Netzhautstelle sich abbildenden Objektes eben zureichende Innervation. Sind die Augen schon rechts gewendet, und fangen wir an, ein neues mehr rechts oder links gelegenes Objekt zu beachten, so fügt sich eine neue gleichartige Innervation der schon vorhandenen algebraisch hinzu. Eine Störung entsteht erst, wenn zu den willkürlich abgemessenen Innervationen fremdartige unwillkürliche oder äußere bewegende Kräfte hinzutreten.
Als ich mich vor Jahren mit den hierher gehörigen Fragen beschäftigte, bemerkte ich eine eigentümliche Erscheinung, die meines Wissens noch nicht beschrieben worden ist. Wir betrachten in einem recht dunklen Zimmer ein Licht A und führen dann eine rasche Blickbewegung nach dem tieferen Licht B aus. Das Licht A scheint hierbei einen (rasch verschwindenden) Schweif AA' nach oben zu ziehen. Dasselbe tut natürlich auch das Licht B, was zur Vermeidung von Komplikationen in der Figur nicht angedeutet ist. Der Schweif ist selbstverständlich ein Nachbild, welches erst bei Beendigung oder kurz vor Beendigung der Blickbewegung zum Bewußtsein kommt, jedoch, was eben merkwürdig ist, mit Ortswerten, welche nicht der neuen Augenstellung und Innervation, sondern noch der frühern Augenstellung und Innervation entsprechen. Ähnliche Erscheinungen bemerkt man oft beim Experimentieren mit der Holtzschen Elektrisiermaschine. Wird man während einer Blickbewegung abwärts von einem Funken überrascht, so erscheint derselbe oft hoch über den Elektroden. Liefert er ein dauerndes Nachbild, so zeigt sich dieses natürlich unter den Elektroden. Diese Vorgänge entsprechen der sogenannten persönlichen Differenz der Astronomen, nur daß sie auf das Gebiet des Gesichtssinnes beschränkt sind. Durch welche organischen Einrichtungen dies Verhältnis bedingt ist, muß dahingestellt bleiben, wahrscheinlich hat es aber einen gewissen Wert für Verhinderung der Desorientierung bei Augenbewegungen 14).
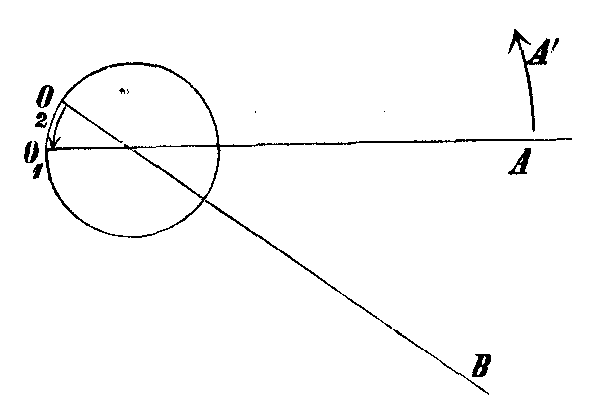
Wir dachten uns bisher der Einfachheit wegen nur die fixierenden Augen bewegt, hingegen den Kopf (und überhaupt den Körper) ruhig. Drehen wir nun den Kopf ganz beliebig, ohne ein optisches Objekt absichtlich ins Auge zu fassen, so bleiben die Objekte hierbei ruhig. Zugleich kann aber ein anderer Beobachter bemerken, daß die Augen wie reibungslose träge Massen an den Drehbewegungen keinen Anteil nehmen. Noch auffallender wird der Vorgang, wenn man sich kontinuierlich aktiv oder passiv um die Vertikalachse, von oben gesehen, etwa im Sinne des Uhrzeigers, herumdreht. Die offenen oder geschlossenen Augen drehen sich dann, wie Breuer beobachtet hat, etwa zehnmal auf eine volle Umdrehung des Körpers gleichmäßig verkehrt wie der Uhrzeiger, und ebenso oft ruckweise im Sinne des Uhrzeigers zurück. Die Figur 17 veranschaulicht diesen Vorgang. Nach OT sind die Zeiten als Abszissen, aufwärts als Ordinaten die Drehungswinkel im Sinne des Uhrzeigers, abwärts im entgegengesetzten Sinne aufgetragen. Die Kurve OA entspricht der Drehung des Körpers, OBB der relativen und OCC der absoluten Drehung der Augen. Niemand wird sich bei Wiederholung der Beobachtung der Überzeugung verschließen können, daß man es mit einer durch die Körperdrehung reflektorisch vom Labyrinth ausgelösten automatischen (unbewußten) Augenbewegung zu tun hat. Dieselbe verschwindet, sobald die (passive) Drehung nicht mehr empfunden wird. Wie diese Bewegung zustande kommt, bleibt natürlich zu untersuchen. Eine einfache Vorstellung wäre die, daß von zwei antagonistischen Innervationsorganen der ihnen bei der Körperdrehung gleichmäßig zufließende Reiz von dem einen wieder mit einem gleichmäßigen Innervationsstrom beantwortet wird, während das andere immer erst nach einer gewissen Zeit wie ein gefüllter und plötzlich umkippender Regenmesser einen Innervationsstoß abgibt. Für uns genügt es vorläufig zu wissen, daß diese automatische kompensierende unbewußte Augenbewegung tatsächlich vorhanden ist.
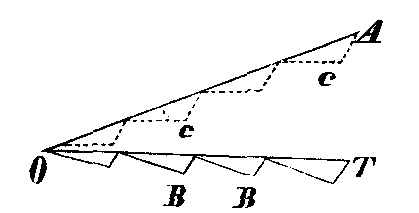
Bekannt ist die kompensatorische Raddrehung der Augen, welche bei Seitwärtsneigung
des Kopfes auftritt. Nagel15) hat
nachgewiesen, daß dieselbe 1/10 — 1/6
des Winkels der Kopfneigung beträgt. Kürzlich haben nun Breuer
und Kreidl16) auch im Drehapparat
solche Versuche angestellt und gefunden:
"Wir empfinden, wie Purkynie und Mach
gesagt haben, die Richtung der Massenbeschleunigung. Ändert sich diese
Richtung durch Hinzutritt einer seitlich auf den Körper wirkenden
horizontalen Beschleunigung, so tritt eine Raddrehung der Augen auf, welche
während der Dauer jener Einwirkung anhält und die Hälfte,
0,6 des Ablenkungswinkels beträgt. Die Drehung des Sehraumes, die
Schiefstellung vertikaler Linien, welche unter solchen Verhältnissen
wahrgenommen wird, beruht also auf einer wirklichen unbewußten Drehung
der Augen."
Ich muß hier ferner noch zweier Arbeiten über
kompensierende Augenbewegungen gedenken, welche von Crum Brown 17)
herrühren.
16) Breuer u. Kreidl, Über scheinbare Drehung des Gesichtsfeldes während der Einwirkung einer Zentrifugalkraft. Pflügers Archiv, Bd. 70, S. 494.
17) Crum Brown, Note on normal nystagmus. Proceedings of the Royal Society of Edinburgh, February 4, 1895. — The relation between the movements of the eyes and the movements of the head. Robert Boyle lecture, May 13, 1895.
Die langsamere unbewußte kompensierende Augenbewegung (die ruckweise
hinterläßt keinen optischen Eindruck) ist also die Ursache,
daß die Objekte bei Kopfdrehungen ihren Ort beizubehalten scheinen,
was für die Orientierung sehr wichtig ist. Drehen wir nun mit dem
Kopf in demselben Sinn, das fixierte Objekt wechselnd, auch willkürlich
die Augen, so müssen wir durch die willkürliche Innervation die
automatische unwillkürliche überkompensieren. Wir bedürfen
derselben Innervation, als ob der ganze Drehungswinkel vom Auge allein
zurückgelegt worden wäre. Hierdurch erklärt es sich auch,
warum, wenn wir uns umdrehen, der ganze optische Raum uns als ein Kontinuum
und nicht als ein Aggregat von Gesichtsfeldern erscheint, und warum hierbei
die optischen Objekte festliegend bleiben. Was wir beim Umdrehen von unserem
eigenen Körper sehen, sehen wir aus klarliegenden Gründen optisch
bewegt.
So gelangen wir also zu der praktisch wertvollen
Vorstellung unseres bewegten Körpers in einem festliegenden Raume.
Es wird uns verständlich, daß wir bei mehrfachen Drehungen und
Wendungen in Straßen, in Gebäuden, und bei passiven Drehungen
im Wagen, oder in der Kajüte eingeschlossen (ja selbst in der Dunkelheit)
die Orientierung nicht verlieren. Allerdings schlafen die Urkoordinaten,
von welchen wir ausgingen, allmählich und unvermerkt ein, und bald
zählen wir wieder von den Objekten aus, welche vor uns liegen. Der
eigentümlichen Desorientierung, in welcher man sich zuweilen nachts
beim plötzlichen Erwachen befindet, ratlos das Fenster, den Tisch
usw. suchend, mögen wohl dem Erwachen unmittelbar vorausgehende motorische
Träume zugrunde liegen.
Ähnliche Verhältnisse wie bei Körperdrehungen
zeigen sich bei Körperbewegungen überhaupt. Bewege ich den Kopf
oder den ganzen Körper seitwärts, so verliere ich ein optisch
fixiertes Objekt nicht. Dasselbe scheint fest zu stehen, während die
ferneren Objekte eine der Körperbewegung gleichsinnige, die näheren
eine entgegengesetzte parallaktische Verschie-bung erfahren. Die gewohnten
parallaktischen Verschiebungen werden gesehen, stören aber nicht,
und werden richtig interpretiert. Bei monokularer Inversion eines Plateau'schen
Drahtnetzes aber fallen die dem Sinne und dem Ausmaß nach ungewohnten
parallaktischen Bewegungen sofort auf, und spiegeln uns ein gedrehtes Objekt
vor18).
Wenn ich meinen Kopf drehe, so sehe ich nicht nur jenen Teil desselben, den ich überhaupt sehen kann, gedreht, was nach dem Vorausgeschickten sofort verständlich ist, sondern ich fühle ihn auch gedreht. Dies beruht darauf, daß im Gebiete des Tastsinnes ganz analoge Verhältnisse bestehen, wie im Gebiete des Gesichtssinnes19). Greife ich nach einem Objekt, so kompliziert sich eine Tastempfindung mit einer Innervation. Blicke ich nach dem Objekt, so tritt an die Stelle der Tastempfindung eine Lichtempfindung. Da Hautempfindun-gen auch ohne Tasten von Objekten immer vorgefunden werden, sobald man ihnen die Aufmerksamkeit zuwendet, so geben diese, mit wechselnden Innervationen kompliziert, ebenfalls die Vorstellung unseres bewegten Körpers, welche mit der auf optischem Wege gewonnenen in voller Übereinstimmung steht.
8.
Das hier dargelegte einfache Verhältnis übersah ich noch nicht vollständig bei Abfassung meiner Schrift über Bewegungsempfindungen. In Folge dessen blieben mir einige teils von Breuer, teils von mir beobachtete Erscheinungen schwer verständlich, die sich nun ohne Schwierigkeit erklären, und die ich kurz berühren will. Bei passiver Drehung eines in einem Kasten eingeschlossenen Beobachters nach rechts erscheint demselben der Kasten optisch gedreht, obgleich jeder Anhaltspunkt zur Beurteilung einer Relativdrehung fehlt. Führen seine Augen unwillkürlich kompensierende Bewegungen nach links aus, so verschieben sich die Netzhautbilder so, daß er eine Bewegung nach rechts sieht. Fixiert er aber den Kasten, so muß er die unwillkürlichen Bewegungen willkürlich kompensieren, und sieht nun wieder eine Bewegung nach rechts. Es wird hierdurch deutlich, daß die Breuersche Erklärung der Scheinbewegung des Augenschwindels richtig ist, und daß gleichwohl durch willkürliches Fixieren diese Bewegung nicht zum Verschwinden gebracht werden kann. Auch die übrigen in meiner Schrift erwähnten Fälle des Augenschwindels finden auf analoge Weise ihre Erledigung20).
20) Grundlinien der Lehre von den Bewegungsempfindungen. Leipzig, Engelmann, 1875, S. 83.
Wenn wir uns bewegen, z. B. vorwärts schreiten
oder uns drehen, so haben wir nicht nur eine Empfindung der jedesmaligen
Lage unserer Körperteile, sondern auch noch die viel einfachere Empfindung
einer Vorwärtsbewegung oder Drehung. In der Tat setzen wir die Vorstellung
der Vorwärtsbewegung nicht aus den Vorstellungen der einzelnen Beinschwingungen
zusammen, oder haben wenigstens nicht nötig, dies zu tun. Ja es gibt
sogar Fälle, in welchen die Empfindung der Vorwärtsbewegung entschieden
vorhanden ist, jene der Beinbewegung aber ebenso entschieden fehlt. Dies
trifft z.B. bei einer Eisenbahnfahrt zu, auch schon bei dem Gedanken
einer Reise, andeutungsweise bei der Erinnerung an einen fernen Ort u.
s. w. Dies kann nur daran liegen, daß der Wille, sich vorwärts
zu bewegen oder zu drehen, aus welchen die Extremitäten ihre motorischen
Anregungen schöpfen, die ja durch besondere Innervationen noch modifiziert
werden können, verhältnismäßig einfacher Natur ist.
Es bestehen hier wohl ähnliche, wenn auch kompliziertere Verhältnisse,
wie jene bei den Augenbewegungen, welche Hering so glücklich
durchschaut hat, worauf wir alsbald zurückkommen.
Man wird kaum fehl gehen, wenn man annimmt, daß
die vom Labyrinth aus erregten, verhältnismäßig einfachen
Bewegungsempfindungen21) mit dem Willen,
sich zu bewegen, im engsten Zusammenhange stehen. Diese Bewegungsempfindungen
möchten auch den von Riehl22) postulierten, bezw.
von ihm gesuchten Richtungsgefühlen entsprechen. Sie sind dem Blinden
ebenso eigen wie dem Sehenden, und bilden wohl mit eine wichtige Grundlage
des Verständnisses des Tastraums.
21) a. a. O. S. 124.
22) Riehl, Der philosophische Kritizismus, Bd. 2, S. 143.
Ich habe eine Reihe von Beobachtungen über optische und Bewegungsempfindungen in den Ausdruck zusammengefaßt: "Es sieht so aus, als ob der sichtbare Raum sich in einem zweiten Raum drehen würde, den man für unverrückt fest hält, obgleich letzteren nicht das mindeste Sichtbare kennzeichnet". Der auf die Bewegungsempfindungen aufgebaute Raum scheint in der Tat das Ursprüngliche zu sein23).
23) Bewegungsempfindungen S. 26.
Befangen in physikalischer Denkweise, war ich geneigt zu glauben, daß die Empfindungen der Progressivbeschleunigung sich vollkommen analog verhalten den Empfindungen der Winkelbeschleunigung. In der Tat werden jedem Physiker, der sich mit unserem Gegenstand beschäftigt, sofort die drei Gleichungen für die drehende, und die drei Gleichungen für die fortschreitende Bewegung eines Körpers in den Sinn kommen. Außerdem glaubte ich, entsprechend dem Prinzip der spezifischen Energie, besondere Empfindungen der Kopflage vermuten zu dürfen. Breuer24) hat durch eine spätere Untersuchung wahrscheinlich gemacht, daß die Empfindungen der Progressivbeschleunigung sehr viel rascher verschwinden als jene der Winkelbeschleunigung, beziehungsweise daß vielleicht das Organ der ersteren, wenigstens beim Menschen, verkümmert ist. Ferner findet Breuer, außer den Bogengängen B, nur noch den Otolithenapparat O mit seinen den Bogengangebenen entsprechenden Gleitebenen geeignet, Progressivbeschleunigungen und Lagen zugleich zu signalisieren. Die drei Schwerekomponenten nach den drei Gleitebenen charakterisieren die Lage des Kopfes. Jede Änderung der Lage ändert diese Komponenten und setzt zugleich den Bogengangapparat momentan in Funktion. Progressivbeschleunigungen ändern diese Komponenten ebenfalls, ohne den Bogenapparat zu beanspruchen. Demnach würden nach Breuer die drei Kombinationen: O allein, O + B, und B allein für die Unterscheidung aller Fälle genügen. Diese Auffassung wäre also, wenn sie sich bewährt, eine bedeutende Vereinfachung.
24) Breuer, Über die Funktion des Otholithen-Apparates. Pflügers Archiv, Bd. XLVI, S. 195.
Wäre ich überhaupt noch in der Lage zu experimentieren, so würde ich die Bewegungsempfindungen an sich nochmals von Grund aus untersuchen. Der Unterschied in dem Verhalten der Empfindungen der Winkel- und Progressivbeschleunigungen scheint mir jetzt bedeutend. Die Drehbeschleunigung löst eine Empfindung aus, welche lange, nachdem die Beschleunigung Null geworden, in abnehmender, quantitativ25) zu verfolgender Stärke fortbesteht. Die Progressivbeschleunigung wird rein nur beim vertikalen beschleunigten Fallen oder Steigen empfunden. Verschwindet die Beschleunigung, so ist auch die Empfindung rasch vernichtet. Das einfachste Mittel, eine konstante Beschleunigung von konstanter Richtung gegen den Leib zu erzeugen, ist die gleichförmige Rotation. Wir empfinden die gleichförmige Drehung bald nicht mehr. Aber auch die konstante Zentrifugalbeschleunigung ruft nicht die Illusion des Fortfliegens nach deren Richtung, sondern die Empfindung einer geänderten Lage hervor, welche mit jener Zentrifugalbeschleunigung zugleich wieder verschwindet. Erschöpft sich also die konstante Progressivbeschleunigung als Reiz, oder ändert die Empfindung beim Konstantwerden des Reizes ihren Charakter? Dann müßten doch zwei Elemente in derselben vermutet werden.
25) Bewegimgsempfindungen, S. 96, Versuch 2.
Nicht die gleichförmige Bewegung, sondern lediglich die Beschleunigung wird empfunden. Den Elementen der Änderung der Progressiv- und Winkelgeschwindigkeit entsprechen Elemente der Bewegungsempfindungen, von welchen wenigstens die letzteren in langsam abnehmender Stärke persistieren, und übrigens so wie jene algebraisch summierbar sind, so daß einer (gewöhnlich von der Geschwindigkeit Null an) in kurzer Zeit eingeleiteten Bewegung eine der totalen Geschwindigkeitsänderung, also der erreichten Geschwindigkeit v, entsprechende Empfindung q zugeordnet ist26). Die Menge der vorbeigeführten Gesichts- und Tasteindrücke wächst nun mit q und mit der Zeit t. Es darf uns daher nicht wundern, daß die Erfahrung uns q als eine Geschwindigkeit und q.t als einen Weg begrifflich interpretieren lehrt, wenngleich q an sich natürlich mit einem räumlichen Maßbegriff gar nichts zu schaffen hat. Es scheint mir hiermit ein paradoxer Rest beseitigt, welcher mich noch 1875 in der Auffassung der Bewegungsempfindungen störte, und welcher, wie ich sehe, auch andere gestört hat27).
26) a. a. O. 116 u. fg.
27) a. a. O. S. 122 (l0).
9.
Die folgenden Versuche und Überlegungen, welche an eine ältere Mitteilung anknüpfen28), werden vielleicht die richtige Auffassung dieser Erscheinungen fördern. Wir stellen uns auf eine Brücke und betrachten das unter derselben durchfließende Wasser. Dann empfinden wir gewöhnlich uns in Ruhe, das Wasser aber in Bewegung. Längeres Hinblicken auf das Wasser hat aber bekanntlich fast regelmäßig zur Folge, daß plötzlich die Brücke mit dem Beobachter und der ganzen Umgebung dem Wasser entgegen in Bewegung zu geraten scheint, während umgekehrt das Wasser den Anschein der Ruhe gewinnt29). Die relative Bewegung der Objekte ist in beiden Fällen dieselbe, und es muß demnach einen triftigen physiologischen Grund haben, warum bald der eine, bald der andere Teil der Objekte bewegt empfunden wird. Um dies bequem untersuchen zu können, habe ich mir einen einfachen Apparat konstruiert, der in Fig. 18 dargestellt ist. Ein einfach gemusterter Ledertuchlaufteppich wird horizontal über zwei 2 m lange, 3 m voneinander in Lagern befestigte Walzen gezogen und mit Hilfe einer Kurbel in gleichmäßige Bewegung gesetzt. Quer über den Teppich, etwa 30 cm über demselben, ist ein Faden ff mit einem Knoten K gespannt, der dem bei A aufgestellten Beobachter als Ruhepunkt für das Auge dient. Folgt der Beobachter mit den Augen den Zeichnungen des im Sinne des Pfeiles bewegten Teppichs, so sieht er diesen in Bewegung, sich und die Umgebung aber ruhig. Fixiert er hingegen den Knoten, so glaubt er alsbald mit dem ganzen Zimmer, dem Pfeile entgegen, in Bewegung zu geraten, während er den Teppich für stillstehend hält. Dieser Wechsel des Anblicks vollzieht sich je nach der Stimmung in längerer oder kürzerer Zeit, gewöhnlich nach einigen Sekunden. Weiß man einmal, worauf es ankommt, so kann man ziemlich rasch und willkürlich mit den beiden Eindrücken wechseln. Jedes Verfolgen des Teppichs bringt den Beobachter zum Stehen, jedes Fixieren von K oder Nichtbeachten des Teppichs, wobei dessen Zeichnungen verschwimmen, setzt den Beobachter in Bewegung. Bezüglich des Ausfalls dieses Versuchs unter den angegebenen Umständen stimmen mir zwei von mir hochgeschätzte Forscher nicht zu. Der eine ist W. James30), der andere Crum Brown31). Ich habe den Versuch oft und oft immer mit dem gleichen Erfolge angestellt. Da ich gegenwärtig nicht in der Lage bin, zu experimentieren, muß ich auf eine neuerliche Prüfung verzichten, für welche sich die von Brown beschriebene Nachbildmethode empfehlen würde. Von den Differenzen in der theoretischen Auffassung des Versuches soll hier zunächst abgesehen werden.
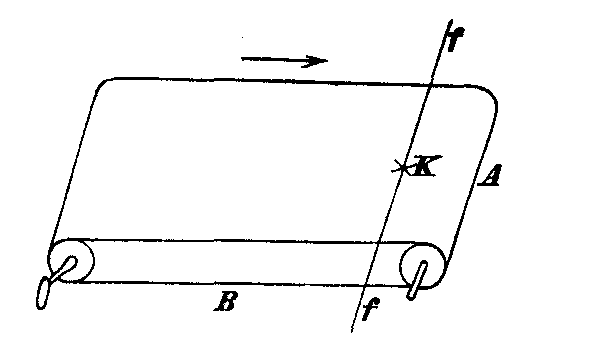
28) a. a. O. S. 85.
31) Crum Brown, On normal Nystagmus. Vergl. S. 109 dieser Schrift.
10.
Die Erscheinung ist selbstredend gänzlich verschieden von der bekannten
Plateau - Oppelschen, die eine lokale Netzhauterscheinung
ist. Bei dem obigen Experiment bewegt sich die deutlich gesehene ganze
Umgebung, bei dem letztern Phänomen zieht ein bewegter Schleier über
das ruhige Objekt hin. Auch die nebenbei auftretenden stereoskopischen
Erscheinungen, bei welchen z. B. der Faden mit dem Knoten unter dem sich
als durchsichtig darstellenden Teppich erscheint, sind hier ganz gleichgültig.
In meiner Schrift über "Bewegungsempfindungen"
S. 63 habe ich konstatiert, daß den Plateau-Oppelschen Erscheinungen
ein besonderer Prozeß zu grunde liegt, der mit den übrigen Bewegungsempfindungen
nichts zu schaffen hat. Es heißt daselbst: "Dementsprechend werden
wir daran denken müssen, daß mit der Bewegung eines Netzhautbildes
ein besonderer Prozeß erregt wird, der in der Ruhe nicht vorhanden
ist, und daß bei entgegengesetzten Bewegungen ganz ähnliche
Prozesse in ähnlichen Organen erregt werden, welche sich aber gegenseitig
in der Art ausschließen, daß mit dem Eintreten des einen der
andere erlöschen muß, und mit der Erschöpfung des einen
der andere eintritt. — Dies scheinen S. Exner und Vierordt
übersehen zu haben, welche später ähnliche Ansichten über
denselben Gegenstand ausgesprochen haben.
11.
Bevor wir an die Erklärung des Versuches (Fig. 18) gehen, wollen wir denselben noch variieren. Ein Beobachter, der sich bei B aufstellt, meint unter den angegebenen Umständen mit seiner ganzen Umgebung nach links zu fliegen. Wir bringen ferner über dem Teppich TT, Fig. 19, einen gegen den Horizont um 45 ° geneigten Spiegel S S an. Durch S S betrachten wir das Spiegelbild T' T', nachdem wir auf die Nase noch einen Schirm n n gesetzt haben, welcher dem Auge O den direkten Anblick von T T entzieht. Bewegt sich T T im Sinne des Pfeiles, während wir das Spiegelbild K' von K fixieren, so glauben wir alsbald mit dem ganzen Zimmer zu versinken, bei umgekehrter Bewegung glauben wir hingegen wie in einem Luftballon zu steigen32). Endlich gehören hierher noch die Versuche mit der Papiertrommel, welche ich bereits beschrieben habe33), und auf die auch die nachfolgende Erklärung anzuwenden ist. Alle diese Erscheinungen sind keine rein optischen, sondern sie sind von einer unverkennbaren Bewegungsempfindung des ganzen Leibes begleitet.
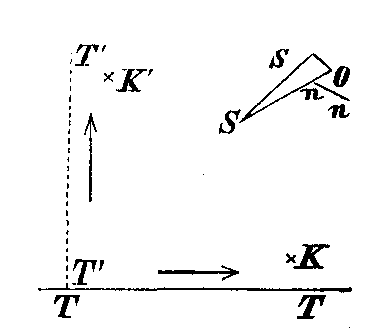
33) Bewegungsempfindungen, S. 85. — Neuere Versuche bei A. v. Szily, Bewegungsnachbild und Bewegungskontrast. Zeitschr. f. Psychol. u. Physiol. d. Sinnesorgane, 1905, Bd. 38, S. 81.
Wie haben wir nun unsere Gedanken einzurichten, um in denselben die
besprochenen Tatsachen in einfachster Weise darzustellen? Bewegte Objekte
üben bekanntlich einen besonderen Bewegungsreiz auf das Auge aus,
ziehen die Aufmerksamkeit und den Blick auf sich. Folgt ihnen der Blick
wirklich, so müssen wir nach allem bisher Besprochenen annehmen, daß
die Objekte bewegt erscheinen. Soll das Auge trotz der bewegten Objekte
auf die Dauer ruhig bleiben, so muß der von denselben ausgehende
konstante Bewegungsreiz durch einen konstanten, dem motorischen Apparat
des Auges zufließenden Innervationsstrom kompensiert werden, ganz
so, als wäre der ruhige fixierte Punkt gleichmäßig entgegengesetzt
bewegt, und als wollte man demselben mit den Augen folgen. Tritt dies aber
ein, so muß alles fixierte Unbewegte bewegt erscheinen. Daß
dieser Innervationsstrom immer mit bewußter Absicht eingeleitet werde,
wird kaum notwendig sein, wenn er nur von demselben Zentrum aus und auf
denselben Wegen verläuft, von welchen das willkürliche Fixieren
ausgeht.
Um die zuvor besprochenen Erscheinungen zu beobachten,
bedarf es gar keiner besonderen Vorkehrungen. Wir sind vielmehr immer von
denselben umgeben. Ich schreite durch einen einfachen Willensakt vorwärts.
Meine Beine vollführen ihre Schwingungen, ohne daß ich mich
besonders darum kümmere, und meine Augen sind fest auf das Ziel gerichtet,
ohne sich von den durch das Ausschreiten bewegten Netzhautbildern ablenken
zu lassen. Mit einem Willensakt ist alles dies eingeleitet, und dieser
Willensakt selbst ist die Empfindung der Vorwärtsbewegung. Derselbe
Prozeß, oder doch ein Teil desselben, wird auch auftreten müssen,
sollen die Augen dem Reize einer Masse von bewegten Objekten dauernd widerstehen.
Daher die Bewegungsempfindung bei den obigen Versuchen.
Beobachten wir ein Kind auf einem Eisenbahnzuge,
so folgen dessen Augen fast unausgesetzt in zuckender Bewegung den äußern
Objekten, welche ihm zu laufen scheinen. Auch der Erwachsene hat die gleiche
Empfindung, wenn er sich den Eindrücken zwanglos hingibt. Fahre ich
voraus, so dreht sich, aus naheliegenden Gründen, der ganze Raum zu
meiner Linken um eine sehr ferne vertikale Achse im Sinne des Uhrzeigers,
der ganze Raum zu meiner Rechten ebenso umgekehrt. Erst wenn ich dem Verfolgen
der Objekte widerstehe, tritt für mich die Empfindung der Vorwärtsbewegung
auf.
13.
Meine Ansichten über Bewegungsempfindungen sind bekanntlich mehrfach
angefochten worden, wobei allerdings die Polemik immer nur gegen die Hypothese
gerichtet war, auf welche ich selbst keinen besonderen Wert gelegt habe.
Daß ich sehr gern bereit bin, meine Ansichten nach Maßgabe
der bekannt gewordenen Tatsachen zu modifizieren, dafür mag eben die
vorliegende Schrift den Beweis liefern. Ich will die Entscheidung darüber,
wieweit ich das Richtige getroffen habe, mit Beruhigung der Zukunft überlassen.
Andrerseits möchte ich nicht unbemerkt lassen, daß sich auch
für die von mir, Breuer und Brown aufgestellte Ansicht
günstige Beobachtungen ergeben haben. Hierher gehören zunächst
die von Dr. Guye (in Amsterdam) gesammelten Erfahrungen (Du Vertige
de Ménière. Rapport lu dans la section d'otologie du congrès
périodique international de sciences médicales a Amsterdam,
1879). Guye beobachtete bei Erkrankungen des Mittelohres reflektorische
Kopfdrehungen beim Einblasen von Luft in die Trommelhöhle und fand
einen Patienten, der genau den Sinn und die Anzahl der Drehungen angeben
konnte, welche er beim Einspritzen von Flüssigkeiten empfunden hatte.
Professor Crum Brown, On a case of dyspeptic vertigo (Proceedings
of the Royal Society of Edinburgh, 1881–82) beschreibt einen an sich beobachteten
interessanten Fall von pathologischem Schwindel, welcher sich in seiner
Gesamtheit durch eine gesteigerte Intensität und verlängerte
Dauer der jeder Drehung folgenden Empfindung erklären ließ.
— Am merkwürdigsten sind aber die Beobachtungen von William James
(The sense of dizzines in deafmutes. American Journal of Otology, Volume
IV, Oktober 1882). James fand eine relative vorwiegende auffallende
Unempfindlichkeit der Taubstummen gegen den Drehschwindel, häufig
eine große Unsicherheit des Ganges derselben bei geschlossenen Augen,
und in manchen Fällen eine überraschende Desorientierung beim
Untertauchen unter Wasser, wobei Beängstigung und gänzliche Unsicherheit
über das Oben und Unten eintrat. Diese Beobachtungen sprechen sehr
dafür, daß bei den Taubstummen, wie es nach meiner Auffassung
zu erwarten war, der eigentliche Gleichgewichtssinn sehr zurücktritt,
und daß dieselben die beiden andern orientierenden Sinne, den Gesichtssinn
und den Muskelsinn (welcher letztere beim Versinken im Wasser mit der Aufhebung
des Körpergewichtes alle Anhaltspunkte verliert), desto nötiger
haben.
Die Ansicht ist nicht haltbar, daß wir zur
Kenntnis des Gleichgewichtes und der Bewegungen nur durch die Halbzirkelkanäle
gelangen. Höchst wahrscheinlich haben vielmehr auch niedere Tiere,
denen das entsprechende Organ ganz fehlt, Bewegungsempfindungen. Es war
mir bisher nicht möglich, in dieser Richtung Versuche anzustellen.
Die Versuche aber, welche Lubbock in seiner Schrift über "Ameisen,
Bienen und Wespen" (Leipzig, Brockhaus, 1885, S. 220) beschrieben hat,
werden mir durch die Annahme von Bewegungsempfindungen viel verständlicher.
Da möglicherweise andern derartige Versuche näher liegen, ist
es vielleicht nicht unnütz, wenn ich einen Apparat bespreche, den
ich (Anzeiger der Wiener Akademie, 30. Dezember 1876) schon kurz beschrieben
habe. Andere Apparate dieser Art sind später von Govi und Ewald
konstruiert worden. Man hat sie nachher Cyclostaten genannt.
Der Apparat dient dazu, das Verhalten von Tieren
bei rascher Rotation derselben zu beobachten. Da nun das Bild durch die
Rotation verwischt wird, so muß die passive Rotation optisch aufgehoben
und ausgeschaltet werden, so daß die aktiven Bewegungen des Tieres
allein übrig bleiben und beobachtbar werden. Man erreicht die optische
Aufhebung der Rotation einfach dadurch, daß man über der Scheibe
der Zentrifugalmaschine genau um dieselbe Achse mit Hilfe einer Zahnradübertragung
ein Reflexionsprisma mit der halben Winkelgeschwindigkeit der Scheibe und
in demselben Sinne rotieren läßt.
Die Figur 20 gibt eine Ansicht des Apparates.
Auf der Scheibe der Zentrifugalmaschine befindet sich ein Glasbehälter
g, in welchem die zu beobachtenden Tiere eingeschlossen werden.
Durch eine Zahnradübertragung wird das Okular o mit der halben
Winkelgeschwindigkeit und in demselben Sinne wie g gedreht. Nebenstehende
Figur zeigt die Verzahnung in einer besondern Darstellung. Das Okular OO
und der Behälter gg drehen sich um die Achse AA, während
ein Paar von Zahnrädern, die fest mit einander verbunden sind, sich
um BB drehen. Der Radius des mit gg starr verbundenen Zahnrades
aa sei = r, dann ist r jener von bb,![]() ,
jener von cc, jener von dd aber =
,
jener von cc, jener von dd aber = ![]() ,
womit das verlangte Geschwindigkeitsverhältnis von oo und gg
erzielt ist.
,
womit das verlangte Geschwindigkeitsverhältnis von oo und gg
erzielt ist.

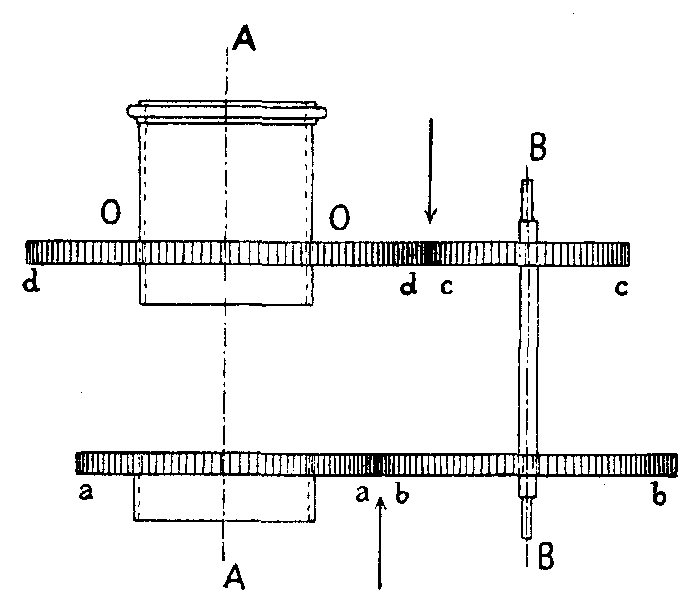
Fig. 21
Um den Apparat zu zentrieren, legt man auf die Bodenscheibe
des Behälters einen mit Stellschrauben versehenen Spiegel S und
justiert denselben so, daß beim Rotieren die Bilder in demselben
ruhig bleiben. Dann steht er senkrecht auf der Rotationsachse des Apparates.
Einen zweiten kleinen Spiegel S', dessen Belegung ein kleines Loch
L enthält, bringt man an dem leeren Okularrohr mit der spiegelnden
Fläche nach unten so an, daß bei der Rotation die Bilder unbewegt
bleiben, die man durch das Loch hindurch in dem Spiegelbilde von S'
in S sieht. Dann steht S' senkrecht auf der Okularachse.
Nun bringt man, was nach einigen Versuchen leicht gelingt, mit Hilfe eines
Pinsels auf dem Spiegel S einen Punkt P an, welcher beim
Rotieren seine Lage nicht ändert, und stellt das Loch im Spiegel S'
so, daß es bei der Rotation ebenfalls an Ort und Stelle bleibt.
Hierdurch sind Punkte der beiden Rotationsachsen gewonnen. Stellt man nun
das Okular (mit Hilfe von Schrauben) so, daß man, durch das Loch
in S' hindurchsehend, den Punkt P auf S und das Spiegelbild
von L in S (oder eigentlich die vielen Spiegelbilder von
P und L ) in Deckung sieht, so sind die beiden Achsen nicht
nur parallel, sondern sie fallen auch zusammen.
Als Okular könnte man in der einfachsten Weise
einen Spiegel, dessen Ebene die Achse enthält, anwenden, und ich habe
dies bei dem ersten Rudiment meines Apparates auch getan. Allein man verliert
hierdurch die Hälfte des Gesichtsfeldes. Ein total reflektierendes
Prisma ist deshalb viel vorteilhafter. In der Figur 22 stelle A
B C einen ebenen Schnitt senkrecht zu der Hypothenusenfläche und
den Kathetenflächen des total reflektierenden Okularprismas vor. Dieser
Schnitt enthalte zugleich die Rotationsachse O N P Q, welche parallel
zu. AB ist. Der Strahl, welcher nach der Achse Q P fortgeht,
muß nach der Brechung und Reflexion im Prisma wieder nach der Achse
N O fortgehen und das (in der Achse befindliche) Auge O treffen.
Wenn dies erfüllt ist, können die Punkte der Achse bei der Rotation
keine Verschiebung erfahren und der Apparat ist zentriert. Der betreffende
Strahl muß also den Mittelpunkt M von AB treffen und
schneidet demnach, weil er unter dem Inzidenzwinkel von 45° auf Crownglas
fällt, AB unter etwa 16° 40'. Hiernach muß O P
um etwa 0.115. A B von der Achse abstehen, welches Verhältnis
am besten empirisch hergestellt wird, indem man das Prisma im Okular so
verschiebt, daß Schwankungen der Objekte in gg bei der Rotation
wegfallen.
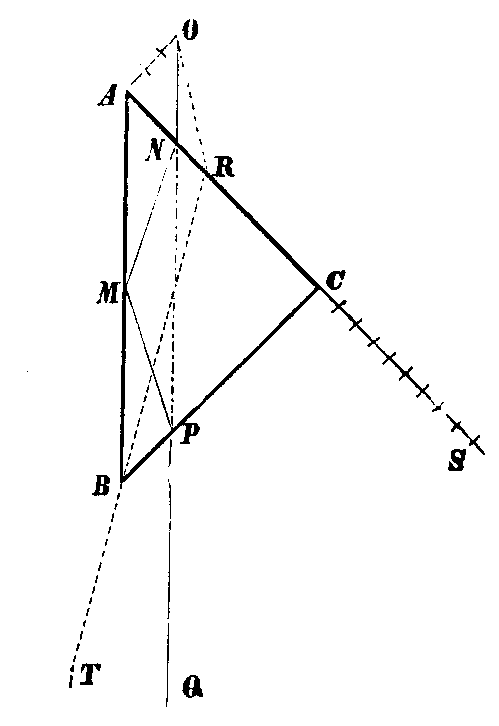
Die Figur 22 macht zugleich das Gesichtsfeld
für das Auge in O ersichtlich. Der Strahl OA (welcher
eben senkrecht auf A C fällt) wird an A B nach A
C reflektiert und geht nach S. Der Strahl O R hingegen
wird bei B reflektiert und tritt gebrochen nach T aus.
Der Apparat erwies sich bei meinen bisherigen Versuchen
in jeder Beziehung als ausreichend. Bringt man ein gedrucktes Blatt nach
gg, und rotiert so rasch, daß dessen Bild ganz verwischt wird,
so kann man die Schrift durch das Okular bequem lesen. Die Umkehrung wegen
der Spiegelung könnte beseitigt werden, wenn man über dem rotierenden
Okularprisma ein zweites festes Reflexionsprisma anbringen würde,
welche Komplikation mir aber unnötig schien.
Bisher habe ich außer einigen physikalischen
Versuchen nur Rotationsversuche mit verschiedenen kleinen Wirbeltieren
(Vögeln, Fischen) angestellt, und meine (in der Schrift über
"Bewegungsempfindungen") angegebenen Daten durchaus bestätigt gefunden.
Es wäre aber wohl auch förderlich, wenn man mit Insekten und
andern, namentlich niederen Tieren (Seetieren) ähnliche Versuche durchführen
würde.
Seither sind solche Versuche, die sich als recht
lehrreich erwiesen haben, von Schäfer (Naturwissenschaftliche
Wochenschrift, No. 25, 1891), von Loeb (Heliotropismus der Tiere,
Würzburg 1890, S. 117) u. a. ausgeführt worden. Was ich gegenwärtig
sonst noch über den Orientierungssinn zu sagen hätte, findet
sich in meinem Vortrag "Über Orientierungsempfindungen" (Schriften
des Vereins zur Verbreitung naturwissenschaftlicher Kenntnisse in Wien,
1897, auch Populärwissenschaftliche Vorlesungen, 3 Aufl., 1903). Insbesondere
möchte ich aber hinweisen auf Breuers Untersuchungen über
die Otolithenapparate, Pollaks und Kreidls Versuche an Taubstummen,
Kreidls Experimente an Krebsen, vor allem aber auf das grundlegende
Werk von Ewald "Über das Endorgan des Nervus octavus", Wiesbaden
1892. Im dritten Bande des "Handbuches der Physiologie des Menschen" 1905
von W. Nagel findet sich eine ausführliche Darstellung der
Lehre von den "Lage-, Bewegungs- und Widerstandsempfindungen". Da ich nun
seit Jahren nicht mehr in der Lage bin, die experimentellen Arbeiten auf
diesem Gebiete genau zu verfolgen, habe ich Herrn Professor Dr. Josef
Pollak gebeten, hier dasjenige aus den neuesten Arbeiten hervorzuheben,
was für die Leser dieses Buches von Interesse sein möchte. Diesem
Wunsche hat Professor Pollak in den nun folgenden Paragraphen 14–19
freundlichst entsprochen.
14.
Die Resultate der im Verlaufe der letzten 10 Jahre gemachten morphologischen,
vergleichend- und experimentell-physiologischen Untersuchungen über
das Ohrlabyrinth (Schnecke, Bogengang- und Otolithenapparat) sprechen fast
ausnahmslos zu Gunsten der Mach - Breuerschen Hypothese.
Als erwiesen kann angenommen werden, daß als
Gehörorgan einzig und allein die Schnecke anzusehen sei und daß
der Vestibularapparat keinerlei akustische Funktionen hat. Einen vollgültigen
Beweis hiefür hat Biehl34)
erbracht, dem es gelang, an Schafen durch intrakranielle Durchschneidung
des Vestibularastes des Akustikusstammes mit Schonung des Ramus cochlearis,
Gleichgewichtsstörungen bei erhaltenem Gehör zu beobachten.
36) 1. c.
Das Bogengangsystem hat ferner, wie alle anderen Sinnesorgane, die Eigenschaft, außer den Empfindungen auch Reflexe auszulösen (Breuer, Delage, Nagel). Als reagierende Organe kommen in erster Linie die Augenmuskel in Betracht, die bei Körperdrehungen den Augen Drehungen erteilen.
15.
Daß aber progressiv beschleunigte Bewegung auf die in den Bogengängen
eingeschlossene Lymphe keinen Einfluß ausüben könne, wie
daß für die Perzeption dieser Beschleunigungen und für
die Empfindung der Kopflage besondere Organe im Labyrinth existieren, hat
Mach schon früher vermutungsweise ausgesprochen. — Breuer
gelang es nun, zum mindesten das sehr wahrscheinlich zu machen, daß
diese Funktion dem Otolithenapparate zukomme. Er nimmt an, daß die
Otolithen durch ihre Schwere auf die unter ihnen befindlichen Haarzellen
einen bestimmten Druck ausüben. Jede Kopfneigung muß die Lage
der Säckchen und damit die der Sinnesepithelien ändern. Breuer
zeigt, indem er die Lage der "Gleitrichtungen" der Otolithen bei verschiedenen
Kopfstellungen bestimmt, daß erst durch das Zusammenwirken beider
Säckchen eine eindeutige Angabe über die Kopfstellung möglich
ist. "Es gibt für jede Lage des Kopfes nur eine bestimmte Kombination
von Gravitationsgrößen der Otolithen in den 4 Maculis. Wenn,
wie wir annehmen, die Gravitation der Otolithen empfunden wird, so ist
jede Lage des Kopfes durch eine bestimmte Kombination dieser Empfindungen
charakterisiert." — Bei der geradlinigen Beschleunigung wird jeder Bewegungsstoß
vermöge der Trägheit der Otolithenmasse eine Relativbeschleunigung
derselben in entgegengesetzter Richtung hervorrufen, die den adäquaten
Sinnesreiz vorstellt.
Dieser Teil der Hypothese hat sich heuristisch sehr
bewährt, da er die Grundlage für Untersuchungen an niederen Tieren
geworden ist, bei welchen bloß Otolithen vorkommen, wie er auch bei
höheren Tieren zu einer isolierten experimentellen Prüfung der
Funktionen hingeleitet hat.
Aus der Fülle der in den letzten Jahren an
niederen Tieren gefundenen Tatsachen will ich nur einige prägnante
hervorheben. — Studiert wurden die Ausfallserscheinungen nach Entfernung
der Otolithen, das Verhalten bei Rotationen und die kompensierenden Bewegungen.
— Besonders interessant sind die Versuche von Prentiss37).
Er wiederholte zunächst die berühmten Versuche Kreidls,
häutende Krebse zu zwingen, sich "eiserne" Otolithen einzuführen,
und bestätigte das der Theorie entsprechende Verhalten derselben gegen
Magneten. Es ist ihm aber auch geglückt, Beobachtungen an freischwimmenden
Larven von Hummern anzustellen, welchen die Möglichkeit genommen war,
sich nach der Häutung die Otolithen zu bilden. Er konnte sich überzeugen,
daß sie dieselben Phaenomene boten, wie ausgewachsene Palaemonen,
welchen man die Otolithen entfernt hatte: sie rollen von einer Seite auf
die andere, schwimmen mit der Bauchseite nach oben, lassen sich leichter
als normale Larven in die Rückenlage bringen, und wenn man sie blendet,
so ist der Verlust des Gleichgewichtes noch augenfälliger. — Derselbe
Autor beschreibt auch das Verhalten eines de norma statozystenlosen Krebses,
Virbius zostericula, folgendermaßen: "Er ist keine freischwimmende
Form, sondern heftet sich in den von der Schwerkraft unabhängigen
Positionen an Gräser an. Zwingt man ihn zum Schwimmen, so schwimmt
er in sehr unsicherer Weise, jedoch meist mit dem Rücken nach oben.
Man kann ihn leicht auf den Rücken umdrehen, aus welcher Lage er sich
nur langsam aufzurichten vermag. Seine unsichere Art zu schwimmen erinnert
an die anderer Crustaceen nach Statozystenzerstörung. Nach Schwärzung
der Augen mit Lampenschwarz geht beim Schwimmen jede Orientierung verloren."
39) Ach, Über die Otolithenfunktion und Labyrinthtonus. Pflüger's Arch., Bd. LXXXVI, 1900.
16.
Schon lange bekannt und genügend analysiert sind hingegen die Raddrehung
der Augen bei andauernden Lageveränderungen des Kopfes sowie die nystagmischen
Bewegungen bei der Rotation und bei querer Durchleitung von galvanischen
Strömen durch den Kopf. Die typischen Kopfbewegungen wie die zuckenden
Augenbewegungen, welche sich bei fortgesetzter Drehung des Kopfes oder
bei galvanischer Durchquerung desselben in regelmäßigen Intervallen
wiederholen und die sich auch durch die geschlossenen Augenlider leicht
hindurch fühlen lassen, sind sichere und objektive Zeichen von Schwindel.
— Augen- und Kopfnystagmus fehlt bei Tieren ohne Labyrinth vollständig,
wie Ewald an Tauben, und Breuer an Katzen, denen beiderseits
die N. VIII. durchschnitten wurden, gezeigt haben. Breuer und Kreidl
haben nachgewiesen, daß die Verdrehung der optischen Vertikale, welche
eintritt, wenn man auf einem Karussell fährt oder auf der Eisenbahn
eine Kurve mit starker Krümmung in genügender Geschwindigkeit
passiert, auf einer realen Raddrehung der Augen beruht. Wir verdanken ferner
Breuer (l. c.) den Nachweis, daß einzelne Ampullen auch, u.
zw. isoliert, galvanisch gereizt werden können; sie lösen dann
Kopfbewegung in der Ebene des betreffenden Kanals aus, während die
Folge der diffusen Reizung die nach Breuer sog. galvanotropische
Reaktion ist, bestehend in einer Neigung des Kopfes gegen die Anode hin.
Dies vorausgeschickt, lassen sich die von James40),
Kreidl41) und Pollak42)
an Taubstummen beobachteten Ausfallserscheinungen beim Dreh- resp. galvanischen
Schwindel aus der Mach-Breuerschen Theorie ungezwungen erklären.
Nach Mygind43) fanden sich bei 56
% von 118 anatomisch untersuchten Taubstummen pathologische Veränderungen
des Vestibularapparates. 50–58% der Kreidl'schen taubstummen Versuchspersonen
bekamen keinen Drehschwindel, 21 % derselben, bei denen Kreidl die
Bedingungen des Mach'schen Versuches mit Karussellbewegung einhielt,
unterlagen nicht der bei Normalen unvermeidlichen Täuschung über
die Orientierung zur Vertikalen; dieselben zeigten auch ausnahmslos beim
Rotieren keine reflektorischen Augenbewegungen. Die geringere Prozentzahl
erklärt sich daraus, daß nach Mygind's Statistik die
Bogengänge häufiger erkrankt gefunden wurden, als das Vestibulum.
40) James, Americ. Journ. of otology 1887.
41) A. Kreidl, Beiträge zur Physiologie des Ohrlabyrinths auf Grund
von Versuchen bei Taubstummen. Pflügers Archiv, Bd. LI.
17.
Von den neueren vergleichend-physiologischen Versuchen erscheinen mir die von Dreyfuß45) bemerkenswert. Er hat das Verhalten normaler und labyrinthloser (ein- und doppelseitig operierter) Meerschweinchen auf der Drehscheibe beobachtet, wobei er insbesondere die kompensierenden Bewegungen der Augäpfel und des Kopfes studierte. Er konstatiert einen auffallenden Unterschied im Verhalten des operierten gegenüber dem des gesunden Tieres bei der Drehung. Das doppelseitig labyrinthlose Tier bleibt bei der Drehung ruhig am Platze, zeigt keine Verdrehung der Wirbelsäulelängsachse und keinen Kopf- oder Augennystagmus. Die Drehung kommt ihm nicht zum Bewußtsein. Dies beweist der folgende, von Dreyfuss angestellte Freßversuch. Bringt man vier Meerschweinchen, und zwar ein normales, eines, dem das linke, eines, dem das rechte, und endlich eines, dem beide Labyrinthe zerstört worden sind, auf die Drehscheibe und wartet, bis alle zu fressen beginnen, so hört das normale Tier während der Rotation zu fressen auf, das rechtsseitig operierte frißt bei Rechtsdrehung weiter, hört bei Linksdrehung auf; das linksseitig operierte frißt bei Linksdrehung weiter und hört bei Rechtsdrehung auf; das beiderseitig labyrinthlose frißt bei jeder Drehungsrichtung. — Zu analogen Resultaten kamen Breuer und Kreidl bei vergleichenden Versuchen mit normalen und akustikuslosen Katzen.
Morphologisch und vom teleologischen Standpunkte aus betrachtet, interessant ist die Arbeit Alexander's46) über das statische und das Gehörorgan von Tieren mit kongenital defektem Sehapparat: Maulwurf (Talpa europaea) und Blindmaus (Spalax-typhlus).
19.
Resumiere ich die Resultate der nur in kleiner Auswahl gebrachten Untersuchungen: Die jede Kopfbewegungen für das Gesichtsfeld kompensierenden Augenbewegungen, welche auch bei geschlossenen Augen und von Blinden ausgeführt werden, ihr Fehlen bei vielen Taubstummen und der Augennystagmus bei fortgesetzter Drehung; die Raddrehung der Augen, wenn durch die Zentrifugalkraft die Richtung der Massenbeschleunigung im Körper abgeändert wird; der Drehschwindel und sein Gesetz, sein Fehlen bei vielen Taubstummen, endlich der galvanische Schwindel, der sich beim Menschen ebenso verhält, wie bei Tieren, — so ergeben sich hieraus genügende Beweise für die Mach-Breuer'sche Theorie, wenn auch nicht in Abrede gestellt werden kann, daß noch manche Frage der Lösung harrt. Gegenüber den anderen Hypothesen (Ewald, Cyon) hat sie jedenfalls den Vorzug, daß durch dieselbe die spezifische Disposition für den adaequaten Reiz bei keinem Sinnesorgan so klar verständlich wird, wie bei den Ampullen- und Otolithenapparaten, und daß sich die beiden Sinnesorgane im Labyrinth auch dem Prinzip der spezifischen Sinnesenergien gut einfügen (Nagel). Jedenfalls erweist sich die Bewegungsempfindung als ein durchaus eigenartiges Empfindungsgebiet.
20.
So weit das Referat von Professor Pollak.
Ohne den Tatsachen Gewalt anzutun, welche in meiner
Schrift über Bewegungsempfindungen beschrieben sind, legen die oben
besprochenen Beobachtungen die Möglichkeit nahe, die Auffassung dieser
Tatsachen zu modifizieren, wie wir dies im Folgenden andeuten wollen. Es
bleibt höchst wahrscheinlich, daß ein Organ im Kopfe existiert,
wir wollen es das Endorgan (EO) nennen, welches auf Beschleunigungen
reagiert, und durch dessen Vermittlung wir zur Kenntnis von Bewegungen
gelangen. Mir selbst erscheint die Existenz von Bewegungsempfindungen von
der Natur der Sinnesempfindungen nicht zweifelhaft und ich kann kaum verstehn,
wie jemand, der die fraglichen Versuche an sich selbst wirklich wiederholt
hat, diese Empfindungen leugnen kann. Statt sich aber vorzustellen, daß
das Endorgan besondere Bewegungsempfindungen erregt, welche von diesem
Apparat wie von einem Sinnesorgan ausgehen, könnte man auch annehmen,
daß dasselbe lediglich reflektorisch Innervationen auslöst.
Innervationen können willkürlich und bewußt oder unwillkürlich
und unbewußt sein. Die beiden verschiedenen Organe, von welchen sie
ausgehen, bezeichnen wir mit WI und UI. Beide können
auf den okulomotorischen {OM) und den lokomotorischen Apparat (LM)
übergehen.
Betrachten wir nun das nebenstehende Schema (Fig.
23). Wir leiten im Sinne des glatten Pfeiles willkürlich, also
von WI aus, eine aktive Bewegung ein, welche sich im Sinne der glatten
Pfeile auf OM und LM überträgt. Die zugehörige
Innervation, deren Antezedenz oder Konsequenz empfinden wir unmittelbar.
Eine besondere hiervon verschiedene Bewegungsempfindung wäre also
in diesem Falle unnötig. Ist nun die Bewegung im Sinne des glatten
Pfeiles eine (uns überraschende) passive, so gehen erfahrungsgemäß
von EO über UI Reflexe aus, welche kompensierende Bewegungen
hervorbringen, was wir durch die gefiederten Pfeile andeuten. Beteiligt
sich WI nicht, und gelingt die Kompensation, so fällt hiermit
auch die Bewegung und die Forderung einer Bewegungsempfindung weg. Wird
aber die kompensierende Bewegung von WI aus (absichtlich) unterdrückt,
so ist hierzu wieder dieselbe Innervation, wie bei der aktiven Bewegung
nötig, und sie liefert auch wieder die gleiche Bewegungsempfindung.
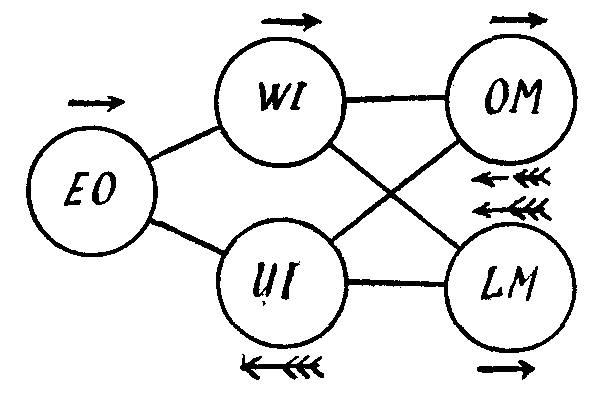
Das Organ EO ist also zu WI und UI so gestimmt, daß in den beiden letzteren mit demselben Bewegungsreiz des ersteren entgegengesetzte Innervationen zusammentreffen. Außerdem haben wir aber noch folgende Verschiedenheit in der Beziehung von EO zu WI und UI zu bemerken. Für EO ist der Bewegungsreiz natürlich derselbe, ob die eingeleitete Bewegung eine passive oder aktive ist. Auch bei einer aktiven Bewegung würden die von WI ausgehenden Innervationen in ihrem Erfolg durch EO und UI aufgehoben, wenn nicht zugleich von WI mit der willkürlichen Innervation eine Hemmung nach EO oder UI ausginge. Den Einfluß von EO auf WI haben wir uns viel schwächer vorzustellen, als jenen auf UI. Denken wir uns etwa drei Tiere WI, U I und EO, welche die Arbeit so geteilt hätten, daß das erste nur Angriffs-, das zweite nur Abwehr- oder Fluchtbewegungen ausführte, während das dritte als Wächter aufgestellt wäre, mit einander zu einem neuen Wesen verbunden, wobei WI eine dominierende Stellung einnähme, so würde dies ungefähr dem dargestellten Verhältnis entsprechen. Es wird sich auch manches zu gunsten einer derartigen Auffassung der höheren Tiere anführen lassen47).
Aus den Erörterungen des vorigen Kapitels über Symmetrie und
Ähnlichkeit können wir ohne weiteres den Schluß ziehen,
daß gleichen Richtungen gesehener Linien gleichartige Innervationen,
zur Medianebene symmetrischen Linien sehr ähnliche Innervationen,
dem Blick nach oben und unten, in die Ferne und in die Nähe aber sehr
verschiedene Innervationen entsprechen, was nach den Symmetrieverhältnissen
des motorischen Apparates der Augen größtenteils auch von vornherein
zu erwarten ist. Hiermit allein ist schon eine ganze Reihe eigentümlicher
physiologisch-optischer Phänomene aufgeklärt, die bisher kaum
beachtet worden sind. Ich komme nun aber zu dem, nach physikalischer Schätzung
wenigstens, wichtigsten Punkt.
Der Raum des Geometers ist ein Vorstellungsgebilde
von dreifacher Mannigfaltigkeit, welches sich auf Grundlage von manuellen
und intellektuellen Operationen entwickelt hat. Der optische Raum (Herings
Sehraum) steht in einer ziemlich komplizierten geometrischen Verwandtschaft
zu dem vorigen. Man kann mit Hilfe bekannter Ausdrücke die Sache noch
am besten darstellen, wenn man sagt, daß der optische Raum den geometrischen
(Euklidischen) in einer Art Reliefperspektive abbilde, was sich teleologisch
auch erklären läßt. Jedenfalls ist aber auch der optische
Raum eine dreifache Mannigfaltigkeit. Der Raum des Geometers zeigt in jedem
Punkte und nach allen Richtungen dieselben Eigenschaften, was vom physiologischen
Raum durchaus nicht gilt. Der Einfluß des physiologischen Raumes
ist aber in der Geometrie noch vielfach zu bemerken. Wenn wir z. B. konvexe
und konkave Krümmung unterscheiden, so ist dies ein solcher Fall.
Der Geometer sollte eigentlich nur die Abweichung vom Mittel der Ordinaten
kennen.
22.
So lange man sich vorstellt, daß die (12) Augenmuskel einzeln innerviert werden, ist man nicht imstande, die fundamentale Tatsache zu verstehen, daß der optische Raum als dreifache Mannigfaltigkeit sich darstellt. Ich habe diese Schwierigkeit jahrelang gefühlt und auch die Richtung erkannt, in welcher nach dem Prinzip des Parallelismus des Physischen und Psychischen die Aufklärung zu suchen ist; die Auflösung selbst blieb mir wegen mangelhafter Erfahrung auf diesem Gebiete verborgen. Desto besser weiß ich Herings Verdienst zu schätzen, der dieselbe gefunden hat. Den drei optischen Raumkoordinaten, Höhen, Breiten- und Tiefenempfindung (Hering, Beiträge zur Physiologie. Leipzig, Engelmann, 1861–65) entspricht nämlich nach den Ausführungen desselben Forschers (Die Lehre vom binokularen Sehen. Leipzig, Engelmann, 1868) auch nur eine dreifache Innervation, welche beziehungsweise Rechts- oder Linkswendung, Erhebung oder Senkung und Konvergenz der Augen hervorruft. Darin liegt für mich die wichtigste und wesentlichste Aufklärung49). Ob man nun die Innervation selbst für die Raumempfindung hält, oder sich vor oder hinter derselben erst die Raumempfindung vorstellt, was sofort zu entscheiden weder leicht noch notwendig sein dürfte, jedenfalls wirft die Heringsche Darlegung ein ausgiebiges Licht in die psychische Tiefe des Sehprozesses. Auch die in bezug auf Symmetrie und Ähnlichkeit von mir angeführten Erscheinungen fügen sich dieser Auffassung sehr gut, was weiter darzulegen wohl unnötig ist50).
49) Dies ist der Punkt, auf welchen oben (S. 101 Anmerkung l und S. 114) hingewiesen wurde.