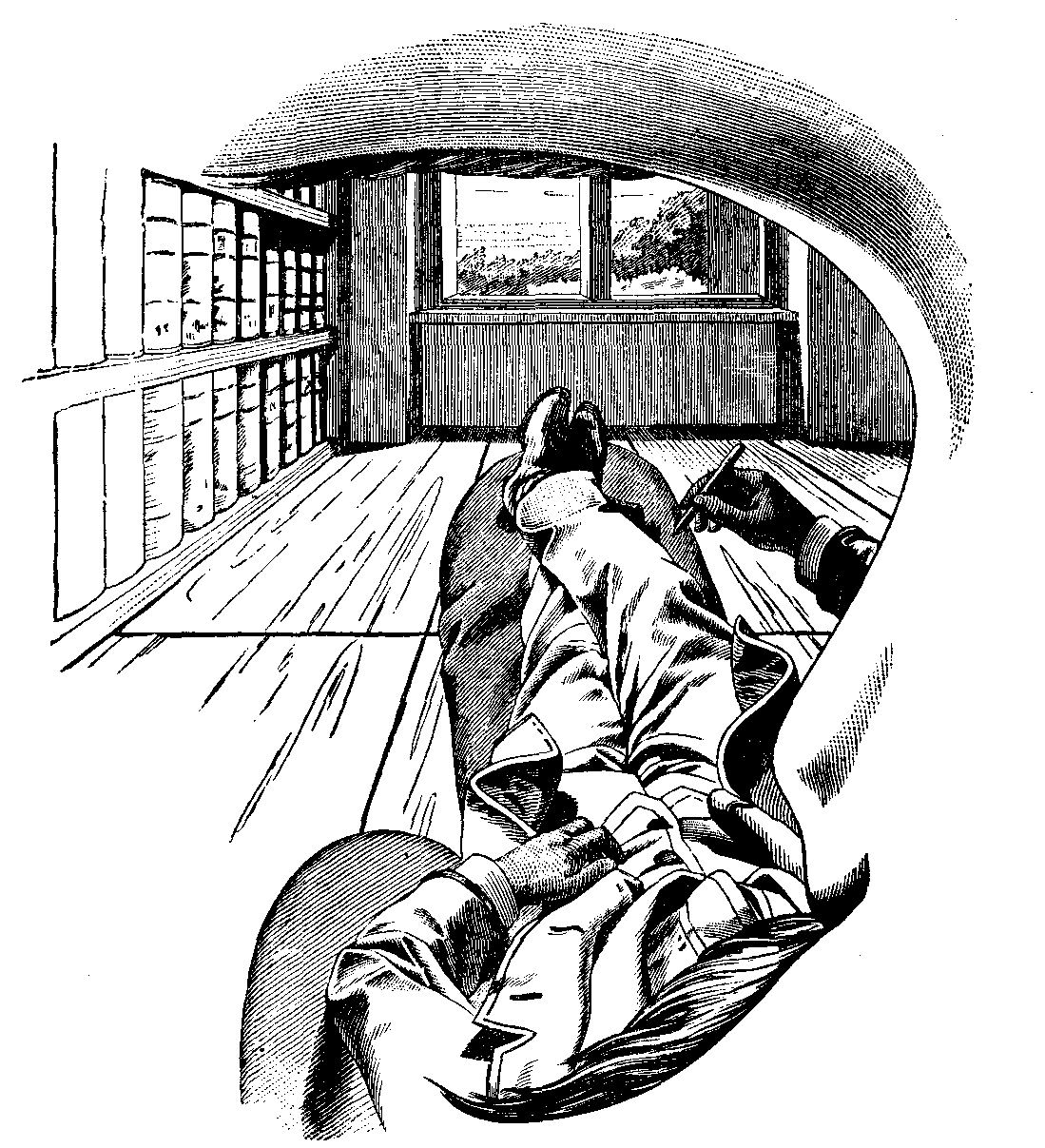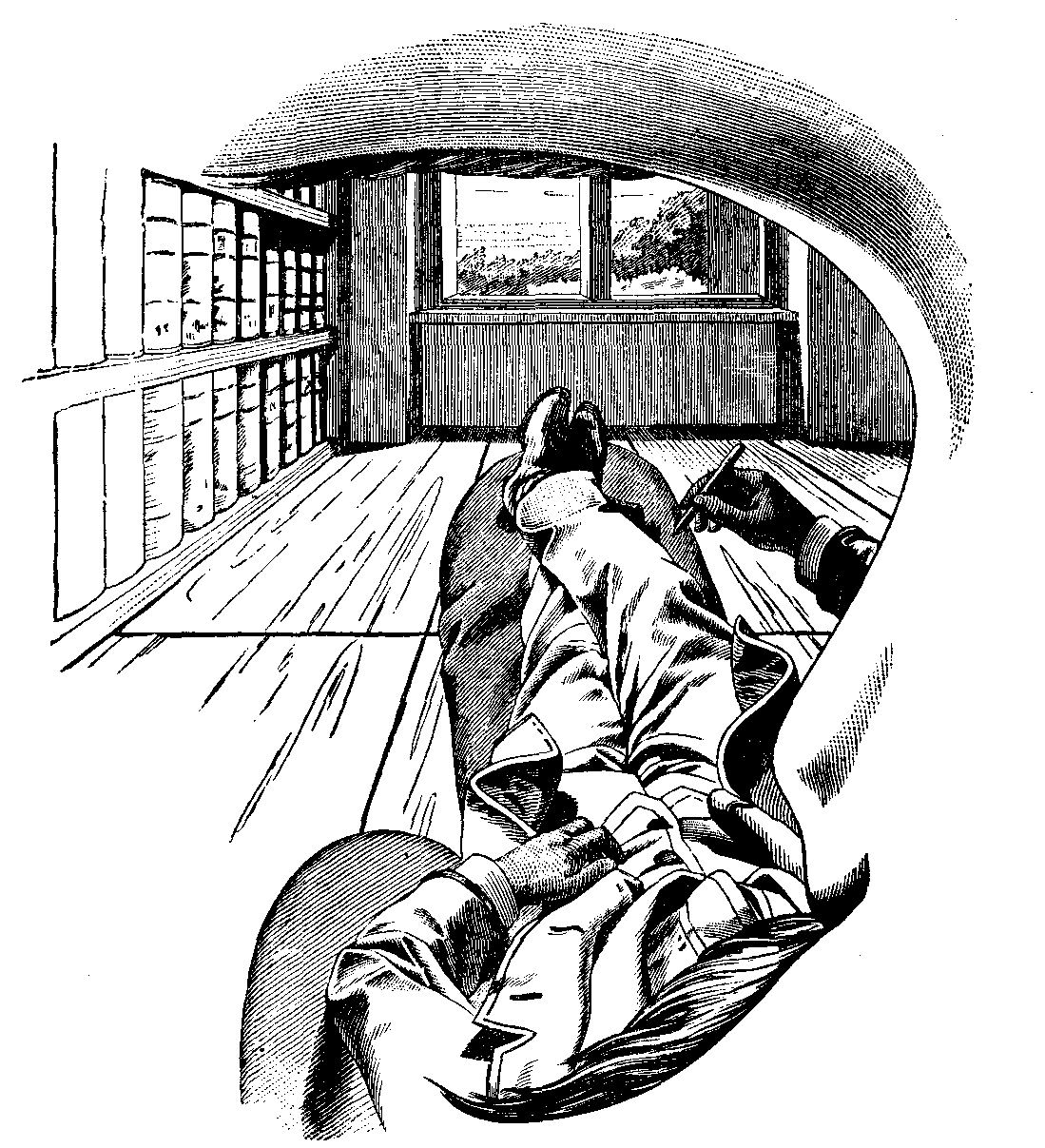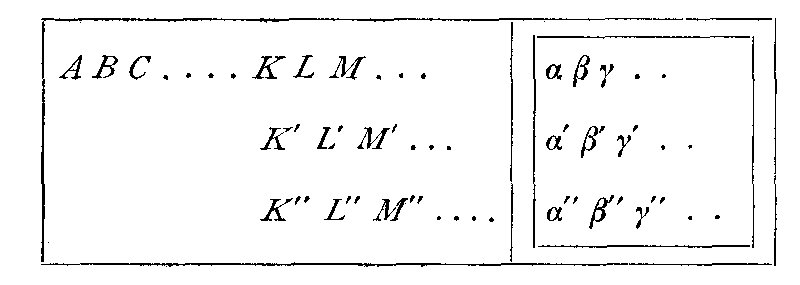I. Antimetaphysische Vorbemerkungen.
1.
Die großen Erfolge, welche die physikalische Forschung in den
verflossenen Jahrhunderten nicht nur auf eigenem Gebiet, sondern auch durch
Hilfeleistung in dem Bereiche anderer Wissenschaften, errungen hat, bringen
es mit sich, daß physikalische Anschauungen und Methoden überall
in den Vordergrund treten, und daß an die Anwendung derselben die
höchsten Erwartungen geknüpft werden. Dem entsprechend hat auch
die Physiologie der Sinne, die von Männern wie Goethe, Schopenhauer
u. A., mit größtem Erfolge aber von Johannes Müller
eingeschlagene Methode, die Empfindungen an sich zu untersuchen, allmählich
verlassend, fast ausschließlich einen physikalischen Charakter angenommen.
Diese Wendung muß uns als eine nicht ganz zweckentsprechende erscheinen,
wenn wir bedenken, daß die Physik trotz ihrer bedeutenden Entwicklung
doch nur ein Teil eines größeren Gesamtwissens ist, und mit
ihren für einseitige Zwecke geschaffenen einseitigen intellektuellen
Mitteln diesen Stoff nicht zu erschöpfen vermag. Ohne auf die Unterstützung
der Physik zu verzichten, kann die Physiologie der Sinne nicht nur ihre
eigentümliche Entwicklung fortsetzen, sondern auch der Physik selbst
noch kräftige Hilfe leisten. Folgende einfache Betrachtung mag dazu
dienen, dies Verhältnis klarzulegen.
2.
Farben, Töne, Wärmen, Drücke, Räume, Zeiten u.s.w.
sind in mannigfaltiger Weise miteinander verknüpft, und an dieselben
sind Stimmungen, Gefühle und Willen gebunden. Aus diesem Gewebe tritt
das relativ Festere und Beständigere hervor, es prägt sich dem
Gedächtnisse ein, und drückt sich in der Sprache aus. Als relativ
beständiger zeigen sich zunächst räumlich und zeitlich (funktional)
verknüpfte Komplexe von Farben, Tönen, Drücken u.s.w., die
deshalb besondere Namen erhalten, und als Körper bezeichnet werden.
Absolut beständig sind solche Komplexe keineswegs.
Mein Tisch ist bald heller, bald dunkler beleuchtet,
kann wärmer und kälter sein. Er kann einen Tintenfleck erhalten.
Ein Fuß kann brechen. Er kann repariert, poliert, Teil für Teil
ersetzt werden. Er bleibt für mich doch der Tisch, an dem ich täglich
schreibe.
Mein Freund kann einen anderen Rock anziehen. Sein
Gesicht kann ernst und heiter werden. Seine Gesichtsfarbe kann durch Beleuchtung
oder Affekte sich ändern. Seine Gestalt kann durch Bewegung oder dauernd
alteriert werden. Die Summe des Beständigen bleibt aber den allmählichen
Veränderungen gegenüber doch immer so groß, daß diese
zurücktreten. Es ist derselbe Freund, mit dem ich täglich meinen
Spaziergang mache.
Mein Rock kann einen Fleck, ein Loch erhalten. Schon
der Ausdruck zeigt, daß es auf eine Summe von Beständigem ankommt,
welchem das Neue hinzugefügt, von welchem das Fehlende nachträglich
in Abzug gebracht wird.
Die größere Geläufigkeit, das Übergewicht
des mir wichtigen Beständigen gegenüber dem Veränderlichen
drängt zu der teils instinktiven, teils willkürlichen und bewußten
Ökonomie des Vorstellens und der Bezeichnung, welche sich in dem gewöhnlichen
Denken und Sprechen äußert. Was auf einmal vorgestellt wird,
erhält eine Bezeichnung, einen Namen.
Als relativ beständig zeigt sich ferner der
an einen besonderen Körper (den Leib) gebundene Komplex von Erinnerungen,
Stimmungen, Gefühlen, welcher als Ich bezeichnet wird. Ich
kann mit diesem oder jenem Ding beschäftigt, ruhig und heiter oder
aufgebracht und verstimmt sein. Doch bleibt (pathologische Fälle abgerechnet)
genug Beständiges übrig, um das Ich als dasselbe anzuerkennen.
Allerdings ist auch das Ich nur von relativer Beständigkeit. Die scheinbare
Beständigkeit des Ich besteht vorzüglich nur in der Kontinuität,
in der langsamen Änderung. Die vielen Gedanken und Pläne von
gestern, welche heute fortgesetzt werden, an welche die Umgebung im Wachen
fortwährend erinnert (daher das Ich im Traume sehr verschwommen, verdoppelt
sein, oder ganz fehlen kann), die kleinen Gewohnheiten, die sich unbewußt
und unwillkürlich längere Zeit erhalten, machen den Grundstock
des Ich aus. Größere Verschiedenheiten im Ich verschiedener
Menschen, als im Laufe der Jahre in einem Menschen eintreten, kann es kaum
geben. Wenn ich mich heute meiner frühen Jugend erinnere, so müßte
ich den Knaben (einzelne wenige Punkte abgerechnet) für einen Andern
halten, wenn nicht die Kette der Erinnerungen vorläge. Schon manche
Schrift, die ich selbst vor 20 Jahren verfaßt, macht mir einen höchst
fremden Eindruck. Die sehr allmähliche Änderung des Leibes trägt
wohl auch zur Beständigkeit des Ich bei, aber viel weniger als man
glaubt. Diese Dinge werden noch viel weniger analysiert und beachtet als
das intellektuelle und das moralische Ich. Man kennt sich persönlich
sehr schlecht1). Als ich diese Zeilen schrieb (1886), war mir
Ribot's schönes Buch "Les maladies de la personnalité",
in welcher dieser die Wichtigkeit der Gemeingefühle für die Konstitution
des Ich hervorhebt, noch nicht bekannt. Ich kann seiner Ansicht nur zustimmen2).
1) Als junger Mensch erblickte ich einmal auf der Straße
ein mir höchst unangenehmes widerwärtiges Gesicht im Profil.
Ich erschrak nicht wenig, als ich erkannte, dass es mein eigenes sei, welches
ich an einer Spiegelniederlage vorbeigehend durch zwei gegen einander geneigte
Spiegel wahrgenommen hatte. — Ich stieg einmal nach einer anstrengenden
nächtlichen Eisenbahnfahrt sehr ermüdet in einen Omnibus, eben
als von der anderen Seite auch ein Mann hereinkam. "Was steigt doch da
für ein herabgekommener Schulmeister ein", dachte ich. Ich war es
selbst, denn mir gegenüber befand sich ein großer Spiegel. Der
Klassenhabitus war mir also viel geläufiger, als mein Spezialhabitus.
2) Vgl. Hume, Treatise on human nature, Vol. I, P. IV,
S. 6. — Fr. u. P. Gruithuisen, Beiträge zur Physiognosie und Eautognosie,
München, 1812, S. 37—58.
Das Ich ist so wenig absolut beständig als die
Körper. Was wir am Tode so sehr fürchten, die Vernichtung der
Beständigkeit, das tritt im Leben schon in reichlichem Maße
ein. Was uns das Wertvollste ist, bleibt in unzähligen Exemplaren
erhalten, oder erhält sich bei hervorragender Besonderheit in der
Regel von selbst. Im besten Menschen liegen aber individuelle Züge,
um die er und andere nicht zu trauern brauchen. Ja zeitweilig kann der
Tod, als Befreiung von der Individualität, sogar ein angenehmer Gedanke
sein. Das physiologische Sterben wird durch solche Überlegungen natürlich
nicht erleichtert.
Ist die erste Orientierung durch Bildung der Substanzbegriffe
"Körper", "Ich" (Materie, Seele) erfolgt, so drängt der Wille
zur genaueren Beachtung der Veränderungen an diesem relativ Beständigen.
Das Veränderliche an den Körpern und am Ich ist es eben, was
den Willen3) bewegt. Erst jetzt treten die Bestandteile des
Komplexes als Eigenschaften desselben hervor. Eine Frucht ist süß,
sie kann aber auch bitter sein. Auch andere Früchte können süß
sein. Die gesuchte rote Farbe kommt an vielen Körpern vor. Die Nähe
mancher Körper ist angenehm, jene anderer unangenehm. So erscheinen
nach und nach verschiedene Komplexe aus gemeinsamen Bestandteilen zusammengesetzt.
Von den Körpern trennt sich das Sichtbare, Hörbare, Tastbare
ab. Das Sichtbare löst sich in Farbe und Gestalt. In der Mannigfaltigkeit
der Farben treten wieder einige Bestandteile in geringerer Zahl hervor,
die Grundfarben u.s.w. Die Komplexe zerfallen in Elemente4),
d. h. in letzte Bestandteile, die wir bisher nicht weiter zerlegen konnten.
Die Natur dieser Elemente bleibe dahin gestellt; dieselbe kann durch künftige
Untersuchungen weiter aufgeklärt werden. Daß der Naturforscher
nicht die direkten Beziehungen dieser Elemente, sondern Relationen von
Relationen derselben leichter verfolgt, braucht uns hier nicht zu stören.
3) Nicht in metaphysischem Sinne zu nehmen.
4) Faßt man diesen Vorgang auch als Abstraktion
auf, so verlieren doch hierdurch die Elemente, wie wir sehen werden, nichts
von ihrer Bedeutung. Vgl. die späteren Ausführungen über
den Begriff im vorletzten Kapitel.
3.
Die zweckmäßige Gewohnheit, das Beständige mit einem
Namen zu bezeichnen und ohne jedesmalige Analyse der Bestandteile in einen
Gedanken zusammenzufassen, kann mit dem Bestreben, die Bestandteile zu
sondern, in einen eigentümlichen Widerstreit geraten. Das dunkle Bild
des Beständigen, welches sich nicht merklich ändert, wenn ein
oder der andere Bestandteil ausfällt, scheint etwas für sich
zu sein. Weil man jeden Bestandteil einzeln wegnehmen kann, ohne daß
dies Bild aufhört, die Gesamtheit zu repräsentieren und wieder
erkannt zu werden, meint man, man könnte alle wegnehmen und es bliebe
noch etwas übrig. So entsteht in natürlicher Weise der anfangs
imponierende, später aber als ungeheuerlich erkannte philosophische
Gedanke eines (von seiner "Erscheinung" verschiedenen unerkennbaren) Dinges
an sich5).
5) Vgl. W. Schuppes Polemik gegen Überweg. Abgedr.
in Brasch, Welt- und Lebensanschauung Überwegs, Leipzig, 1889. — F.
J. Schmidt, Das Ärgernis der Philosophie. Eine Kantstudie. Berlin
1897.
Das Ding, der Körper, die Materie ist nichts außer
dem Zusammenhang der Elemente, der Farben, Töne u.s.w., außer
den sogenannten Merkmalen. Das vielgestaltige vermeintliche philosophische
Problem von dem einen Ding mit seinen vielen Merkmalen entsteht durch das
Verkennen des Umstandes, daß übersichtliches Zusammenfassen
und sorgfältiges Trennen, obwohl beide temporär berechtigt und
zu verschiedenen Zwecken ersprießlich, nicht auf einmal geübt
werden können. Der Körper ist einer und unveränderlich,
so lange wir nicht nötig haben, auf Einzelheiten zu achten. So ist
auch die Erde oder ein Billardballen eine Kugel, sobald wir von allen Abweichungen
von der Kugelgestalt absehen wollen, und größere Genauigkeit
unnötig ist. Werden wir aber dazu gedrängt, Orographie oder Mikroskopie
zu treiben, so hören beide Körper auf, Kugeln zu sein.
4.
Der Mensch hat vorzugsweise die Fähigkeit, sich seinen Standpunkt
willkürlich und bewußt zu bestimmen. Er kann jetzt von den imposantesten
Einzelheiten absehen, und sofort wieder die geringste Kleinigkeit beachten,
jetzt die stationäre Strömung ohne Rücksicht auf den Inhalt
(ob Wärme, Elektrizität oder Flüssigkeit) betrachten, und
dann die Breite einer Fraunhoferschen Linie im Spektrum schätzen;
er kann nach Gutdünken zu den allgemeinsten Abstraktionen sich erheben,
oder ins Einzelnste sich vertiefen. Das Tier besitzt diese Fähigkeit
in viel geringerem Grade. Es stellt sich nicht auf einen Standpunkt, es
wird meist durch die Eindrücke auf denselben gestellt. Der Säugling,
welcher den Vater mit dem Hut nicht erkennt, der Hund, der durch den neuen
Rock des Herrn irre wird, unterliegen im Widerstreit der Standpunkte. Wer
wäre nie in einem ähnlichen Falle unterlegen? Auch der philosophierende
Mensch kann gelegentlich unterliegen, wie das angeführte wunderliche
Problem lehrt. Besondere Umstände scheinen noch für die Berechtigung
des erwähnten Problems zu sprechen. Farben, Töne, Düfte
der Körper sind flüchtig. Es bleibt als beharrlicher, nicht leicht
verschwindender Kern das Tastbare zurück, welches als Träger
der daran gebundenen flüchtigeren Eigenschaften erscheint. Die Gewohnheit
hält nun den Gedanken an einen solchen Kern fest, auch wenn sich schon
die Erkenntnis Bahn gebrochen hat, daß Sehen, Hören, Riechen
und Tasten durchaus verwandt sind. Hierzu kommt noch, daß dem Räumlichen
und Zeitlichen infolge der eigentümlichen großen Entwicklung
der mechanischen Physik eine Art höherer Realität gegenüber
den Farben, Tönen, Düften zugeschrieben wird. Dem entsprechend
erscheint das zeitliche und räumliche Band von Farben, Tönen,
Düften realer als diese selbst. Die Physiologie der Sinne legt aber
klar, daß Räume und Zeiten ebenso gut Empfindungen genannt werden
können, als Farben und Töne. Hiervon später.
5.
Auch das Ich, sowie das Verhältnis der Körper zum Ich, gibt
Anlaß zum Auftreten analoger Scheinprobleme, deren Kern im folgenden
kurz angegeben werden soll. Die zuvor statuierten Elemente wollen wir durch
die Buchstaben A B C ... K L M ... a b
g... andeuten. Die Komplexe von Farben, Tönen
u.s.w., welche man gewöhnlich Körper nennt, bezeichnen wir der
Deutlichkeit wegen mit A B C ...; den Komplex, der unser Leib heißt,
und der ein durch Besonderheiten ausgezeichneter Teil der ersteren ist,
nennen wir K L M ... ; den Komplex von Willen, Erinnerungsbildern u.s.w.
stellen wir durch a, b,
g, . . . dar. Gewöhnlich wird nun
der Komplex a b g...
K L M ... als Ich dem Komplex A B C ... als Körperwelt gegenübergestellt;
zuweilen wird auch a b
g ... als Ich, K L M ... A B C ... als Körperwelt
zusammengefaßt. Zunächst erscheint A B C ... als unabhängig
vom Ich und diesem selbständig gegenüber stehend. Diese Unabhängigkeit
ist nur relativ, und hält vor gesteigerter Aufmerksamkeit nicht stand.
In dem Komplex a b
g ... kann sich allerdings manches ändern,
ohne daß an A B C ... viel bemerklich wird, ebenso umgekehrt. Viele
Änderungen in a b
g... gehen aber durch Änderungen in K L
M ... nach A B C ... über und umgekehrt. (Wenn z. B. lebhafte Vorstellungen
in Handlungen ausbrechen, oder die Umgebung in unserm Leib merkliche Änderungen
veranlaßt.) Hierbei scheint K L M ... mit a
b g... und auch mit
A B C ... stärker zusammenzuhängen, als letztere untereinander.
Diese Verhältnisse finden eben in dem gewöhnlichen Denken und
Sprechen ihren Ausdruck.
Genau genommen, zeigt sich aber, daß A B C
..., immer durch K L M ... mitbestimmt ist. Ein Würfel wird, wenn
er nahe, groß, wenn er fern, klein, mit dem rechten Auge anders als
mit dem linken, gelegentlich doppelt, bei geschlossenen Augen gar nicht
gesehen. Die Eigenschaften eines und desselben Körpers erscheinen
also durch den Leib modifiziert, sie erscheinen durch denselben bedingt.
Wo ist denn aber derselbe Körper, der so verschieden erscheint? Alles,
was man sagen kann, ist, daß verschiedene A B C ... an verschiedene
K L M gebunden sind6).
6) Ich habe diesem Gedanken vor langer Zeit (Vierteljahrsschrift
für Psychiatrie, Leipzig und Neuwied 1868 Über die Abhängigkeit
der Netzhautstellen von einander") in folgender Weise Ausdruck gegeben:
"Der Ausdruck "Sinnestäuschung" beweist, daß man sich noch nicht
recht zum Bewußtsein gebracht, oder wenigstens noch nicht nötig
gefunden hat, dies Bewußtsein auch in der Terminologie zu bekunden,
daß die Sinne weder falsch noch richtig zeigen. Das einzig Richtige,
was man von den Sinnesorganen sagen kann, ist, daß sie unter verschiedenen
Umständen verschiedene Empfindungen und Wahrnehmungen auslösen.
Weil diese "Umstände" so äußerst mannigfaltiger Art, teils
äußere (in den Objekten gelegene), teils innere (in den Sinnesorganen
sitzende), teils innerste (in den Zentralorganen tätige) sind, kann
es allerdings den Anschein haben, wenn man nur auf die äußern
Umstände Acht hat, daß das Organ ungleich unter gleichen Umständen
wirkt. Die ungewöhnlichen Wirkungen pflegt man nun Täuschungen
zu nennen."
Man pflegt in der populären Denk- und Redeweise
der Wirklichkeit den Schein gegenüber zu stellen. Einen Bleistift,
den wir in der Luft vor uns halten, sehen wir gerade; tauchen wir denselben
schief ins Wasser, so sehen wir ihn geknickt Man sagt nun in letzterem
Falle: Der Bleistift scheint geknickt, ist aber in Wirklichkeit gerade.
Was berechtigt uns aber, eine Tatsache der andern gegenüber für
Wirklichkeit zu erklären und die andere zum Schein herabzudrücken?
In beiden Fällen liegen doch Tatsachen vor, welche eben verschieden
bedingte, verschiedenartige Zusammenhänge der Elemente darstellen.
Der eingetauchte Bleistift ist eben wegen seiner Umgebung optisch geknickt,
haptisch und metrisch aber gerade. Das Bild im Hohl- oder Planspiegel ist
nur sichtbar, während unter andern (gewöhnlichen) Umständen
dem sichtbaren Bild auch ein tastbarer Körper entspricht. Eine helle
Fläche ist neben einer dunklen heller als neben einer noch helleren.
Unsere Erwartung wird allerdings getäuscht, wenn wir verschiedene
Fälle des Zusammenhanges, auf die Bedingungen nicht genau achtend,
mit einander verwechseln, den natürlichen Fehler begehen, in ungewöhnlichen
Fällen dennoch das Gewöhnliche zu erwarten. Die Tatsachen sind
daran unschuldig. Es hat nur einen praktischen, aber keinen wissenschaftlichen
Sinn, in diesen Fällen von Schein zu sprechen. Ebenso hat die oft
gestellte Frage, ob die Welt wirklich ist oder ob wir sie bloß träumen,
gar keinen wissenschaftlichen Sinn. Auch der wüsteste Traum ist eine
Tatsache, so gut als jede andere. Wären unsere Träume regelmäßiger,
zusammenhängender, stabiler, so wären sie für uns auch praktisch
wichtiger. Beim Erwachen bereichern sich die Beziehungen der Elemente gegenüber
jenen des Traumes. Wir erkennen den Traum als solchen. Bei dem umgekehrten
Prozeß verengert sich das psychische Gesichtsfeld; es fehlt der Gegensatz
meist vollständig. Wo kein Gegensatz besteht, ist die Unterscheidung
von Traum und Wachen, Schein und Wirklichkeit ganz müßig und
wertlos.
Der populäre Gedanke eines Gegensatzes von
Schein und Wirklichkeit hat auf das wissenschaftlich-philosophische Denken
sehr anregend gewirkt. Dies zeigt sich z. B. in Platons geistreicher
und poetischer Fiktion der Höhle, in der wir, mit dem Rücken
gegen das Feuer gekehrt, bloß die Schatten der Vorgänge beobachten
(Staat, VII, I). Indem aber dieser Gedanke nicht ganz zu Ende gedacht wurde,
hat derselbe auf unsere Weltanschauung einen ungebührlichen Einfluß
genommen. Die Welt, von der wir doch ein Stück sind, kam uns ganz
abhanden, und wurde uns in unabsehbare Ferne gerückt. So glaubt auch
mancher Jüngling, der zum erstenmal von der astronomischen Strahlenbrechung
hört, die ganze Astronomie sei nun in Frage gestellt, während
doch durch eine leicht zu ermittelnde und unbedeutende Korrektur alles
wieder berichtigt wird.
6.
Wir sehen einen Körper mit einer Spitze S. Wenn wir S
berühren, zu unserm Leib in Beziehung bringen, erhalten wir einen
Stich. Wir können S sehen, ohne den Stich zu fühlen. Sobald
wir aber den Stich fühlen, werden wir S an der Haut finden.
Es ist also die sichtbare Spitze ein bleibender Kern, an den sich der Stich
nach Umständen wie etwas Zufälliges anschließt. Bei der
Häufigkeit analoger Vorkommnisse gewöhnt man sich endlich, alle
Eigenschaften der Körper als von bleibenden Kernen ausgehende, durch
Vermittlung des Leibes dem Ich beigebrachte "Wirkungen", die wir Empfindungen
nennen, anzusehen. Hiermit verlieren aber diese Kerne den ganzen sinnlichen
Inhalt, werden zu bloßen Gedankensymbolen. Es ist dann richtig, daß
die Welt nur aus unsern Empfindungen besteht. Wir wissen aber dann eben
nur von den Empfindungen, und die Annahme jener Kerne, sowie einer Wechselwirkung
derselben, aus welcher erst die Empfindungen hervorgehoben würden,
erweist sich als gänzlich müßig und überflüssig.
Nur dem halben Realismus oder dem halben Kriticismus kann eine solche Ansicht
zusagen.
7.
Gewöhnlich wird der Komplex ab
g... K L M ... als Ich dem Komplex A B C
... gegenübergestellt. Nur jene Elemente von A B C ..., welche ab
g... stärker alterieren, wie einen
Stich, einen Schmerz pflegt man bald mit dem Ich zusammenzufassen. Später
zeigt sich aber durch Bemerkungen der oben angeführten Art, daß
das Recht, A B C ... zum Ich zu zählen, nirgends aufhört. Dem
entsprechend kann das Ich so erweitert werden, daß es schließlich
die ganze Welt umfaßt7). Das Ich ist nicht scharf abgegrenzt,
die Grenze ist ziemlich unbestimmt und willkürlich verschiebbar. Nur
indem man dies verkennt, die Grenze unbewußt enger und zugleich auch
weiter zieht, entstehen im Widerstreit der Standpunkte die metaphysischen
Schwierigkeiten.
7) Wenn ich sage, der Tisch, der Baum u. s. w. sind
meine Empfindungen, so liegt
darin, der Vorstellung des gemeinen Mannes gegenüber, eine wirkliche
Erweiterung des Ich. Aber auch nach der Gefühlsseite ergibt sich eine
solche Erweiterung für den Virtuosen, der sein Instrument fast so
gut beherrscht als seinen Leib, für den gewandten Redner, in dem alle
Augenaxen convergieren, und der die Gedanken seiner Zuhörer leitet,
für den kräftigen Politiker, der seine Partei mit Leichtigkeit
führt, u. s. w. — In Depressionszuständen hingegen, wie sie nervöse
Menschen zeitweilig zu ertragen haben, schrumpft das Ich zusammen. Eine
Wand scheint es von der Welt zu trennen.
Sobald wir erkannt haben, daß die vermeintlichen
Einheiten "Körper", "Ich" nur Notbehelfe zur vorläufigen Orientierung
und für bestimmte praktische Zwecke sind (um die Körper zu ergreifen,
um sich vor Schmerz zu wahren u.s.w.), müssen wir sie bei vielen weitergehenden
wissenschaftlichen Untersuchungen als unzureichend und unzutreffend aufgeben.
Der Gegensatz zwischen Ich und Welt, Empfindung oder Erscheinung und Ding
fällt dann weg, und es handelt sich lediglich um den Zusammenhang
der Elemente ab g
... A B C ... K L M ..., für welchen eben dieser Gegensatz
nur ein teilweise zutreffender unvollständiger Ausdruck war. Dieser
Zusammenhang ist nichts weiter als die Verknüpfung jener Elemente
mit andern gleichartigen Elementen (Zeit und Raum). Die Wissenschaft hat
ihn zunächst einfach anzuerkennen, und sich in demselben zu orientieren,
anstatt die Existenz desselben sofort erklären zu wollen.
Bei oberflächlicher Betrachtung scheint der
Komplex ab g
... aus viel flüchtigeren Elementen zu bestehen, als A
B C ... und K L M ..., in welchen letzteren die Elemente stabiler und in
mehr beständiger Weise (an feste Kerne) geknüpft zu sein scheinen.
Obgleich bei weiterem Zusehen die Elemente aller Komplexe sich als gleichartig
erweisen, so schleicht sich doch auch nach dieser Erkenntnis die ältere
Vorstellung eines Gegensatzes von Körper und Geist leicht wieder ein.
Der Spiritualist fühlt wohl gelegentlich die Schwierigkeit, seiner
vom Geist geschaffenen Körperwelt die nötige Festigkeit zu geben,
dem Materialisten wird es sonderbar zu Mut, wenn er die Körperwelt
mit Empfindung beleben soll. Der durch Überlegung erworbene monistische
Standpunkt wird durch die älteren stärkeren instinktiven Vorstellungen
leicht wieder getrübt.
8.
Die bezeichnete Schwierigkeit wird besonders bei folgender Überlegung
empfunden. In dem Komplex A B C ..., den wir als Körperwelt bezeichnet
haben, finden wir als Teil nicht nur unsern Leib K L M ..., sondern auch
die Leiber anderer Menschen (oder Tiere) K' L' M' ..., K" L" M" ..., an
welche wir nach der Analogie dem Komplex ab
g ... ähnliche a'
b ' g ' ...,
a " b" g
" ... gebunden denken. So lange wir uns mit K' L' M' ..., beschäftigen,
befinden wir uns in einem uns vollständig geläufigen, uns überall
sinnlich zugänglichen Gebiet. Sobald wir aber nach den Empfindungen
oder Gefühlen fragen, die dem Leib K' L' M' ... zugehören, finden
wir dieselben in dem sinnlichen Gebiet nicht mehr vor, wir denken sie hinzu.
Nicht nur das Gebiet, auf welches wir uns da begeben, ist uns viel weniger
geläufig, sondern auch der Übergang auf dasselbe ist verhältnismäßig
unsicher. Wir haben das Gefühl, als sollten wir uns in einen Abgrund
stürzen8). Wer immer nur diesen Gedankenweg einschlägt,
wird das Gefühl der Unsicherheit, das als Quelle von Scheinproblemen
sehr ergiebig ist, nie vollständig los werden.
8) Als ich in einem Alter von 4—5 Jahren zum erstenmal
vom Lande nach Wien kam, und von meinem Vater auf die Bastei (die ehemalige
Stadtmauer) geführt wurde, war ich sehr überrascht, im Stadtgraben
unten Menschen zu sehen, und konnte nicht begreifen, wie dieselben von
meinem Standpunkt aus hatten hinunter gelangen können, denn der Gedanke
eines anderen möglichen Weges kam mir gar nicht in den Sinn. Dieselbe
Überraschung beobachtete ich nochmals an meinem etwa 3-jährigen
Knaben bei Gelegenheit eines Spazierganges auf der Prager Stadtmauer. Dieses
Gefühls erinnere ich mich jedesmal bei der im Text bezeichneten Überlegung,
und gern gestehe ich, daß mein zufälliges Erlebnis bei Befestigung
meiner vor langer Zeit gefaßten Ansicht über diesen Punkt wesentlich
mitgewirkt hat. Die Gewohnheit, materiell und psychisch stets dieselben
Wege zu gehen, wirkt sehr desorientierend. Ein Kind kann beim Durchbrechen
einer Wand im längst bewohnten Hause eine wahre Erweiterung der Weltanschauung
erfahren, und eine kleine wissenschaftliche Wendung kann sehr aufklärend
wirken.
Wir sind aber auf diesen Weg nicht beschränkt.
Wir betrachten zunächst den gegenseiti-gen Zusammenhang der Elemente
des Komplexes A B C ..., ohne auf K L M ... (unsern Leib) zu achten. Jede
physikalische Untersuchung ist von dieser Art. Eine weiße Kugel fällt
auf eine Glocke; es klingt. Die Kugel wird gelb vor der Natrium-, rot vor
der Lithiumlampe. Hier scheinen die Elemente (A B C ...) nur untereinander
zusammenzuhängen, von unserm Leib (K L M ...) unabhängig zu sein.
Nehmen wir aber Santonin ein, so wird die Kugel auch gelb. Drücken
wir ein Auge seitwärts, so sehen wir zwei Kugeln. Schließen
wir die Augen ganz, so ist gar keine Kugel da. Durchschneiden wir den Gehörnerven,
so klingt es nicht. Die Elemente A B C ... hängen also nicht nur untereinander,
sondern auch mit den Elementen K L M ... zusammen. Insofern, und nur insofern,
nennen wir A B C .... Empfindungen und betrachten A B C als zum Ich gehörig.
Wo in dem Folgenden neben oder für die Ausdrücke "Element", "Elementenkomplex"
die Bezeichnungen "Empfindung", "Empfindungskomplex" gebraucht werden,
muß man sich gegenwärtig halten, daß die Elemente nur
in der bezeichneten Verbindung und Beziehung, in der bezeichneten funktionalen
Abhängigkeit Empfindungen sind. Sie sind in anderer funktionaler Beziehung
zugleich physikalische Objekte. Die Nebenbezeichnung der Elemente als Empfindungen
wird bloß deshalb verwendet, weil den meisten Menschen die gemeinten
Elemente eben als Empfindungen (Farben, Töne, Drücke, Räume,
Zeiten u.s.w.) viel geläufiger sind, während nach der verbreiteten
Auffassung die Massenteilchen als physikalische Elemente gelten, an welchen
die Elemente in dem hier gebrauchten Sinne als "Eigenschaften", "Wirkungen"
haften9).
9) Diesen Hauptpunkt habe ich dem Wesen nach gleich,
aber in einer ändern Form dargestellt, welche den Naturforschern sympathischer
sein möchte, in "Erkenntnis und Irrtum". Leipzig, 1905.
Auf diesem Wege finden wir also nicht die vorher bezeichnete
Kluft zwischen Körpern und Empfindungen, zwischen außen und
innen, zwischen der materiellen und geistigen Welt10). Alle
Elemente A B C ... K L M ... bilden nur eine zusammenhängende Masse,
welche, an jedem Element angefaßt, ganz in Bewegung gerät, nur
daß eine Störung bei K L M ... viel weiter und tiefer greift,
als bei A B C .... Ein Magnet in unserer Umgebung stört die benachbarten
Eisenmassen, ein stürzendes Felsstück erschüttert den Boden,
das Durchschneiden eines Nerven aber bringt das ganze System von Elementen
in Bewegung. Ganz unwillkürlich führt das Verhältnis zu
dem Bilde einer zähen Masse, welche an mancher Stelle (dem Ich) fester
zusammenhängt. Oft habe ich mich dieses Bildes im Vortrage bedient.
10) Vgl. meine ,,Grundlinien der Lehre von den Bewegungsempfindungen".
Leipzig, Engeimann, 1875, S. 54. Daselbst habe ich meine Ansicht zuerst
kurz, aber bestimmt ausgesprochen, in den Worten: "Die Erscheinungen lassen
sich in Elemente zerlegen, die wir, insofern sie als mit bestimmten Vorgängen
des Körpers (Leibes) verbunden und durch dieselben bedingt angesehen
werden können, Empfindungen nennen."
9.
So besteht also die große Kluft zwischen physikalischer und psychologischer
Forschung nur für die gewohnte stereotype Betrachtungsweise. Eine
Farbe ist ein physikalisches Objekt, sobald wir z. B. auf ihre Abhängigkeit
von der beleuchtenden Lichtquelle (andern Farben, Wärmen, Räumen
u.s.w.) achten. Achten wir aber auf ihre Abhängigkeit von der Netzhaut
(den Elementen K L M ...), so ist sie ein psychologisches Objekt, eine
Empfindung. Nicht der Stoff, sondern die Untersuchungsrichtung ist in beiden
Gebieten verschieden. (Vgl. auch Kapitel II.)
Sowohl wenn wir von der Beobachtung fremder Menschen-
oder Tierleiber auf deren Empfindungen schließen, als auch, wenn
wir den Einfluß des eigenen Leibes auf unsere Empfindungen untersuchen,
müssen wir eine beobachtete Tatsache durch Analogie ergänzen.
Diese Ergänzung fällt aber viel sicherer und leichter aus, wenn
sie etwa nur den Nervenvorgang betrifft, den man am eigenen Leib nicht
vollständig beobachten kann, wenn sie also in dem geläufigem
physikalischen Gebiet spielt, als wenn sich die Ergänzung auf Psychisches,
die Empfindungen, Gedanken anderer Menschen erstreckt. Sonst besteht kein
wesentlicher Unterschied.
10.
Die dargelegten Gedanken erhalten eine größere Festigkeit
und Anschaulichkeit, wenn man dieselben nicht bloß in abstrakter
Form ausspricht, sondern direkt die Tatsachen ins Auge faßt, welchen
sie entspringen. Liege ich z. B. auf einem Ruhebett, und schließe
das rechte Auge, so bietet sich meinem linken Auge das Bild der folgenden
Figur 1. In einem durch den Augenbrauenbogen, die Nase und den Schnurrbart
gebildeten Rahmen erscheint ein Teil meines Körpers, so weit er sichtbar
ist, und dessen Umgebung11). Mein Leib unterscheidet sich von
den andern menschlichen Leibern nebst dem Umstande, daß jede lebhaftere
Bewegungsvorstellung sofort in dessen Bewegung ausbricht, daß dessen
Berührung auffallendere Veränderungen bedingt als jene anderer
Körper, dadurch daß er nur teilweise und insbesondere ohne Kopf
gesehen wird. Beobachte ich ein Element
1l) Von dem binocularen Gesichtsfeld, das mit seiner
eigentümlichen Stereoskopie jedermann geläufig ist, das aber
schwieriger zu beschreiben und durch eine ebene Zeichnung nicht darstellbar
ist, wollen wir hier absehen.
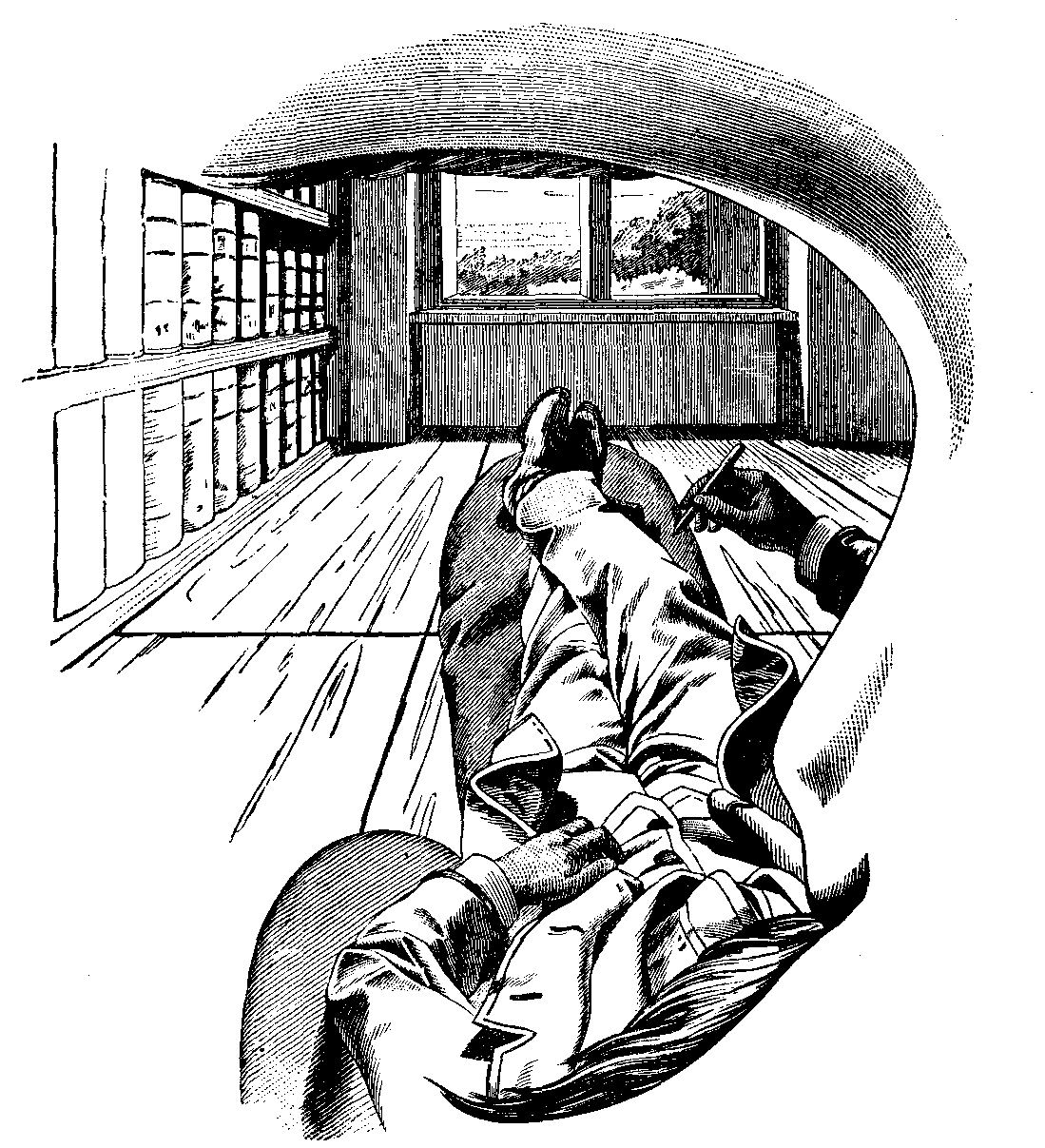
Fig. 1
A im Gesichtsfelde, und untersuche dessen
Zusammenhang mit einem andern Element B desselben Feldes, so komme
ich aus dem Gebiet der Physik in jenes der Physiologie oder Psychologie,
wenn B, um den treffenden Ausdruck anzuwenden, den ein Freund beim
Anblick dieser Zeichnung gelegentlich gebraucht hat12), die
Haut passiert. Ähnliche Überlegungen wie für das Gesichtsfeld
lassen sich für das Tastfeld und die Wahrnehmungsfelder der übrigen
Sinne anstellen13).
12) Herr Ingenieur J. Popper in Wien.
13) Zur Entwerfung dieser Zeichnung bin ich etwa um
1870 durch einen drolligen Zufall veranlaßt worden. Ein längst
verstorbener Herr v. L., dessen wahrhaft liebenswürdiger Charakter
über manche Exzentrizität hinweg half, nötigte mich eine
Schrift von Chr. Fr. Krause zu lesen. In derselben findet sich folgende
Stelle: ,,Aufgabe: Die Selbstschauung ,Ich' auszuführen.
Auflösung: Man führt sie ohne weiteres aus."
Um nun dieses philosophische "Viel Lärm um Nichts"
scherzhaft zu illustrieren, und zugleich zu zeigen, wie man wirklich die
Selbstschauung "Ich" ausführt, entwarf ich die obige Zeichnung. —
Der Verkehr mit Herrn v. L. war für mich sehr lehrreich und anregend
durch die Naivetät, mit welcher er sonst sorgfältig verschwiegene
oder verhüllte philosophische Gedanken aussprach.
11.
Es ist schon auf die Verschiedenheit der Elementengruppen, die wir mit
ABC ... und ab g
... bezeichnet haben, hingewiesen worden. In der Tat, wenn wir einen
grünen Baum vor uns sehen, oder uns an den grünen Baum erinnern,
uns denselben vorstellen, so wissen wir diese beiden Fälle ganz wohl
zu unterscheiden. Der vorgestellte Baum hat eine viel weniger bestimmte,
viel mehr veränderliche Gestalt, sein Grün ist viel matter und
flüchtiger, und er scheint vor allem deutlich in einem andern Feld.
Eine Bewegung, die wir ausführen wollen, ist immer nur eine vorgestellte
Bewegung und erscheint in einem andern Feld als die ausgeführte Bewegung,
welche übrigens immer erfolgt, wenn die Vorstellung lebhaft genug
wird. Die Elemente A oder a erscheinen in einem verschiedenen
Feld, heißt nun, wenn man auf den Grund geht, nichts anderes, als
daß sie mit verschiedenen andern Elementen verknüpft sind. So
weit wären also die Grundbestandteile in A B C ... ab
gdieselben (Farben, Töne, Räume,
Zeiten, Bewegungsempfindungen ...), und nur die Art ihrer Verbindung verschieden.
Schmerz und Lust pflegt man als von den Sinnesempfindungen
verschieden zu betrachten. Allein nicht nur die Tastempfindungen, sondern
auch alle übrigen Sinnesempfindungen können allmählich in
Schmerz und Lust übergehen. Auch Schmerz und Lust können mit
Recht Empfindungen genannt werden. Sie sind nur nicht so gut analysiert
und so geläufig als die Sinnesempfindungen, vielleicht auch nicht
auf so wenige Organe beschränkt als letztere. Schmerz- und Lustempfindungen,
mögen sie noch so schattenhaft auftreten, bilden einen wesentlichen
Inhalt aller sogenannten Gefühle. Was uns sonst noch zum Bewußtsein
kommt, wenn wir von Gefühlen ergriffen werden, können wir als
mehr oder weniger diffuse, nicht scharf lokalisierte Empfindungen bezeichnen.
W. James14) und später Th. Ribot15)
sind der physiologischen Mechanik der Gefühle nachgegangen und sehen
das Wesentliche in zweckmäßigen, den Umständen entsprechenden,
durch die Organisation ausgelösten Aktionstendenzen des Leibes. Nur
ein Teil derselben tritt ins Bewußtsein. Wir sind traurig, weil wir
weinen, und nicht umgekehrt, sagt James. Und Ribot findet
mit Recht den niedern Stand unserer Kenntnis der Gefühle dadurch bedingt,
daß wir stets nur beachtet haben, was bei diesen physiologischen
Prozessen ins Bewußtsein tritt. Allerdings geht er zu weit, wenn
er alles Psychische für dem Physischen bloß "surajouté",
und nur das Physische für wirksam hält. Für uns besteht
ein solcher Unterschied nicht.
14) W. James, Psychology. New York 1890, II, p. 442.
15) Th. Ribot, La psychologie des sentiments, 1899.
Somit setzen sich die Wahrnehmungen sowie die Vorstellungen,
der Wille, die Gefühle, kurz die ganze innere und äußere
Welt, aus einer geringen Zahl von gleichartigen Elementen in bald flüchtigerer,
bald festerer Verbindung zusammen. Man nennt diese Elemente gewöhnlich
Empfindungen. Da aber in diesem Namen schon eine einseitige Theorie liegt,
so ziehen wir vor, kurzweg von Elementen zu sprechen, wie wir schon getan
haben. Alle Forschung geht auf die Ermittlung der Verknüpfung dieser
Elemente aus16). Sollte man mit einer Art dieser Elemente durchaus
nicht das Auskommen finden, so werden eben mehrere statuiert werden. Es
ist aber nicht zweckmäßig, für die hier behandelten Fragen
die Annahmen gleich von vornherein zu komplizieren.
16) Vgl. S. 4, 7, 11, 12, 13 der vorliegenden Schrift,
endlich auch die allgemeine Anmerkung am Schluß meiner Schrift: Die
Geschichte und die Wurzel des Satzes der Erhaltung der Arbeit. Prag, Calve,
1872.
12.
Daß aus diesem Elementenkomplex, welcher im Grunde nur einer ist,
die Körper und das Ich sich nicht in bestimmter, für alle Fälle
zureichender Weise abgrenzen lassen, wurde schon gesagt. Die Zusammenfassung
der mit Schmerz und Lust am nächsten zusammenhängenden Elemente
in einer ideellen denkökonomischen Einheit, dem Ich, hat die höchste
Bedeutung für den im Dienste des schmerzmeidenden und lustsuchenden
Willens stehenden Intellekt. Die Abgrenzung des Ich stellt sich daher instinktiv
her, wird geläufig und befestigt sich vielleicht sogar durch Vererbung.
Durch ihre hohe praktische Bedeutung nicht nur für das Individuum,
sondern für die ganze Art machen sich die Zusammenfassungen "Ich"
und "Körper" instinktiv geltend und treten mit elementarer Gewalt
auf. In besonderen Fällen aber, in welchen es sich nicht um praktische
Zwecke handelt, sondern die Erkenntnis Selbstzweck wird, kann sich diese
Abgrenzung als ungenügend, hinderlich, unhaltbar erweisen17).
17) So kann auch das Standesbewußtsein und das
Standesvorurteil, das Gefühl für Nationalität, der bornierteste
Lokalpatriotismus für gewisse Zwecke sehr wichtig sein. Solche Anschauungen
werden aber gewiß nicht den weitblickenden Forscher auszeichnen,
wenigstens nicht im Momente des Forschens. Alle diese egoistischen Anschauungen
reichen nur für praktische Zwecke aus. Natürlich kann der Gewohnheit
auch der Forscher unterliegen. Die kleinen gelehrten Lumpereien, das schlaue
Benutzen und das perfide Verschweigen, die Schlingbeschwerden bei dem unvermeidlichen
Worte der Anerkennung und die schiefe Beleuchtung der fremden Leistung
bei dieser Gelegenheit zeigen hinlänglich, daß auch der Forscher
den Kampf ums Dasein kämpft, daß auch die Wege der Wissenschaft
noch zum Munde führen, und daß der reine Erkenntnistrieb bei
unsern heutigen sozialen Verhältnissen noch ein Ideal ist.
Nicht das Ich ist das Primäre, sondern die Elemente
(Empfindungen). Man berücksichtige das in bezug auf den Ausdruck "Empfindung"
Gesagte. Die Elemente bilden das Ich. Ich empfinde Grün, will sagen,
daß das Element Grün in einem gewissen Komplex von anderen Elementen
(Empfindungen, Erinnerungen) vorkommt. Wenn ich aufhöre Grün
zu empfinden, wenn ich sterbe, so kommen die Elemente nicht mehr in der
gewohnten geläufigen Gesellschaft vor. Damit ist alles gesagt. Nur
eine ideelle denkökonomische, keine reelle Einheit hat aufgehört
zu bestehen. Das Ich ist keine unveränderliche, bestimmte, scharf
begrenzte Einheit. Nicht auf die Unveränderlichkeit, nicht auf die
bestimmte Unterscheidbarkeit von andern und nicht auf die scharfe Begrenzung
kommt es an, denn alle diese Momente variieren schon im individuellen Leben
von selbst, und deren Veränderung wird vom Individuum sogar angestrebt.
Wichtig ist nur die Kontinuität. Diese Ansicht stimmt mit derjenigen,
zu welcher Weismann durch biologische Untersuchungen (Zur Frage
der Unsterblichkeit der Einzelligen. Biolog. Centralblatt, IV. Bd, Nr.
21, 22) gelangt. (Vergl. besonders S. 654 und 655, wo von der Teilung des
Individuums in zwei gleiche Hälften die Rede ist.) Die Kontinuität
ist aber nur ein Mittel, den Inhalt des Ich vorzubereiten und zu sichern.
Dieser Inhalt und nicht das Ich ist die Hauptsache. Dieser ist aber nicht
auf das Individuum beschränkt. Bis auf geringfügige wertlose
persönliche Erinnerungen bleibt er auch nach dem Tode des Individuums
in andern erhalten. Die Bewußtseinselemente eines Individuums hängen
unter einander stark, mit jenen eines andern Individuums aber schwach und
nur gelegentlich merklich zusammen. Daher meint jeder nur von sich zu wissen,
indem er sich für eine untrennbare von anderen unabhängige Einheit
hält. Bewußtseinsinhalte von allgemeiner Bedeutung durchbrechen
aber diese Schranken des Individuums und führen, natürlich wieder
an Individuen gebunden, unabhängig von der Person, durch die sie sich
entwickelt haben, ein allgemeineres unpersönliches, überpersönliches
Leben fort. Zu diesem beizutragen, gehört zu dem größten
Glück des Künstlers, Forschers, Erfinders, Sozialreformators
u.s.w.
Das Ich ist unrettbar. Teils diese Einsicht, teils
die Furcht vor derselben führen zu den absonderlichsten pessimistischen
und optimistischen, religiösen, asketischen und philosophischen Verkehrtheiten.
Der einfachen Wahrheit, welche sich aus der psychologischen Analyse ergibt,
wird man sich auf die Dauer nicht verschließen können. Man wird
dann auf das Ich, welches schon während des individuellen Lebens vielfach
variiert, ja im Schlaf und bei Versunkenheit in eine Anschauung, in einen
Gedanken, gerade in den glücklichsten Augenblicken, teilweise oder
ganz fehlen kann, nicht mehr den hohen Wert legen. Man wird dann auf individuelle
Unsterblichkeit18) gern verzichten, und nicht auf das Nebensächliche
mehr Wert legen als auf die Hauptsache. Man wird hierdurch zu einer freieren
und verklärten Lebensauffassung gelangen, welche Mißachtung
des fremden Ich und Überschätzung des eigenen ausschließt.
Das ethische Ideal, welches sich auf dieselbe gründet, wird gleich
weit entfernt sein von jenem des Asketen, welches für diesen biologisch
nicht haltbar ist, und zugleich mit seinem Untergang erlischt, wie auch
von jenem des Nietzscheschen frechen "Übermenschen", welches
die Mitmenschen nicht dulden können, und hoffentlich nicht dulden
werden19).
18) Indem wir unsere persönlichen Erinnerungen
über den Tod hinaus zu erhalten wünschen, verhalten wir uns ähnlich
wie der kluge Eskimo, der die Unsterblichkeit ohne Seehunde und Walrosse
dankend ablehnte.
19) So weit auch der Weg ist von der theoretischen Einsicht
zum praktischen Verhalten, so kann letzteres der ersteren auf die Dauer
doch nicht widerstehen.
Genügt uns die Kenntnis des Zusammenhanges der
Elemente (Empfindungen) nicht, und fragen wir, "wer hat diesen Zusammenhang
der Empfindungen, wer empfindet"?, so unterliegen wir der alten Gewohnheit,
jedes Element (jede Empfindung) einem unanalysierten Komplex einzuordnen,
wir sinken hiermit unvermerkt auf einen älteren, tieferen und beschränkteren
Standpunkt zurück. Man weist wohl oft darauf hin, daß ein psychisches
Erlebnis, welches nicht das Erlebnis eines bestimmten Subjekts wäre,
nicht denkbar sei, und meint damit die wesentliche Rolle der Einheit des
Bewußtseins dargetan zu haben. Allein, wie verschiedene Grade kann
das Ichbewußtsein haben, und aus wie mannigfaltigen zufälligen
Erinnerungen setzt es sich zusammen! Man könnte ebensogut sagen, daß
ein physikalischer Vorgang, der nicht in irgend einer Umgebung, eigentlich
immer in der Welt, stattfindet, nicht denkbar sei. Von dieser Umgebung,
welche ja in bezug auf ihren Einfluß sehr verschieden sein und in
Spezialfällen auf ein Minimum zusammenschrumpfen kann, zu abstrahieren,
muß uns hier wie dort erlaubt sein, um die Untersuchung zu beginnen.
Man denke an Empfindungen der niedern Tiere, welchen man kaum ein ausgeprägtes
Subjekt wird zuschreiben wollen. Aus den Empfindungen baut sich das Subjekt
auf, welches dann allerdings wieder auf die Empfindungen reagiert.
Die Gewohnheit, den unanalysierten Ich-Komplex als
eine unteilbare Einheit zu behandeln, hat sich wissenschaftlich oft in
eigentümlicher Weise geäußert. Aus dem Leibe wird zunächst
das Nervensystem als Sitz der Empfindungen ausgesondert. In dem Nervensystem
wählt man wieder das Hirn als hierzu geeignet aus, und sucht schließlich,
die vermeintliche psychische Einheit zu retten, im Hirn noch nach einem
Punkt als Sitz der Seele. So rohe Anschauungen werden aber schwerlich geeignet
sein, auch nur in den gröbsten Zügen die Wege der künftigen
Untersuchung über den Zusammenhang des Physischen und Psychischen
vorzuzeichnen. Daß die verschiedenen Organe, Teile des Nervensystems,
mit einander physisch zusammenhängen und durch einander leicht erregt
werden können, ist wahrscheinlich die Grundlage der "psychischen Einheit".
Ich hörte einmal ernstlich die Frage diskutieren: "Wieso die Wahrnehmung
eines großen Baumes in dem kleinen Kopfe des Menschen Platz fände"?
Besteht auch dieses Problem nicht, so wird doch durch die Frage die Verkehrtheit
fühlbar, die man leicht begeht, indem man sich die Empfindungen räumlich
in das Hirn hineindenkt. Ist von den Empfindungen eines andern Menschen
die Rede, so haben diese in meinem optischen oder überhaupt physischen
Raum natürlich gar nichts zu schaffen; sie sind hinzugedacht, und
ich denke sie kausal (oder besser funktional), aber nicht räumlich
an das beobachtete oder vorgestellte Menschenhirn gebunden. Spreche ich
von meinen Empfindungen, so sind dieselben nicht räumlich in meinem
Kopfe, sondern mein "Kopf" teilt vielmehr mit ihnen dasselbe räumliche
Feld, wie es oben dargestellt wurde. (Vergl. das über Fig. 1, Abschn.
9, 10 Gesagte)20).
20) Schon bei Johannes Müller finden wir einen
Ansatz zu ähnlichen Betrachtungen. Sein metaphysischer Hang hindert
ihn aber, dieselben konsequent zu Ende zu führen. Bei Hering aber
stoßen wir (Hermanns Handbuch der Physiologie, Bd. III, S. 345) auf
folgende charakteristische Stelle: "Der Stoff, aus welchem die Sehdinge
bestehen, sind die Gesichtsempfindungen. Die untergehende Sonne ist als
Sehding eine flache, kreisförmige Scheibe, welche aus Gelbrot, also
aus einer Gesichtsempfindung besteht. Wir können sie daher geradezu
als eine kreisförmige, gelbrote Empfindung bezeichnen. Diese Empfindung
haben wir da, wo uns eben die Sonne erscheint." Ich kann wohl nach den
Erfahrungen, die ich gelegentlich im Gespräch gemacht habe, sagen,
daß die meisten Menschen, welche diesen Fragen nicht durch ernstes
Nachdenken näher getreten sind, diese Auffassung einfach haarsträubend
finden werden. Natürlich ist das gewöhnliche Konfundieren des
sinnlichen und begrifflichen Raumes an diesem Entsetzen wesentlich schuld.
Geht man, wie ich es getan habe, von der ökonomischen Aufgabe der
Wissenschaft aus, nach welcher nur der Zusammenhang des Beobachtbaren,
Gegebenen für uns von Bedeutung ist, alles Hypothetische, Metaphysische,
Müßige aber zu eliminieren ist, so gelangt man zu dieser Ansicht.
Den gleichen Standpunkt wird man wohl Avenarius zuschreiben müssen,
denn wir lesen bei ihm (Der menschliche Weltbegriff, S. 76) die Sätze:
"Das Gehirn ist kein Wohnort, Sitz, Erzeuger, kein Instrument oder Organ,
kein Träger, oder Substrat u.s.w. des Denkens." "Das Denken ist kein
Bewohner oder Befehlshaber, keine andere Hälfte oder Seite u.s.w.,
aber auch kein Produkt, ja nicht einmal eine physiologische Funktion oder
nur ein Zustand überhaupt des Gehirns." Ohne für jedes Wort von
Avenarius und dessen Interpretation einstehen zu können und zu wollen,
scheint mir doch seine Auffassung der meinigen sehr nahe zu liegen. Der
Weg, den Avenarius verfolgt, "die Ausschaltung der Introjektion", ist nur
eine besondere Form der Elimination des Metaphysischen.
Man betone nicht die Einheit des Bewußtseins.
Da der scheinbare Gegensatz der wirklichen und der empfundenen Welt nur
in der Betrachtungsweise liegt, eine eigentliche Kluft aber nicht existiert,
so ist ein mannigfaltiger zusammenhängender Inhalt des Bewußt-seins
um nichts schwerer zu verstehen, als der mannigfaltige Zusammenhang in
der Welt.
Wollte man das Ich als eine reale Einheit ansehen,
so käme man nicht aus dem Dilemma heraus, entweder eine Welt von unerkennbaren
Wesen demselben gegenüberzustellen (was ganz müßig und
ziellos wäre), oder die ganze Welt, die Ich anderer Menschen eingeschlossen,
nur als in unserm Ich enthalten anzusehen (wozu man sich ernstlich schwer
entschließen wird).
Faßt man aber ein Ich nur als eine praktische
Einheit auf für eine vorläufig orientierende Betrachtung, als
eine stärker zusammenhängende Gruppe von Elementen, welche mit
andern Gruppen dieser Art schwächer zusammenhängt, so treten
Fragen dieser Art gar nicht auf, und die Forschung hat freie Bahn.
In seinen philosophischen Bemerkungen sagt Lichtenberg:
"Wir werden uns gewisser Vorstellungen bewußt, die nicht von uns
abhängen; andere, glauben wir wenigstens, hingen von uns ab; wo ist
die Grenze? Wir kennen nur allein die Existenz unserer Empfindungen, Vorstellungen
und Gedanken. Es denkt, sollte man sagen, so wie man sagt: es blitzt. Zu
sagen cogito, ist schon zu viel, sobald man es durch Ich denke übersetzt.
Das Ich anzunehmen, zu postulieren, ist praktisches Bedürfnis." Mag
auch der Weg, auf dem Lichtenberg zu diesem Resultate gelangt, von dem
unsrigen etwas verschieden sein, dem Resultate selbst müssen wir zustimmen.
13.
Nicht die Körper erzeugen Empfindungen, sondern Elementenkomplexe
(Empfindungskomplexe) bilden die Körper. Erscheinen dem Physiker die
Körper als das Bleibende, Wirkliche, die "Elemente" hingegen als ihr
flüchtiger vorübergehender Schein, so beachtet er nicht, daß
alle "Körper" nur Gedankensymbole für Elementenkomplexe (Empfindungskomplexe)
sind. Die eigentliche, nächste und letzte Grundlage, welche durch
physiologisch-physikalische Untersuchungen noch weiter zu erforschen ist,
bilden auch hier die bezeichneten Elemente. Durch diese Einsicht gestaltet
sich in der Physiologie und in der Physik manches viel durchsichtiger und
ökonomischer, und durch dieselbe werden manche vermeintlichen Probleme
beseitigt.
Die Welt besteht also für uns nicht aus rätselhaften
Wesen, welche durch Wechselwirkung mit einem andern ebenso rätselhaften
Wesen, dem Ich, die allein zugänglichen ,Empfindungen' erzeugen. Die
Farben, Töne, Räume, Zeiten ... sind für uns vorläufig
die letzten Elemente (vgl. Abschn. 8), deren gegebenen Zusammenhang wir
zu erforschen haben20). Darin besteht eben die Ergründung
der Wirklichkeit. Bei dieser Forschung können wir uns durch die für
besondere praktische temporäre und beschränkte Zwecke gebildeten
Zusammenfassungen und Abgrenzungen (Körper, Ich, Materie, Geist ...)
nicht hindern lassen. Vielmehr müssen sich bei der Forschung selbst,
wie dies in jeder Spezialwissenschaft geschieht, die zweckmäßigsten
Denkformen erst ergeben. Es muß durchaus an die Stelle der überkommenen
instinktiven eine freiere, naivere, der entwickelten Erfahrung sich anpassende,
über die Bedürfnisse des praktischen Lebens hinausreichende Auffassung
treten.
20) Ich habe es stets als besonderes Glück empfunden,
daß mir sehr früh (in einem Alter von 15 Jahren etwa) in der
Bibliothek meines Vaters Kants "Prolegomena zu einer jeden künftigen
Metaphysik" in die Hand fielen. Diese Schrift hat damals einen gewaltigen
unauslöschlichen Eindruck auf mich gemacht, den ich in gleicher Weise
bei späterer philosophischer Lektüre nie mehr gefühlt habe.
Etwa 2 oder 3 Jahre später empfand ich plötzlich die müßige
Rolle, welche das "Ding an sich" spielt. An einem heitern Sommertage im
Freien erschien mir einmal die Welt samt meinem Ich als eine zusammenhängende
Masse von Empfindungen, nur im Ich stärker zusammenhängend. Obgleich
die eigentliche Reflexion sich erst später hinzugesellte, so ist doch
dieser Moment für meine ganze Anschauung bestimmend geworden. Übrigens
habe ich noch einen langen und harten Kampf gekämpft, bevor ich imstande
war, die gewonnene Ansicht auch in meinem Spezialgebiete festzuhalten.
Man nimmt mit dem Wertvollen der physikalischen Lehren notwendig eine bedeutende
Dosis falscher Metaphysik auf, welche von dem, was beibehalten werden muß,
recht schwer losgeht, gerade dann, wenn diese Lehren geläufig geworden.
Auch die überkommenen instinktiven Auffassungen traten zeitweilig
mit großer Gewalt hervor und stellten sich hemmend in den Weg. Erst
durch abwechselnde Beschäftigung mit Physik und Physiologie der Sinne,
sowie durch historisch-physikalische Studien habe ich (etwa seit 1863),
nachdem ich den Widerstreit in meinen Vorlesungen über Psychophysik
(im Auszug in "Zeitschr. f. prakt. Heilkunde", Wien 1863, S. 364) noch
durch eine physikalisch-psychologische Monadologie vergeblich zu lösen
versucht hatte, in meinen Ansichten eine größere Festigkeit
erlangt. Ich mache keinen Anspruch auf den Namen eines Philosophen. Ich
wünsche nur in der Physik einen Standpunkt einzunehmen, den man nicht
sofort verlassen muß, wenn man in das Gebiet einer anderen Wissenschaft
hinüberblickt, da schließlich doch alle ein Ganzes bilden sollen.
Die heutige Molekularphysik entspricht dieser Forderung entschieden nicht.
Was ich sage, habe ich vielleicht nicht zuerst gesagt. Ich will meine Darlegung
auch nicht als eine besondere Leistung hinstellen. Vielmehr glaube ich,
daß jeder ungefähr denselben Weg einschlagen wird, der in besonnener
Weise auf einem nicht zu beschränkten Wissensgebiet Umschau hält.
Meinem Standpunkt nahe liegt jener von Avenarius, den ich 1883 kennen gelernt
habe (Philosophie als Denken der Welt nach dem Prinzip des kleinsten Kraftmaßes,
1876). Auch Hering in seiner Rede "Über das Gedächtnis" (Almanach
der Wiener Akademie, 1870, S. 258) und J. Popper in dem schönen Buche
"Das Recht zu leben und die Pflicht zu sterben", Leipzig 1878, S. 62, bewegen
sich zum Teil in ähnlichen Gedanken. Vgl. auch meine Rede "Über
die ökonomische Natur der physikalischen Forschung" (Almanach der
Wiener Akademie, 1882, S. 179 Anmerkung, und Populärwissenschaftliche
Vorlesungen, 3. Aufl. 1903, S. 239). Endlich muß ich hier noch auf
die Einleitung zu W. Preyers "Reine Empfindungslehre" sowie auf Riehls
Freiburger Antrittsrede S. 40 und auf R. Wahles "Gehirn und Bewußtsein",
1884, hinweisen. Meine Ansichten hatte ich 1882 und 1883 zuerst ausführlicher
dargelegt, nachdem ich dieselben 1872 und 1875 kurz angedeutet hatte. Wahrscheinlich
müßte ich noch viel mehr oder weniger Verwandtes anführen,
wenn ich eine ausgebreitetere Literaturkenntnis hätte.
14.
Die Wissenschaft entsteht immer durch einen Anpassungsprozeß der
Gedanken an ein bestimmtes Erfahrungsgebiet. Das Resultat des Prozesses
sind die Gedankenelemente, welche das ganze Gebiet darzustellen vermögen.
Das Resultat fällt natürlich verschieden aus, je nach der Art
und der Größe des Gebietes. Erweitert sich das Erfahrungsgebiet,
oder vereinigen sich mehrere bisher getrennte Gebiete, so reichen die überkommenen
geläufigen Gedankenelemente für das weitere Gebiet nicht mehr
aus. Im Kampfe der erworbenen Gewohnheit mit dem Streben nach Anpassung
entstehen die Probleme, welche mit der vollendeten Anpassung verschwinden,
um andern, die einstweilen auftauchten, Platz zu machen.
Dem bloßen Physiker erleichtert der Gedanke
eines Körpers die Orientierung, ohne störend zu werden. Wer rein
praktische Zwecke verfolgt, wird durch den Gedanken des Ich wesentlich
unterstützt. Denn ohne Zweifel behält jede Denkform, welche unwillkürlich
oder willkürlich für einen besonderen Zweck gebildet wurde, für
eben diesen Zweck einen bleibenden Wert. Sobald aber Physik und Psychologie
sich berühren, zeigen sich die Gedanken des einen Gebietes als unhaltbar
in dem andern. Dem Bestreben der gegenseitigen Anpassung entspringen die
mannigfaltigen Atom- und Monadentheorien, ohne doch ihrem Zweck genügen
zu können. Die Probleme erscheinen im wesentlichen beseitigt, die
erste und wichtigste Anpassung demnach ausgeführt, wenn wir die Elemente
(in dem oben Abschn. 7 bezeichneten Sinne) als Weltelemente ansehen. Diese
Grundanschauung kann (ohne sich als eine Philosophie für die Ewigkeit
auszugeben) gegenwärtig allen Erfahrungsgebieten gegenüber festgehalten
werden; sie ist also diejenige, welche mit dem geringsten Aufwand, ökonomischer
als eine andere, dem temporären Gesamtwissen gerecht wird. Diese Grundanschauung
tritt auch im Bewußtsein ihrer lediglich ökonomischen Funktion
mit der höchsten Toleranz auf. Sie drängt sich nicht auf in Gebieten,
in welchen die gangbaren Anschauungen noch ausreichen. Sie ist auch stets
bereit, bei neuerlicher Erweiterung des Erfahrungsgebietes, einer besseren
zu weichen.
15.
Die Vorstellungen und Begriffe des gemeinen Mannes von der Welt werden
nicht durch die volle, reine Erkenntnis als Selbstzweck, sondern durch
das Streben nach günstiger Anpassung an die Lebensbedingungen gebildet
und beherrscht. Darum sind sie weniger genau, bleiben aber dafür auch
vor den Monstrositäten bewahrt, welche bei einseitiger eifriger Verfolgung
eines wissenschaftlichen (philosophischen) Gesichtspunktes sich leicht
ergeben. Dem unbefangenen, psychisch voll entwickelten Menschen erscheinen
die Elemente, die wir mit A B C ... bezeichnet haben, räumlich neben
und außerhalb der Elemente K L M ... und zwar unmittelbar, nicht
etwa durch einen psychischen Projektions- oder einen logischen Schluß-
oder Konstruktionsprozeß, der, wenn er auch existieren würde,
sicher nicht ins Bewußtsein fiele. Er sieht also eine von seinem
Leib K L M ... verschiedene, außer diesem existierende "Außenwelt"
A B C.... Indem er zunächst die Abhängigkeit der A B C... von
den, sich immer in ähnlicher Weise wiederholenden, und daher wenig
bemerkten K L M ... nicht beachtet, sondern den festen Zusammenhängen
der A B C... unter einander nachgeht, erscheint ihm eine von seinem Ich
unabhängige Welt von Dingen. Dieses Ich bildet sich durch die Beachtung
der besonderen Eigenschaften des Einzeldinges K L M ..., mit welchen Schmerz,
Lust, Fühlen, Wollen usw. aufs engste zusammenhängen. Er bemerkt
ferner Dinge K' L' M', K" L" M" ..., die sich ganz analog K L M verhalten,
und deren Verhalten im Gegensatz zu demjenigen von A B C... ihm erst recht
vertraut wird, sobald er sich an dieselben ganz analoge Empfindungen, Gefühle
usw. gebunden denkt, wie er dieselben an sich selbst beobachtet. Die Analogie,
welche ihn hierzu treibt, ist dieselbe, die ihn bestimmt, an einem Draht,
an dem er alle Eigenschaften eines elektrisch durchströmten Leiters,
mit Ausnahme einer jetzt nicht direkt nachweisbaren, beobachtet, auch diese
eine als vorhanden anzusehen. Indem er nun die Empfindungen der Mitmenschen
und Tiere nicht wahrnimmt, sondern nur nach der Analogie ergänzt,
während er aus dem Verhalten der Mitmenschen entnimmt, daß sie
sich ihm gegenüber in demselben Falle befinden, sieht er sich veranlaßt,
den Empfindungen, Erinnerungen usw. eine besondere A B C ... K L M ...
verschiedene Natur zuzuschreiben, die je nach der Kulturstufe ungleich
aufgefaßt wird, was, wie oben gezeigt wurde, unnötig ist und
auf wissenschaftliche Irrwege führt, wenn dies auch fürs praktische
Leben von geringer Bedeutung ist.
Diese, die intellektuelle Situation des naiven Menschen
bestimmenden Momente treten je nach Bedürfnis des praktischen Lebens
in diesem abwechselnd hervor und bleiben in einem nur wenig schwankenden
Gleichgewicht. Die wissenschaftliche Weltbetrachtung betont aber bald das
eine, bald das andere Moment stärker, nimmt bald von dem einen, bald
von dem andern ihren Ausgangspunkt, und sucht in ihrem Streben nach Verschärfung,
Einheitlichkeit und Konsequenz die entbehrlichen Auffassungen, so viel
als ihr möglich scheint, zu verdrängen. So entstehen die dualistischen
und die monistischen Systeme.
Der naive Mensch kennt die Blindheit, Taubheit,
und weiß aus den alltäglichen Erfahrungen, daß das Aussehen
der Dinge durch seine Sinne beeinflußt wird; es fällt ihm aber
nicht ein, die ganze Welt zu einer Schöpfung seiner Sinne zu machen.
Ein idealistisches System oder gar die Monstrosität des Solipsismus
wäre ihm praktisch unerträglich.
Die unbefangene wissenschaftliche Betrachtung wird
leicht dadurch getrübt, daß eine für einen besonderen engbegrenzten
Zweck passende Auffassung von vornherein zur Grundlage aller Untersuchungen
gemacht wird. Dies geschieht z. B., wenn alle Erlebnisse als in das Bewußtsein
sich erstreckende "Wirkungen" einer Außenwelt angesehen werden. Ein
scheinbar unentwirrbares Knäuel von methaphysischen Schwierigkeiten
ist hiermit gegeben. Der Spuk verschwindet jedoch sofort, wenn man die
Sache sozusagen in mathematischem Sinne auffaßt, und sich klar macht,
daß nur die Ermittlung von Funktionalbeziehungen für uns Wert
hat, daß es lediglich die Abhängigkeiten der Erlebnisse voneinander
sind, die wir zu kennen wünschen. Zunächst ist dann klar, dass
die Beziehung auf unbekannte, nicht gegebene Urvariable (Dinge an sich)
eine rein fiktive und müßige ist. Aber auch wenn man diese zwar
unökonomische Fiktion zunächst bestehen läßt, kann
man leicht die verschiedenen Klassen der Abhängigkeit unter den Elementen
der "Tatsachen des Bewußtseins" unterscheiden; und das ist für
uns allein wichtig.
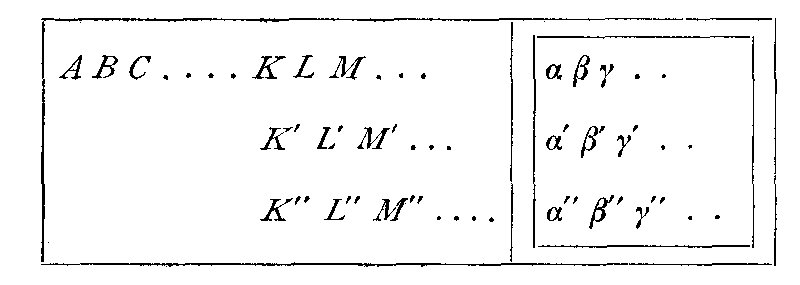
In vorstehendem Schema ist das System der Elemente angedeutet. Innerhalb
des einfach umzogenen Raumes liegen die Elemente, welche der Sinnenwelt
angehören, und deren gesetzt mäßige Verbindung, deren eigenartige
Abhängigkeit von einander, die physikalischen (leblosen) Körper,
sowie die Leiber der Menschen, Tiere und Pflanzen darstellt. Wieder in
ganz besonderer Abhängigkeit stehen alle diese Elemente von einigen
der Elemente K L M, den Nerven unseres Leibes, worin sich die Tatsachen
der Sinnesphysiologie aussprechen. Der doppelt umzogene Raum enthält
die dem höhern psychischen Leben angehörigen Elemente, die Erinnerungsbilder,
Vorstellungen, darunter auch diejenigen, welche wir uns von dem psychischen
Leben der Mitmenschen bilden, die durch Akzente unterschieden werden mögen.
Die Vorstellungen hängen zwar unter einander wieder in anderer Weise
zusammen (Assoziation, Phantasie) als die sinnlichen Elemente A B C ...
K L M, doch läßt sich nicht zweifeln, daß sie mit den
letzteren in der intimsten Verwandtschaft stehen, und daß ihr Verhalten
in letzter Linie durch A B C ... K L M, die gesamte physikalische Welt,
insbesondere durch unsern Leib, und das Nervensystem bestimmt ist. Die
Vorstellungen a' b
' g ' ... von dem Bewußtseinsinhalt
unserer Mitmenschen spielen für uns die Rolle von Zwischensubstitutionen,
durch welche uns das Verhalten der Mitmenschen, die Funktionalbeziehung
von K' L' M' zu A B C, soweit dasselbe für sich allein (physikalisch)
unaufgeklärt bliebe, verständlich wird.
Es ist also für uns wichtig zu erkennen, daß
es bei allen Fragen, die hier vernünftigerweise gestellt werden, und
die uns interessieren können, auf die Berücksichtigung verschiedener
Grundvariablen und verschiedener Abhängigkeitsverhältnisse ankommt.
Das ist die Hauptsache. An dem Tatsächlichen, an den Funktionalbeziehungen,
wird nichts geändert, ob wir alles Gegebene als Bewußtseinsinhalt,
oder aber teilweise oder ganz als physikalisch ansehen22). Die
biologische Aufgabe der Wissenschaft ist, dem vollsinnigen menschlichen
Individuum eine möglichst vollständige Orientierung zu bieten.
Ein anderes wissenschaftliches Ideal ist nicht realisierbar, und hat auch
keinen Sinn.
22) Vgl. die vortrefflichen Ausführungen bei J.
Petzoldt, Solipsismus auf praktischem Gebiet (Vierteljahrsschrift f. wissenschaftliche
Philosophie XXV, 3, S. 339). — Schuppe, Der Solipsismus (Zeitschr. f. immanente
Philosophie, Bd. III, S. 327).
Der philosophische Standpunkt des gemeinen Mannes, wenn
man dessen naivem Realismus diesen Namen zuerkennen will, hat Anspruch
auf die höchste Wertschätzung. Derselbe hat sich ohne das absichtliche
Zutun des Menschen in unmeßbar langer Zeit ergeben; er ist ein Naturprodukt
und wird durch die Natur erhalten. Alles, was die Philosophie geleistet
hat — die biologische Berechtigung jeder Stufe, ja jeder Verirrung zugestanden
—, ist dagegen nur ein unbedeutendes ephemeres Kunstprodukt. Und wirklich
sehen wir jeden Denker, auch jeden Philosophen, sobald er durch praktische
Bedrängnis aus seiner einseitigen intellektuellen Beschäftigung
vertrieben wird, sofort den allgemeinen Standpunkt einnehmen. Professor
X, welcher theoretisch Solipsist zu sein glaubt, ist es praktisch gewiß
nicht, sobald er dem Minister für einen erhaltenen Orden dankt, oder
seinem Auditorium eine Vorlesung hält. Der geprügelte Pyrrhonist
in Molières "Mariage forcé" sagt nicht mehr: "il me semble
que vous me battez", sondern nimmt die Schläge als wirklich erhalten
an.
Die "Vorbemerkungen" suchen auch keineswegs den
Standpunkt des gemeinen Mannes zu diskreditieren. Dieselben stellen sich
nur die Aufgabe zu zeigen, warum und zu welchem Zweck wir den größten
Teil des Lebens diesen Standpunkt einnehmen, und warum, zu welchem Zweck
und in welcher Richtung wir denselben vorübergehend verlassen müssen.
Kein Standpunkt hat eine absolute bleibende Geltung; jeder ist nur wichtig
für einen bestimmten Zweck.