Gesetze der Stimmführung.
Wir haben bisher immer nur die Beziehungen der Töne eines Musikstückes mit der Tonica, seiner Akkorde mit dem tonischen Akkorde betrachtet. Auf diesen Beziehungen beruht die Verbindung der Klangmasse zu einem zusammenhängenden Ganzen. Abgesehen davon besteht aber auch das Bedürfnis, die unmittelbar auf einander folgenden Töne und Akkorde durch natürliche Beziehungen mit einander verbunden zu sehen. Dadurch wird die künstlerische Verbindung der Klangmasse eine noch innigere, und im Allgemeinen wird immer eine solche Verbindung erstrebt werden müssen, wenn auch ausnahmsweise für besondere Zwecke des Ausdrucks eine heftigere und weniger verbundene Art der Fortschreitung gewählt. werden kann. Wir haben schon bei der Entwickelung der Tonleiter gesehen, daß das Gefühl für die Verbindung des Ganzen durch die Verwandtschaft zur Tonica anfangs gar nicht oder undeutlich entwickelt war, daß vielmehr an Stelle eines solchen Zusammenhanges nur die kettenweise Verbindung einer Quintenreihe bestand, daß wenigstens nur diese so entwickelt war, um sich in den theoretischen Betrachtungen der Pythagoräer über den Bau des Tonsystems bis zur bewußten Anerkennung durchzuarbeiten. Aber auch neben dem stark entwickelten Gefühle für die Tonica, wie es in der neueren harmonischen Musik herrscht, ist das Bedürfnis kettenweiser Verbindung der einzelnen Töne und Akkorde nicht verloren gegangen, wenn auch in die Quintenkette, welche ursprünglich die Töne der Tonart verband, z. B.
f — c — g — d — a — e — h,
durch die Einführung der richtigen Terzen eine Unterbrechung gekommen ist:
f — c — g — d | d — a — e — h.
Die musikalische Verbindung zwischen zwei aufeinander folgenden Noten kann hergestellt sein:
b. Oder die Verwandtschaft ist indirekt und nur von zweitem Grade. Eine solche findet sich bei allen stufenweisen Fortschritten innerhalb der Skala um halbe oder ganze Töne vor. Also zum Beispiel:
h — c — d — e — f — g — a,
in welchem der Schritt a — h vermieden ist. Aber die Erklärung würde nur für eine solche Tonart passen, in welcher c die Tonica bildet, was in der altgriechischen Leiter wohl nicht der Fall war.
Darin bildet das Intervall Mi — Fa immer den Halbton.
Eben deshalb zog Rameau es vor, in der Molltonart
die Schritte d — ![]() und
und ![]() —
f lieber am G und C, als Hilfstönen, sich bilden
zu lassen, als am B, der Septime der absteigenden Leiter, welche
keine genügend starke Verwandtschaft zur Tonica hat, und deshalb als
Hilfston nicht fest genug im Sinne des Sängers liegt. Nimmt man für
d —
—
f lieber am G und C, als Hilfstönen, sich bilden
zu lassen, als am B, der Septime der absteigenden Leiter, welche
keine genügend starke Verwandtschaft zur Tonica hat, und deshalb als
Hilfston nicht fest genug im Sinne des Sängers liegt. Nimmt man für
d —![]() das
nächst höhere g als Hilfston, so geschieht der Schritt
von dessen Unterquarte zur großen Unterterz, und
das
nächst höhere g als Hilfston, so geschieht der Schritt
von dessen Unterquarte zur großen Unterterz, und ![]() — f ist der Schritt von der großen Untersexte zur Unterquinte
des nächst höheren c. Dagegen kann der Schritt
— f ist der Schritt von der großen Untersexte zur Unterquinte
des nächst höheren c. Dagegen kann der Schritt ![]() — h in der Molltonleiter in keiner Weise auf eine Verwandtschaft
zweiten Grades zurückführen. Er ist deshalb auch entschieden
unmelodisch, und mußte in der alten homophonen Musik ganz vermieden
werden, ebenso wie die Schritte in falschen Quinten und Quarten, z. B.
h — f' oder f' — h'. Daher denn die
schon oben besprochenen Änderungen der aufsteigenden und absteigenden
Molltonleiter.
— h in der Molltonleiter in keiner Weise auf eine Verwandtschaft
zweiten Grades zurückführen. Er ist deshalb auch entschieden
unmelodisch, und mußte in der alten homophonen Musik ganz vermieden
werden, ebenso wie die Schritte in falschen Quinten und Quarten, z. B.
h — f' oder f' — h'. Daher denn die
schon oben besprochenen Änderungen der aufsteigenden und absteigenden
Molltonleiter.
In der neueren harmonischen Musik sind nun viele dieser Schwierigkeiten weggefallen oder weniger fühlbar geworden, weil eine richtig geführte Harmonisierung diejenigen Verbindungen herstellen kann, welche dem melodischen Fortschritte der einzelnen Stimme fehlen. Es ist deshalb auch viel leichter eine unbekannte Stimme eines mehrstimmigen Satzes aus einem Klavierauszuge, der die Harmonie angibt, zu singen, als aus einer einzelnen ausgeschriebenen Stimme. Aus jenem erkennt man das Verhältnis des zu singenden Tones zur ganzen Harmonie, aus letzterer nur zu den nächstbenachbarten Tönen der eigenen Stimme.
2. Töne können in musikalische Verbindung treten durch ihre Nachbarschaft in der Tonhöhe. Wir haben dieses Verhältnis schon besprochen in Beziehung auf den Leitton. Es gilt dasselbe auch für die Ausfüllungstöne in chromatischen Gängen; wenn wir z. B. in C-Dur statt C — D singen C — Cis — D, so hat das Cis gar keine Verwandtschaft ersten oder zweiten Grades zur Tonica C, es hat auch keine harmonische oder modulatorische Bedeutung; es ist nichts als eine zwischen beide Töne eingeschobene Stufe, welche zur Tonleiter nicht gehört, und nur dazu dient, die stufenweise Bewegung in der Tonleiter der überschleifenden Bewegung des natürlichen Sprechens, Weinens oder Heulens ähnlicher zu machen. Die Griechen haben diese Teilung in ihrem enharmonischen Systeme, wo sie eine Halbtonstufe in zwei Schritte teilten, noch weiter getrieben, als wir es jetzt tun. Ein chromatischer Fortschritt in halben Tönen geschieht eben trotz der Fremdartigkeit des zu erreichenden Tones mit so ausreichender Sicherheit, daß er auch in modulatorischen Übergängen gebraucht werden kann, um ganz fernliegende Tonarten plötzlich zu erreichen.
Es ist besonders die italienische Melodiebildung reich an solchen Vorhalttonen.
Untersuchungen über die Gesetze ihres Vorkommens finden sich in zwei
Abhandlungen von Herrn A. Basevi2). Durchgehend ist die
Regel befolgt, daß leiterfremde Töne nur eingeführt werden
können, wenn sie um einen Halbton abstehen von der Note der Leiter,
in welche sie sich auflösen, während leitereigene Töne frei
einsetzen können gegen eine disharmonierende Begleitung, auch wenn
sie zur Auflösung einen Ganztonschritt machen müssen.
2) Introduktion à un nouveau Systeme d'Harmonie;
traduit par L. Delâtre. Florence 1865. Studj sull' Armoma.
Firenze 1865.
Ebenso können auch Schritte in ganzen Tönen, wenn sie in der diatonischen Leiter gemacht werden, in solcher Weise vorkommen, daß sie nur als Vermittelung zwischen zwei anderen dienen, welche im Akkorde liegen. Es sind dies die sogenannten Durchgangstöne. Wenn also zum Beispiel zu dem fortklingenden C-Durdreiklange eine Stimme den Gang
c — d — e —f — g
ausführt, so passen die Töne d und f nicht in den Akkord, haben auch gar keine Beziehung zu der Harmonie, sondern sind eben nur durch den melodischen Fortschritt der einzelnen Stimme begründet. Man läßt diese Durchgangstöne der Regel nach auf die nicht akzentuierten Taktteile fallen und gibt ihnen eine kurze Dauer. In obigem Beispiele würde man also c, e und g auf die guten d. h. akzentuierten Taktteile legen. D bildet dann den Durchgangston zwischen c und e, f den zwischen e und g. Wesentlich aber für ihre Verständlichkeit ist es, daß sie nur in Stufen von halben oder ganzen Tönen eintreten; so geben sie eine leicht und ohne Widerstand fortgleitende melodische Bewegung, in der man die nicht akzentuierten dissonanten Töne fast überhört.
Auch in den wesentlich dissonanten Akkorden muß der Regel nach für den dissonanten Ton, welcher vereinzelt der Masse der übrigen Töne entgegentritt, ein möglichst leicht verständlicher und leicht zu treffender melodischer Fortschritt eingehalten werden. Und da das Gefühl für die natürlichen Verwandtschaften eines solchen vereinzelten Tones durch die gleichzeitig erklingenden anderen Töne, die sich der Wahrnehmung viel mächtiger aufdrängen, gleichsam übertäubt wird, so bleibt bloß der stufenweise diatonische Fortschritt übrig, um für den Sänger und den Hörer die Tonhöhe und die melodischen Beziehungen eines solchen dissonanten Tones festzustellen. Es wird deshalb der Regel nach verlangt werden müssen, daß ein dissonanter Ton nur stufenweise eintrete, und sich auch nur stufenweise wieder weiterbewege.
Als wesentlich dissonante Akkorde sind solche zu betrachten, in denen die dissonanten Noten nicht bloß als durchgehende Noten über einem liegenbleibenden Akkorde eintreten, sondern entweder von einem eigenen Akkorde begleitet sind, der von den vorhergehenden und nachfolgenden verschieden ist, oder doch durch ihre Dauer und Akzentnation sich so hervordrängen, daß sie der Aufmerksamkeit des Hörers sich nicht entziehen können. Es ist schon oben bemerkt worden, daß diese dissonanten Akkorde nicht um ihrer selbst willen, sondern hauptsächlich als Mittel, das Gefühl des Vorwärtsstrebens in dem Satze zu erhöhen, gebraucht werden können. Daraus folgt denn für die Bewegung des dissonanten Tones, daß wenn derselbe in den Akkord schrittweise eintritt und wieder aus ihm austritt, er entweder beide Male steigen oder beide Male fallen muß. Ließe man ihn dagegen in dem dissonanten Akkorde seine Bewegung umkehren, so würde die Dissonanz unmotiviert erscheinen. Dann wäre es passender gewesen, den betreffenden Ton in seiner konsonanten Lage liegen zu lassen, ohne daß er sich bewegte. Eine Bewegung, welche zu ihrem Ausgangspunkte gleich wieder zurückkehrt, und dabei Dissonanz hervorbringt, unterbleibt besser; sie hat kein Ziel.
Zweitens kann man als Regel aufstellen, daß die Bewegung des dissonanten Tones nicht so gerichtet sein darf, daß sie die Dissonanz aufhebt, wenn die übrigen Teile des Akkordes liegen blieben. Denn eine Dissonanz, die von selbst sich aufheben würde, wenn man nur wartet, bis ihr nächster Schritt erfolgt ist, bringt eben keinen Antrieb zum Fortschritt der Harmonie hervor. Sie klingt deshalb matt und ungerechtfertigt. Dies ist der Hauptgrund, warum Septimenakkorde, wenn sie sich unter Fortschreitung der Septime auflösen sollen, nur die Fortschreitang der Septime nach unten zulassen. Denn wenn die Septime in der Tonleiter stiege, würde sie zur Oktave des Grundtones werden, und die Dissonanz des Akkordes aufgehoben sein. Es kommen bei Bach, Mozart und Anderen solche Fortschreitungen im Dominantseptimenakkorde vor; dann klingt die Septime aber eben nur wie ein Durchgangston, und muß wie ein solcher behandelt werden. Dann ist sie für die Fortschreitung der Harmonie gleichgültig.
Am vollständigsten gesichert ist die Tonhöhe eines einzelnen dissonanten Tones einem mehrstimmigen Akkorde gegenüber, wenn jener dissonante Ton schon vorher als Konsonanz in dem vorausgehenden Akkorde vorhanden gewesen war und einfach festgehalten wird, während der neue Akkord einsetzt. Wenn wir also folgen lassen die Akkorde:
c — e — g — h,
Solche vorbereitete Dissonanzen, sogenannte Vorhalte, können nun in mannigfachen anderen Akkorden vorkommen, als in Septimenakkorden, z. B.
Vorhaltsakkord: G — c — d,
Auflösung: G — H — d.
Im anderen Falle, wenn die Dissonanz nicht vorbereitet ist, sondern mit dem Akkorde, in welchem sie Dissonanz ist, gleichzeitig einsetzt, ein Fall, der hauptsächlich bei den Septimenakkorden häufig eintritt, ist die Bedeutung der Dissonanz eine andere. Da die frei eintretenden Septimen der Regel nach absteigend eintreten müssen, so kann man sie sich stets als aus der Oktave des Grundtones ihres Akkordes absteigend denken, indem man sich zwischen den vorausgehenden und dem Septimenakkord einen konsonanten Dur- oder Mollakkord vom Grundtone des letzteren eingeschoben denkt. In diesem Falle kündet also die eintretende Septime nur an, daß dieser konsonante Akkord gleich wieder im Zerfällen begriffen ist, und daß die Harmonie durch melodische Bewegung einem neuen Ziele zueilt. Dieses Ziel, der Auflösungsakkord, muß betont werden; der Eintritt der Dissonanz fällt deshalb notwendig auf den vorhergehenden nicht akzentuierten Taktteil.
Der Eintritt eines vereinzelten dissonanten Tones kann eben der Regel nach einem mehrstimmigen Akkorde gegenüber nicht als Ausdruck einer Kraftanstrengung benutzt werden, wohl aber der Eintritt eines Akkordes einem einzelnen Tone gegenüber, vorausgesetzt, daß dem einzelnen dissonanten Tone nicht eine überwiegende Tonstärke gegeben wird. Deshalb liegt es in der Natur der Sache, daß das Erstere auf nicht akzentuierten Taktteilen, das Letztere auf akzentuierten geschieht.
Von der Befolgung dieser Regeln, welche den Eintritt der Dissonanzen betreffen, kann man vielfältig absehen bei den Septimenakkorden des verwendeten Systems, in denen die Quarte und Secunde der Tonart vorkommen, und Töne der Unterdominantseite mit solchen der Oberdominantseite gemischt sind. Diese Akkorde können noch zu einem anderen Zweck eingeführt werden, als um den dynamischen Eindruck der fortschreitenden Harmonie zu steigern. Sie haben nämlich auch die Wirkung, den Umfang der Tonart dem Gefühle des Hörers fortdauernd gegenwärtig zu erhalten, und ihre Existenz ist durch diesen Zweck gerechtfertigt.
Vom Akkorde der Tonica C aus können sich einige Stimmen
sehr wohl den Tönen der Oberdominantenseite g — h
— d zuwenden, andere denen der Unterdominantseite f — a
— c oder f — ![]() — c, und jede Stimme wird die Lage ihres Tones mit vollkommener
Sicherheit finden können, auf das Gefühl einer nahen Verwandtschaft
gestützt. Wenn dann freilich der dissonante Akkord eingetreten ist,
werden die dissonanten Töne, bei denen das Gefühl für ihre
ferneren natürlichen Verwandtschaften übertäubt wird durch
den gleichzeitig dazu erklingenden fremdartigen Akkord, nach der Regel
der sich, auflösenden Dissonanzen fortschreiten müssen. Ein Sänger
zum Beispiel, welcher in dem Akkorde g — h — d
— f das f singt, würde vergebens versuchen sich vorzustellen,
wie das dem f verwandte a klingen muß, um etwa
nach diesem herauf- oder herabzuspringen; wohl aber kann er den engen Halbtonschritt
nach e in den Akkord g — c — e hinein
sicher ausführen. Dagegen kann sehr wohl das g, welches seinen
eigenen Klang durch den Septimenakkord annähernd dargestellt findet,
nach seinen verwandten Tönen, c zum Beispiel, springend
sich fortbewegen, oder h nach g.
— c, und jede Stimme wird die Lage ihres Tones mit vollkommener
Sicherheit finden können, auf das Gefühl einer nahen Verwandtschaft
gestützt. Wenn dann freilich der dissonante Akkord eingetreten ist,
werden die dissonanten Töne, bei denen das Gefühl für ihre
ferneren natürlichen Verwandtschaften übertäubt wird durch
den gleichzeitig dazu erklingenden fremdartigen Akkord, nach der Regel
der sich, auflösenden Dissonanzen fortschreiten müssen. Ein Sänger
zum Beispiel, welcher in dem Akkorde g — h — d
— f das f singt, würde vergebens versuchen sich vorzustellen,
wie das dem f verwandte a klingen muß, um etwa
nach diesem herauf- oder herabzuspringen; wohl aber kann er den engen Halbtonschritt
nach e in den Akkord g — c — e hinein
sicher ausführen. Dagegen kann sehr wohl das g, welches seinen
eigenen Klang durch den Septimenakkord annähernd dargestellt findet,
nach seinen verwandten Tönen, c zum Beispiel, springend
sich fortbewegen, oder h nach g.
In den Akkorden h — d | f — a und h
— d | f — ![]() ,
in denen weder die Dominantseite noch die Unterdominantseite überwiegt,
wird es überhaupt nicht ratsam sein, einen der Töne springend
fortschreiten zu lassen.
,
in denen weder die Dominantseite noch die Unterdominantseite überwiegt,
wird es überhaupt nicht ratsam sein, einen der Töne springend
fortschreiten zu lassen.
Auch wird es nicht ratsam sein, aus einem anderen Akkorde als dem tonischen springend in die Akkorde des verwendeten Systems überzugehen, weil nur der tonische Akkord die gleichzeitige Verwandtschaft zu dem Dominant- und dem Subdominantakkorde hat.
Zu den Septimenakkorden des unverwendeten Systems ist ein Übergang von einem anderen, beiden Enden des Septimenakkorden verwandten Akkorde nicht möglich; daher bei diesen die Dissonanz nach den strengen Regeln eintreten muß.
Über die Behandlung des Subdominantenakkordes mit zugefügter Sexte f — a — c — d in C-Dur sind die Ansichten der Musiker geteilt. Am richtigsten ist wohl die Vorschrift von Rameau, als den dissonanten Ton das d anzusehen, welches ansteigend nach e die Dissonanz auflösen muß. Auch ist dies entschieden die wohlklingendste Art der Auflösung. Die neueren. Theoretiker betrachten diesen Akkord dagegen als Septimenakkord. von d, und sehen c als Dissonanz an, welche absteigend sich lösen muß, während d, wenn c liegen bleibt, sich ganz frei bewegt, also namentlich auch absteigend fortschreiten könnte.
Akkordfolgen: Ebenso wie die ältere homophone Musik kettenweise Verwandtschaft der Töne einer Melodie verlangte, strebt die neuere Musik nach kettenweiser Verbindung der Akkorde eines Harmoniegewebes, wogegen sie sich in der melodischen Folge der einzelnen Töne viel größere Freiheiten erlauben kann, da durch die Harmonie die natürlichen Verwandtschaften der Töne viel entschiedener und eindringlicher bezeichnet werden als in der homophonen Melodie. Das Verlangen nach kettenweiser Verwandtschaft der Akkorde war im 16. Jahrhundert noch wenig entwickelt. Bei den großen italienischen Meistern dieser Zeit folgen sich die der Tonart angehörigen Akkorde oft in den auffallendsten Sprüngen, die wir gegenwärtig nur in seltenen Ausnahmen zulassen würden. Während des 17. Jahrhunderts dagegen entwickelte sich das Gefühl auch für diese Eigentümlichkeit der Harmonie, daher wir denn die hierauf bezüglichen Regeln bei Rameau schon bestimmt, ausgesprochen finden im Anfange des 18. Jahrhunderts. Mit Bezug auf den von ihm aufgestellten Begriff des Fundamentalbasses sprach Rameau diese Regel so aus: "Der Fundamentalbaß darf der Regel nach nur in reinen Quinten oder Terzen auf- oder abwärtsschreiten." Nach unserer Darstellung ist der Fundamentalbaß eines Akkordes derjenige Klang, welcher entweder allein oder wenigstens vorzugsweise durch die Töne des Akkordes dargestellt wird. In diesem Sinne genommen fällt Rameau's Regel mit der der melodischen Fortschreitang eines einzelnen Tones zu nächstverwandten Tönen zusammen. Wie die Stimme einer Melodie darf auch der Akkordklang nur zu nächstverwandten Tönen fortschreiten. Fortschreitung nach einer Verwandtschaft zweiten Grades ist aber bei Akkorden viel schwerer zu motivieren, als bei einzelnen Tönen, und ebenso Fortschreitung in kleinen diatonischen Stufen ohne Verwandtschaft. Deshalb ist Rameau's Regel für die Fortschreitung des Fundamentalbasses im Ganzen strenger, als die Regeln für melodische Fortschreitung einer einzelnen Stimme.
Nehmen wir z. B. den Akkord c — e — g, der dem C-Klange entspricht, so können wir von diesem in Quinten zum G-Klange g — h — d, oder zum F- Klange fortschreiten, f — a — c. Die beiden letzteren Akkorde haben je einen Ton, beziehlich g und c, mit dem Akkorde c — e — g gemeinsam, sind ihm also direkt verwandt.
Wir können aber auch den Klang in Terzen fortschreiten lassen; dann bekommen wir Mollakkorde, wenn wir die Tonart nicht verlassen wollen. Der Übergang vom Klange C zum Klange E wird ausgedrückt durch die Folge der Akkorde c — e — g und e — g — h, welche durch zwei Töne verwandt sind. Ähnlich ist die Folge c — e — g und a — c — e vom G-Klange zum A-Klange. Die letztere ist sogar noch natürlicher als die erstere, weil der Akkord a — c — e einen unreinen A- Klang mit eingemischtem C- Klange darstellt, der vorher bestehende G- Klang also auch mit zwei Tönen im folgenden Akkorde erhalten bleibt, während diese Beziehung im ersten Falle nicht besteht.
Wir können aber, wenn wir die Tonart C-Dur verlassen wollen, auch
den Schritt zu den reinen Terzenklängen machen, also von c
— e — g zu e — ![]() — h oder zu a —
— h oder zu a — ![]() — e, wie dies in modulatorischen Gängen sehr gewöhnlich
ist.
— e, wie dies in modulatorischen Gängen sehr gewöhnlich
ist.
Nur in solchen Fällen läßt Rameau bei konsonanten Dreiklängen einen einfachen diatonischen Fortschritt des Fundamentalbasses zu, wo man zwischen einem Dur- und Mollakkorde wechselt, z. B. von g — h — d nach a — c — e, also vom G zum A-Klange, nennt dies aber doch eine Lizenz. In der Tat erklärt sich dies nach unserer Betrachtungsweise leicht, wenn wir den Mollakkord a — c — e als C-Klang mit eingemischtem a ansehen. Dann geschieht der Übergang in enger Verwandtschaft vom G- zum C-Klange, und das a erscheint nur als Dependenz des letzteren. Jeder Mollakkord. repräsentiert eben in unvollkommener Weise einen doppelten Klang, und kann deshalb auch in doppeltem Sinne genommen werden. Systematisch formuliert hat Rameau diese doppelte Bedeutung (double emploi) erst für den mit der Septime versehenen Mollakkord, der in der Form d —f — a — c als D-Klang, in der Form f — a — c — d als F-Klang gelten kann, oder dessen Fundamentalbaß nach Rameau's Ausdrucksweise D oder F sein kann. In diesem Septimenakkorde tritt die doppelte Bedeutung stärker hervor, weil der F-Klang in ihm vollständiger ist; aber sie kommt ebenso, wenn auch minder deutlich, dem einfachen Mollakkorde zu. Zu dem Trugschlusse
g — h — d .... a — c — e.
gesellt sich, der Kadenz in der Molltonart entsprechend, der andere
g — h — d .... ![]() — c —
— c — ![]() ,
,
wo der Akkord ![]() — c —
— c —![]() statt
der normalen Lösung c —
statt
der normalen Lösung c —![]() — g eintritt. Doch wird hier von dem C-Klange nur eine einzige Note
erhalten, weshalb dieser Trugschluß viel auffallender ist. Auch dieser
wird gemildert, wenn man dem G-Akkorde die Septime f beifügt,
welche mit
— g eintritt. Doch wird hier von dem C-Klange nur eine einzige Note
erhalten, weshalb dieser Trugschluß viel auffallender ist. Auch dieser
wird gemildert, wenn man dem G-Akkorde die Septime f beifügt,
welche mit ![]() verwandt ist.
verwandt ist.
Wenn zwei Akkorde neben einander gestellt werden, welche nur im zweiten Grade verwandt sind, wird dies im Allgemeinen als ein jäher Sprung empfunden werden. Wenn aber der Akkord, welcher ihre Verbindung herstellt, ein Hauptakkord der Tonart ist, und daher schon häufig gehört wurde, ist die Wirkung nicht so auffallend. So sieht man in den Schlußcadenzen nicht ganz selten die Dreiklänge f — a — c und g — h — d aufeinander folgen, welche mittels des tonischen Akkordes verwandt sind:
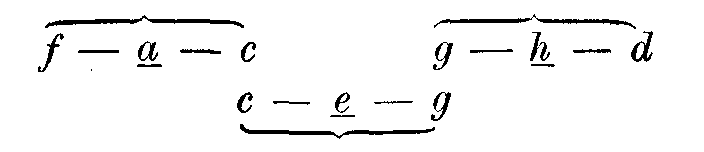
Überhaupt ist bei allen diesen Regeln über die Fortschreitung festzuhalten, daß sie vielen Ausnahmen unterworfen sind, teils weil der Ausdruck fordern kann ausnahmsweise stärkere Sprünge in der Fortschreitung zu machen, teils weil die Erinnerung an die kurz zuvor gehörten Akkorde eine schwache Verwandtschaft genügend zu unterstützen vermag, um sie deutlich fühlbar zu machen. Offenbar ist es ein falscher Standpunkt, auf den sich die Lehrer der Harmonik gestellt haben, indem sie dies und jenes in der Musik für verboten erklärten. In der Tat ist nichts in der Musik absolut verboten, und man findet von sämtlichen Regeln der Stimmführung Ausnahmen gerade in den wirkungsreichsten Sätzen der größten Komponisten. Man hätte vielmehr darauf ausgehen sollen zu sagen, daß dieser und jener Schritt, den man verbietet, irgend welche auffallende und ungewöhnliche Wirkung auf den Hörer macht, die eben, weil sie ungewöhnlich ist, nur hinpaßt, wo Ungewöhnliches auszudrücken ist. Im Allgemeinen gehen die Vorschriften der Theoretiker darauf aus, einen leicht zu fassenden und wohl zusammenhängenden Fluß der Melodie und Harmonie zu erhalten. Verlangt man einen solchen, so tut man gut ihre Verbote zu beachten. Aber es ist nicht zu leugnen, daß eine zu ängstliche Vermeidung des Ungewöhnlichen eine gewisse Gefahr der Trivialität und Mattherzigkeit herbeiführt, während andererseits zu rücksichtsloses und häufiges Überspringen der Regeln die Sätze barock und zusammenhanglos erscheinen läßt.
Wo unzusammenhängende Dreiklänge neben einander treten, ist ihre Umbildung in Septimenakkorde häufig vorteilhaft, um eine bessere Verbindung herzustellen. Statt der zuletzt erwähnten Folge der Dreiklänge von indirekter Verwandtschaft:
f — a — c und g — h — d
kann man die Septimenakkorde auf einander folgen lassen, welche dieselben Klänge repräsentieren:
f — a — c — d und g — h — d — f.
Dann bleiben zwei Töne von den vieren unverändert; in dem F-Akkorde klingt noch das d der Oberdominantsaite an, in dem G-Akkorde das f.
In dieser Weise spielen die Septimenakkorde eine wichtige Rolle in der modernen Musik, um wohlverbundene und doch schnelle Fortschreitungen in den Akkorden möglich zu machen, deren forttreibende Kraft durch die Wirkung der Dissonanz noch gesteigert wird. Namentlich die Fortschreitungen nach der Unterdominantsaite lassen sich leicht so ausführen.
So können wir z. B., von dem Dreiklange g — h — d ausgehend, nicht bloß zum C-Akkorde c — e — g, sondern, indem wir das g als Septime liegen lassen, gleich zum Septimenakkorde a — c — e — g übergehen, der die beiden Dreiklänge c — e — g und a — c — e vereinigt, und können dann sogleich zu dem Verwandten des letzteren Akkordes, zu d — f — a, fortschreiten, so daß wir mit dem zweiten Schritte an die andere äußerste Grenze des übergreifenden C-Dursystems gelangen. Diese Fortschreitung gibt zugleich die beste Art der Bewegung für die Septime, indem die Septime (g des Beispiels) schon dem vorausgehenden Akkorde angehört, also vorbereitet eingeführt wird, und absteigend (nach f) sich auflösen kann. Versuchten wir dieselbe Bewegung rückwärts auszuführen, so müßten wir die Septime g aus dem a des Akkordes. d — f — a eintreten lassen, wären dann aber gezwungen, das c des Septimenakkordes springend einzuführen, weil wir eine verbotene Quintenparallele (d — a und c — g) erhalten würden, wollten wir es aus d absteigen lassen. Wir müssen es vielmehr aus dem f springend eintreten lassen, da das a des ersten Dreiklanges schon das a und das g des Septimenakkordes liefern muß. So erhalten wir also keine leicht fließende und natürliche Fortschreitung nach der Oberdominantseite hin; die Bewegung ist viel mehr gehindert, als wenn wir nach der Unterdominantseite fortschreiten. Demgemäß ist denn auch die regelmäßige und gewöhnliche Fortschreitung der Septimenakkorde die mit fallender Septime nach dem Dreiklange, dessen Quinte gleich dem Grundtone des Septimenakkordes ist. Wir können, wenn wir den Grundton des Septimenakkordes mit I bezeichnen, seine Terz mit III u. s. w., mit absteigender Septime folgende beiden Dreiklänge erreichen:
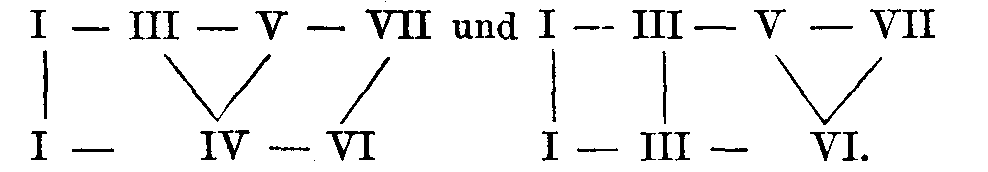
Von diesen beiden Fortschreitungen ist die erstere in den Dreiklang, dessen Grundton IV ist, die lebhaftere, insofern sie zu einem Akkorde mit zwei neuen Tönen führt. Die andere dagegen, zum Dreiklange des Grundtones VI, führt nur einen neuen Ton ein. Die erstere wird deshalb als die hauptsächlichste Auflösung der Septimenakkorde betrachtet, z. B.
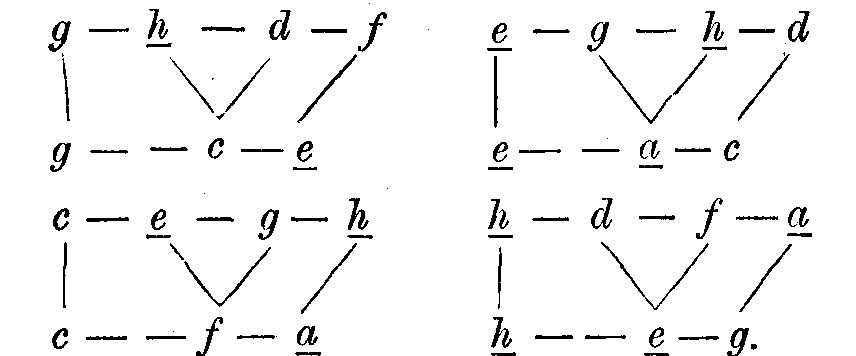
Durch das Absteigen des Tones VII wird der Ton VI eingeführt. Dieser ist im ersteren Falle Terz des neu eintretenden Dreiklanges, im zweiten Falle Grundton. Er kann auch Quinte sein. Das gibt die Fortschreitung:
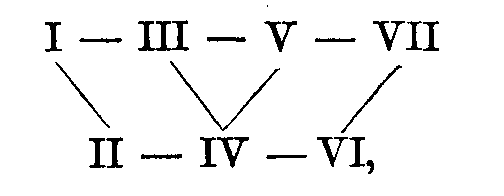
welche aber nur in den beiden Akkorden
c — e — g c — ![]() — g
— g
a — c — e ![]() — c —
— c — ![]()
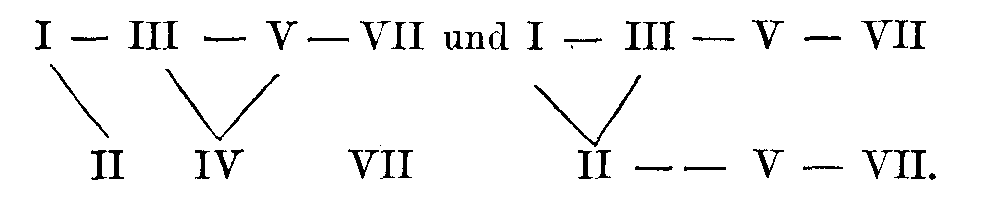
Im ersten wird die Septime Grundton, im zweiten Terz des neuen Akkordes. Wenn sie Quinte würde, fiele der neue Akkord ganz mit einem Teile des Septimenakkordes zusammen:
VII — III — V — VII.
Was endlich die Übergänge von einem Septimenakkorde zu einem anderen, oder zu einem dissonanten Dreiklange des verwendeten Systems betrifft, welchen man als einen abgekürzten Septimenakkord betrachten kann, so sind diese Sachen in den Lehrbüchern des Generalbasses genügend entwickelt und bieten keine prinzipiellen Schwierigkeiten dar, wegen deren wir bei ihnen verweilen müßten.
Dagegen haben wir noch einige Regeln zu besprechen, welche sich auf die Bewegung der einzelnen Stimmen in polyphonen Sätzen beziehen. Ursprünglich waren in solchen polyphonen Sätzen, wie wir oben auseinandergesetzt haben, alle Stimmen von gleicher Berechtigung, hatten auch gewöhnlich nach einander dieselben melodischen Figuren zu wiederholen. Die Harmonie war Nebensache, die melodische Bewegung der vereinzelten Stimmen Hauptsache. Es mußte deshalb dafür gesorgt werden, daß jede Stimme jeder anderen gegenüber selbständig und deutlich von ihr getrennt blieb. Das Verhältnis zwischen der Bedeutung der Harmonie und Melodie ist zwar in der neueren Musik wesentlich verändert worden; erstere hat eine viel höhere selbständige Bedeutung erhalten. Aber die rechte Vollendung erhält sie doch immer erst, wenn sie aus dem Zusammenklang mehrerer Stimmen entsteht, die auch jede für sich ihre schöne und klare melodische Fortschreitung haben, und deren Fortschreitung dem Hörer leicht verständlich bleibt.
Darauf beruht nun das Verbot der sogenannten Oktaven- und Quintenparallelen. Über den Sinn dieser Verbote ist viel gestritten worden. Der Sinn des Oktavenverbots hat sich durch die musikalische Praxis selbst klar gemacht. Man verbietet in polyphoner Musik zwei Stimmen, welche um eine oder zwei Oktaven von einander entfernt sind, so fortschreiten zu lassen, daß ihre Distanz beim nächsten Schritt dieselbe ist. Aber ebenso verbietet es sich in einem mehrstimmigen Satze zwei Stimmen durch einige Noten im Einklang fortgehen zu lassen, dagegen nicht für ganze musikalische Absätze zwei Stimmen, oder auch alle Stimmen in Einklängen und Oktaven zu vereinigen, um einen melodischen Gang kräftiger herauszuheben. Offenbar ist der Grund dieser Regel nur darin zu suchen, daß der Reichtum der Stimmenführung durch die Einklänge und Oktaven beschränkt wird. Das darf geschehen, wo es mit offener Absicht für eine melodische Phrase ausgeführt wird, aber nicht. im Laufe des Stückes für einige wenige Noten, wo es nur den Eindruck machen kann, als ob ein ungeschickter Zufall den Reichtum der Stimmführung beeinträchtigt. Die Begleitung einer unteren Stimme in der höheren Oktave verstärkt eben nur einen Teil des Klanges der unteren Stimme, und ist also, wo es auf die Mannigfaltigkeit der Stimmführung ankommt, von dem Einklange nicht wesentlich verschieden.
Nun steht in dieser Beziehung der Oktave die Duodecime am nächsten und deren untere Oktave die Quinte. An demselben Fehler der Oktavenparallelen nehmen daher auch die Duodecimenparallelen und Quintenparallelen Teil. Aber bei ihnen steht es noch schlimmer. Während man nämlich die Begleitung in Oktaven, wo sie dem Zwecke entspricht, durch eine ganze Melodie fortführen kann ohne einen Fehler zu begehen, kann man dies für die Quinten und Duodecimen nicht durchführen, ohne die Tonart zu verlassen. Man kann nämlich von der Tonica als Grundton mit Quintenbegleitung keinen einfachen Schritt machen, ohne die Tonart zu verlassen. In C-Dur würde man von der Quinte c — g nach aufwärts auf d — a kommen; der Tonleiter gehört aber nicht a, sondern das tiefere a an. Abwärts folgt h — fis. Der Ton fis fehlt der Leiter ganz. Die übrigen Schritte von d aufwärts bis a kann man allerdings in reinen Quinten innerhalb der Tonart ausführen. Es läßt sich also die klangverstärkende Begleitung in der Duodecime nicht konsequent durchführen. Andererseits aber erscheinen doch beide Intervalle, namentlich wenn sie um einige gleiche Schritte melodisch fortgehen, leicht nur als Klangverstärkung des Grundtones. Bei der Duodecime liegt dies darin, daß sie einem der Obertöne des Grundtones direkt entspricht. Bei der Quinte c — g erscheinen c und g als die beiden ersten Obertöne des Kombinationstones C, der die Quinte begleitet. Die Quintenbegleitung teilt also, wo sie vereinzelt innerhalb eines mehrstimmigen Satzes vorkommt, den Vorwurf der Eintönigkeit, und kann auch nicht konsequent als Begleitung gebraucht werden, ist also in allen Fällen zu vermeiden.
Daß übrigens die Quintenfolgen eben nur den Gesetzen der künstlerischen Komposition widersprechen und nicht dem natürlichen Ohre übelklingend sind, geht einfach aus dem Faktum hervor, daß alle Töne unserer Stimme und der meisten Instrumente von Duodecimen begleitet sind, auf welcher Begleitung der ganze Bau unseres Tonsystems beruht. Sobald also die Quinten als mechanisch dem Klange zugehörige Bestandteile erscheinen, haben sie ihre volle Berechtigung. So in den Mixturen der Orgel. In diesen Registern werden mit den Pfeifen, welche den Grundton des Klanges geben, auch immer andere angeblasen, welche die harmonischen Obertöne dieses Grundtones, Oktaven, Duodecimen in mehrfacher Wiederholung, auch wohl hohe Terzen geben. Man setzt, wie schon früher erwähnt wurde, auf diese Weise künstlich einen schärferen einschneidenderen Klang zusammen, als ihn die einfachen Orgelpfeifen mit ihren verhältnismäßig schwachen Obertönen geben. Nur durch dieses Mittel wird der Klang der Orgel ausreichend, den Gesang einer größeren Gemeinde zu beherrschen. Fast alle musikalischen Theoretiker haben sich gegen die Begleitung mit Quinten oder gar Terzen ereifert, aber glücklicher Weise gegen die Praxis des Orgelbaues nichts ausrichten können. In der Tat geben die Mixturen der Orgel keine andere Klangmasse, als Streichinstrumente oder Posaunen und Trompeten geben würden, wenn sie dieselbe Musik ausführten. Ganz anders würde es sein, wenn wir selbständige Stimmen hinstellen wollten, von denen wir dann auch eine selbständige Fortschreitung nach den Gesetzen der melodischen Bewegung, die in der Tonleiter gegeben sind, erwarten müssen. Solche selbständige Stimmen können sich nie mit der genauen Präzision eines Mechanismus bewegen, sie werden durch kleine Fehler ihre Selbständigkeit immer bald wieder verraten, und dann werden wir sie dem Gesetze der Tonleiter unterwerfen müssen, welches eine konsequente Quintenbegleitung unmöglich macht.
Das Verbot der Quinten und Oktaven erstreckt sich, aber mit minderer Strenge, auch auf die nächstfolgenden konsonanten Intervalle, namentlich wenn zwei derselben so zusammengestellt werden, daß sie eine zusammenhängende Gruppe aus den Obertönen eines Klanges bilden. So sind Folgen, wie
c — f — a
a — c' — f'.
Das Quintenverbot war vielleicht in der Geschichte der Musik eine Reaktion gegen die unvollkommenen ersten Versuche des mehrstimmigen Gesanges, der sich auf eine Begleitung in Quarten oder Quinten beschränkte; dann wurde es, wie jede Reaktion, in einer unproduktiven mechanischen Zeit übertrieben, und die Reinheit von Quintenparallelen wurde zu einem Hauptkennzeichen einer guten Komposition gemacht. Die neueren Harmoniker stimmen darin überein, daß man andere Schönheiten der Stimmführung nicht zerstören solle, weil Quintenparallelen darin vorkommen, wenn es auch rätlich ist sie zu vermeiden, so weit man nichts Anderes zu opfern braucht.
Das Verbot der Quinten hat übrigens noch eine andere Beziehung, auf welche Hauptmann aufmerksam gemacht hat. Man kommt nämlich nicht leicht in Versuchung Quintenfolgen zu machen, wenn man von einem konsonanten Dreiklange zu einem nahe verwandten übergeht, weil sich da näher liegende andere Fortschritte der Stimmen bieten. So zum Beispiel schreitet man vom C-Durdreiklange nach den vier verwandten Dreiklängen folgendermassen, indem der Fundamentalbaß um Terzen oder Quinten fortschreitet:
c — e — a c — f — a
c — e — g c — e — g
H — e— g H — d — g.
a — c' — e' oder f — a — c'.
e — a — c' oder a — c' — f',
Bei den durch nahe Verwandtschaft und geringsten Abstand in der Tonleiter eng verbundenen Akkorden fallen also die Quintenparallelen von selbst aus, sie sind, wo sie vorkommen, immer ein Zeichen jäher Akkordübergänge; und wenn man wirklich solche macht, ist es besser, die Fortschreitung der Stimmen derjenigen ähnlicher zu machen, welche im Übergange zu verwandten Akkorden von selbst entsteht.
Dieses von Hauptmann hervorgehobene Moment bei den Quintenfolgen erscheint allerdings geeignet, dem Gesetze noch einen weiteren Nachdruck zu leihen. Daß es nicht das einzige Motiv für das Quintenverbot ist, zeigt sich darin, daß die verbotene Folge
Man hat hieran das Verbot der sogenannten verdeckten Quinten und Oktaven wenigstens für die äußeren Stimmen eines mehrstimmigen Satzes geschlossen. Das Verbot sagt aus, daß die unterste und oberste Stimme eines Satzes nicht in gleichgerichteter Bewegung in die Konsonanz einer Oktave oder Quinte (Duodecime) übergehen sollen. Sie sollen vielmehr in eine solche Konsonanz nur in Gegenbewegung treten, die eine sinkend, die andere steigend. Dasselbe würde im zweistimmigen Satze für den Einklang gelten. Der Sinn dieses Gesetzes ist wohl nur der, daß jedesmal, wo die äußeren Stimmen sich in die Töne eines Klanges zusammenschließen, sie einen relativen Rahezustand gegen einander erreichen. Wo dies der Fall ist, erhält die Bewegung allerdings besseres Gleichgewicht, wenn die die ganze Tonmasse umschließenden Stimmen von entgegengesetzten Seiten ihrem Zusammenschluß sich nähern, als wenn der Schwerpunkt der Tonmasse durch gleichsinnige Bewegung der äußeren Stimmen verrückt wird, und diese, in verschiedener Geschwindigkeit fortschreitend, sich einholen. Wo aber die Bewegung in gleichem Sinne weiter geht, und kein Ruhepunkt beabsichtigt ist, werden auch die verdeckten Quinten nicht vermieden, wie in der gewöhnlichen Formel:
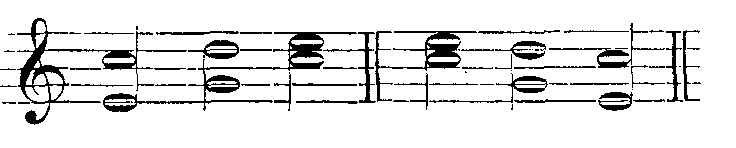
Eine andere Regel der Stimmführung, betreffend den sogenannten unharmonischen Querstand, ergab sich wohl zunächst aus dem Bedürfnis der Sänger. Was aber für den Sänger schwer zu treffen ist, muß natürlich auch dem Hörer immer als ein ungewöhnlicher und gezwungener Schritt erscheinen. Unter Querstand versteht man den Fall, wo zwei Töne zweier aufeinanderfolgenden Akkorde, die verschiedenen Stimmen angehören, falsche Oktaven oder Quinten bilden: also wenn im ersten Akkorde eine Stimme ein h hat, eine andere im zweiten ein b, oder die erste ein c, die andere ein cis. Der Quintenquerstand ist nur für die äußeren Stimmen verboten; er tritt z. B. ein, wenn im ersten Akkorde der Baß ein h, im zweiten der Sopran ein f hat, oder umgekehrt; h f eine falsche Quinte. Der Sinn der Regel für die falschen Oktaven ist wohl der, daß es dem Sänger schwer wird, den neuen Ton zu treffen, der aus der Tonleiter heraustritt, wenn er vorher von einer anderen Stimme den in der Leiter liegenden nächsten Ton ausführen hört. Ähnlich wenn er zur falschen Quinte eines in der gegenwärtigen Harmonie als oberster oder unterster stark heraustretenden Tones übergehen soll. Es liegt also ein gewisser Sinn in der Sache, aber Ausnahmen kommen genug vor, da das Ohr der neueren Musiker, Sänger und Hörer sich an kühnere Kombinationen und lebhaftere Bewegung gewöhnt hat. Alle diese Regeln beziehen sich wesentlich auf solche Musik, welche, wie die alte Kirchenmusik, in einem möglichst ruhigen, sanften und überall gut vermittelten, ohne absichtliche Kraftanstrengung im ebenmäßigsten Gleichgewicht fortlaufenden Flusse dahingleiten soll. Wo die Musik heftigere Anstrengung und Aufregung ausdrücken soll, verlieren diese Regeln ihren Sinn. Auch findet man sowohl verdeckte Quinten und Oktaven, als auch Querstände von falschen Quinten in Menge selbst bei dem als Harmoniker sonst so strengen Sebastian Bach in seinen Chorälen, in denen die Bewegung der Stimmung aber auch freilich viel kräftiger ausgedrückt ist, als in der alten italienischen Kirchenmusik.