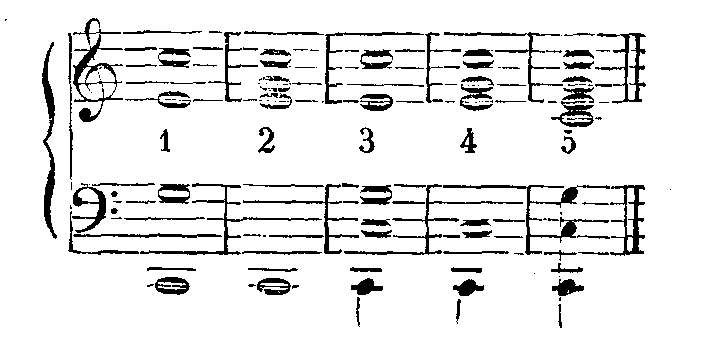
Die konsonanten Akkorde der Tonart.
Die erste Form, in welcher mehrstimmige Musik einen gewissen Grad künstlerischer Vollendung erreichte, war die der Polyphonie. Das eigentümlich unterscheidende Merkmal dieser Richtung beruht darin, daß mehrere Stimmen neben einander hergehen, deren jede eine selbständige Melodie führt, sei diese nun eine Wiederholung der von den anderen Stimmen vorher ausgeführten Melodien oder ganz verschieden von jenen. Unter diesen Umständen mußte nun jede Stimme dem allgemeinen Gesetze aller Melodiebildung, nämlich dem Gesetze der Tonalität, unterworfen sein, und zwar mußten sämtliche Töne des polyphonen Satzes sich notwendig auf dieselbe Tonica beziehen. Es mußte also jede Stimme an und für sich von der Tonica oder einem ihr nächstverwandten Tone ausgehen, und wieder in die Tonica zurückkehren. In der Tat ließ man anfangs alle Stimmen eines mehrstimmigen Satzes in die Tonica oder eine ihrer Oktaven zusammenlaufen. So war für jede Stimme das Gesetz der Tonalität erfüllt, aber man war gezwungen, einen polyphonen Satz unisono zu schließen.
Der Grund, warum höhere Oktaven die Tonica im Schlusse begleiten können, liegt, wie wir im vorigen Abschnitte gesehen haben, darin, daß die höhere Oktave nur eine Wiederholung eines Teils ihres Grundtones ist. Wenn wir also im Schlusse zur Tonica eine ihrer höheren Oktaven hinzusetzen, so tun wir nichts, als daß wir einen Teil ihres Klanges verstärken; es kommt dadurch kein neuer Klang dazu, der Zusammenklang enthält immer nur die Bestandteile des Klanges der Tonica.
Dasselbe gilt nun ebenso für andere Partialtöne des Klanges der Tonica. Der nächste Schritt in der Entwickelung des Schlußakkordes war, daß man die Duodecime der Tonica hinzufügte. Der Akkord c — c' — g' enthält keine Bestandteile, welche nicht auch Bestandteile des Klanges von c allein sind, und insofern wird jener Akkord ein Musikstück, dessen Tonica c ist, passend schließen können, indem der Akkord als Vertreter des einfachen Klanges von c gebraucht werden kann.
Ja auch der Akkord c' — g' — c" wird in demselben Sinne gebraucht werden können; denn wenn man ihn angibt, kommt, schwach freilich, aber doch hörbar, der Kombinationston c hinzu, und die ganze Klangmasse enthält dann wieder nur Bestandteile des Klanges c. Freilich würde diese Zusammensetzung schon einer ungewöhnlicheren Klangfarbe mit verhältnismäßig schwachem Grundtone entsprechen.
Dagegen kann als Schluß eines Satzes, dessen Tonica c ist, der Zusammenklang c — c' — f' oder c' — f' — c" nicht gebraucht werden, obgleich diese Akkorde eben so gut konsonant sind wie die vorher genannten, weil das f nicht Bestandteil des Klanges c ist, und deshalb im Schlusse neben dem Klange der Tonica etwas Fremdartiges stehen bleiben würde. Wahrscheinlich ist in dieser Tatsache der Grund zu suchen, warum einige Theoretiker des Mittelalters die Quarte zu den Dissonanzen rechnen wollten. Im Schlußakkorde ist aber die Reinheit der Konsonanz noch nicht genügend, um ein Intervall anwendbar zu machen. Es kommt noch eine zweite Bedingung hinzu, über welche die Theoretiker sich nicht klar geworden waren, die Töne des Schlußakkordes müssen Bestandteile des Klanges der Tonica sein; sonst sind sie nicht zu brauchen.
Wie die Quarte ist die Sexte der Tonica im Schlußakkorde nicht anwendbar, wohl aber die große Terz, da diese wieder im Klange der Tonica vorkommt, dessen fünften Partialton sie bildet. Da die musikalisch brauchbaren Klangfarben den fünften und sechsten Partialton zwar gewöhnlich noch hören lassen, die höheren aber gar nicht mehr oder wenigstens nur sehr unvollkommen, von diesen höheren Obertönen außerdem der nächstfolgende, nämlich der siebente dissonant zum fünften, sechsten und achten ist, und in der Leiter fehlt, so hört mit der Terz die Reihe der brauchbaren Töne des Schlußakkordes auf. So finden wir denn auch in der Tat in den Schlußakkorden bis zum Anfange des achtzehnten Jahrhunderts hin teils Akkorde ohne Terzen, teils Durakkorde mit großen Terzen gebraucht, letztere auch in solchen Tongeschlechtern, deren Leiter die kleine, nicht die große Terz der Tonica enthält. Um der Vollstimmigkeit willen zog man es vor die Konsequenz der Tonleiter zu verletzen, indem man die große Terz im Schlußakkorde auftreten ließ. Die kleine Terz der Tonica kann niemals als Bestandteil in dem Klange der letzteren auftreten. Sie war also ursprünglich eben so gut verboten, wie die Quarte und Sexte der Tonica. Es mußte erst eine neue Seite des harmonischen Gefühls ausgebildet werden, ehe Mollakkorde als Schluß zulässig erschienen.
Der Schluß in einem Durakkorde erscheint um so genügender, je mehr in der Lage der Töne des Akkordes die Anordnung der Partialtöne eines Klanges nachgeahmt ist. Da. in der neueren Musik die Oberstimme, als die hervortretendste von allen, die Hauptmelodie zu führen pflegt, muß diese der Regel nach in der Tonica enden. Mit Berücksichtigung dieses Umstandes kann man für den Schluß Akkorde wie die folgenden brauchen, deren Kombinationstöne in Viertelnoten hinzugefügt sind:
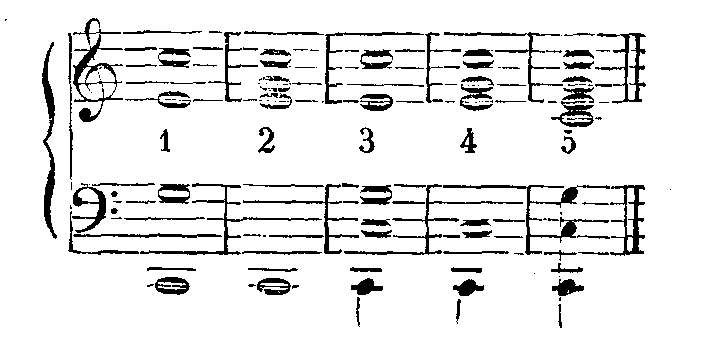
Ebenso wie die Tonica als Baßton ihres Durakkordes am Schluß diesem Akkorde eine Ähnlichkeit mit ihrem eigenen Klange gibt, und dadurch als wesentlichster Ton des Akkordes heraustritt, geschieht dies auch mit den übrigen Durakkorden, wenn der tiefste Ton der engsten Lage ihres Dreiklanges Grundton ist. Die anderen in der Durtonleiter liegenden Durakkorde sind die auf der Quarte und Quinte der Tonart, also in C-Dur F— A — C und G — H — D. Läßt man also die Harmonie des Stückes sich nur in diesen Durakkorden bewegen, den Grundton immer im Baß, so stellt sie bis zu einem gewissen Grade den Klang der Tonica dar, welcher wechselt mit den beiden nächstverwandten Klängen, denen der Quarte und Quinte der Tonica. Dadurch erhält eine solche Harmonisierung eine sehr klare Durchsichtigkeit und Geschlossenheit, wenn sie auch für längere Stücke zu einförmig wird. Dieser Art ist bekanntlich der Bau der modernen populären Tonstücke, der Volkslieder und Tänze. Das Volk und überhaupt Leute von geringer musikalischer Bildung verlangen möglichst einfache und verständliche Verhältnisse von der Musik, die ihnen gefallen soll. Nun gibt sich aber überhaupt in der harmonischen Musik die Verwandtschaft der Töne dem Gefühle viel leichter und entschiedener zu erkennen, als in der homophonen Musik. In der letzteren beruht das Gefühl für Tonverwandtschaft eben nur darin, daß die Tonhöhe zweier Partialtöne in zwei auf einander folgenden Klängen gleich ist. Wenn wir aber den zweiten hören, können wir uns des ersten nur noch erinnern, und mittels der Erinnerung müssen wir die Vergleichung vollziehen. In der Konsonanz ist dagegen die Verwandtschaft durch unmittelbare Sinnesempfindung gegeben; da sind wir nicht mehr auf die Erinnerung angewiesen, sondern wir hören Schwebungen, der Zusammenklang wird rauh, so wie die richtigen Verhältnisse nicht eingehalten sind. Und wiederum, wenn zwei Akkorde auf einander folgen, welche eine gemeinsame Note haben, so beruht die Anerkennung ihrer Verwandtschaft nicht auf der Vergleichung schwacher Obertöne, sondern auf der Vergleichung zweier selbständig angegebenen Noten, welche dieselbe Tonstärke, wie die übrigen Noten des betreffenden Akkordes haben.
Wenn ich also zum Beispiel von C nach seiner Sexte Asteige, so erkenne ich in einer einstimmigen Melodie die Verwandtschaft beider dadurch, daß der fünfte Oberton von C, der schon ziemlich schwach ist, dem dritten von A gleich ist. Wenn ich aber das A mit dem Akkorde F — A — c begleite, so höre ich das frühere c in dem Akkorde kräftig fortklingen, und nehme in unmittelbarer Empfindung wahr, daß A und C konsonant sind, daß beide Bestandteile desselben F Klanges sind.
Wenn ich von C nach H oder D in einstimmigem Gesange melodisch übergehe, muß ich mir eine Art von stummem G dazwischen denken, um ihre Verwandtschaft, welche nur zweiten Grades ist, anzuerkennen. Lasse ich aber neben beiden Noten das G wirklich erklingen, so wird wiederum ihre gemeinsame Verwandtschaft mit G meinem Ohre unmittelbar fühlbar gegeben.
Die Gewöhnung an die sehr deutlich ausgesprochenen Tonverwandtschaften der harmonischen Musik hat einen unverkennbaren Einfluß auf unseren musikalischen Geschmack ausgeübt. Einstimmiger Gesang will uns nicht mehr recht gefallen, er erscheint uns leer und unvollkommen. Wenn auch nur das Klimpern einer Gitarre die Grundakkorde der Tonart hinzufügt, und die harmonischen Verwandtschaften der Töne andeutet, fühlen wir uns dagegen befriedigt. Andererseits läßt sich nicht verkennen, daß eben wegen der deutlicheren Wahrnehmung der Tonverwandtschaften in der harmonischen Musik eine viel größere Mannigfaltigkeit musikalischer Beziehungen zwischen den Tönen gewonnen worden ist, weil auch ihre schwächeren Verwandtschalten benutzt werden können, und daß der Aufbau größerer musikalischer Sätze erst dadurch möglich wurde, weil der größere Bau auch stärkere Bänder fordert, um ihn zusammenzuhalten.
Die möglichst engste und einfachste Beziehung der Töne wird nun in der Durtonart gewonnen, wenn alle Töne der Melodie als Teile des Klanges teils der Tonica, teils ihrer oberen und unteren Quinte erscheinen. Dadurch werden alle Verwandtschaften der Töne zurückgeführt auf die engsten und nächsten Verwandtschaften, die es im musikalischen Systeme überhaupt gibt, nämlich auf das Verwandtschaftsverhältnis der Quinte.
Die Beziehung des Akkordes der Oberquinte G zu dem der Tonica C ist einigermaßen verschieden von dem der Unterquinte F zum tonischen Akkorde. Wenn ich von C — E — G fortschreite zu G — H — d, so wende ich mich zu einem Klange hin, welcher schon in dem ersten Akkorde mitgehört und dessen Eintritt daher wohl vorbereitet worden ist, während ich gleichzeitig durch diesen Schritt zu denjenigen Tonstufen der Tonart hingelange, welche von der Tonica am entferntesten sind und nur eine indirekte Verwandtschaft zu dieser haben. Der genannte Übergang gibt also eine sehr entschiedene Fortbewegung in der Harmonie, die doch durchaus gesichert und gut motiviert ist. Umgekehrt ist es mit dem Schritte von C — E — G nach F — A — c. Der F-Klang ist in dem ersten Akkorde nicht vorbereitet, er muß neu gefunden und eingesetzt werden. Als richtig und eng verwandt rechtfertigt sich dieser Schritt eigentlich erst, wenn er gemacht worden ist, dadurch, daß man in dem F-Akkorde lauter Töne findet, die der Tonica direkt verwandt sind. Es fehlt also im Übergange zu dem letzteren Akkorde das Gefühl entschiedenen und sicheren Fortschritts, welches in dem Übergange vom C- zum G-Dreiklange liegt. Dagegen kommt ihm eine Art weicherer und ruhigerer Schönheit zu, wohl weil er innerhalb der direkt verwandten Töne der Tonica bleibt. Bevorzugt aber wird namentlich in populärer Musik der erstgenannte Schritt nach der Oberquinte, die man deshalb auch die Dominante der Tonart nennt, und es bewegen sich viele einfachere Lieder und Tänze nur in dem Wechsel des tonischen und dominanten Akkordes. Daher denn auch die dafür eingerichtete gewöhnliche Harmonika beim Ausziehen des Blasebalges den Akkord der Tonica, beim Zusammendrücken den der Dominante zu geben pflegt. Die Unterquinte der Tonica heißt dagegen die Subdominante der Tonart. Ihr Akkord pflegt in den gewöhnlichen populären Melodien seltener einzutreten, gewöhnlich vor dem Schlusse einmal, um das Gleichgewicht der Harmonie, welche sich von der Tonica meist nur nach der Seite der Dominante hin bewegt, auch nach der anderen Seite wieder herzustellen.
Wenn ein Absatz eines Tonstückes so endet; daß man von dem Dominantenakkorde zum tonischen übergeht, und dieser den Schluß bildet, so nennen dies die Musiker einen Ganzschluß. Man kehrt hierin von denjenigen Tönen, welche die schwächste Verwandt Schaft innerhalb der Tonart zur Tonica haben, und ihr daher am fremdesten sind, zur Tonica zurück. Dies ist also eine entschieden ausgesprochene Bewegung von den entferntesten Teilen in den, Mittelpunkt des Systems zurück, wie sie am Schlusse eintreten muß. Geht man aber von dem Akkorde der Subdominante in den tonischen als Schlußakkord über, so nennt man dies einen Halbschluß (Plagalschluß). Die Töne des Subdominantdreiklanges sind alle der Tonica direkt verwandt. In diesem Dreiklange befinden wir uns der Tonica schon sehr nahe, ehe wir in sie übergehen. Der Halbschluß entspricht einem ruhigeren Auslaufen des Tonsatzes in die Tonica zurück, und hat weniger entschiedene Bewegung.
Im Ganzschlusse hört man nur den Akkord der Dominante und Tonica; um das Gleichgewicht auch nach der Seite der Subdominante herzustellen, läßt man ihm noch den Subdominantenakkord vorausgellen, wie in l oder 2.
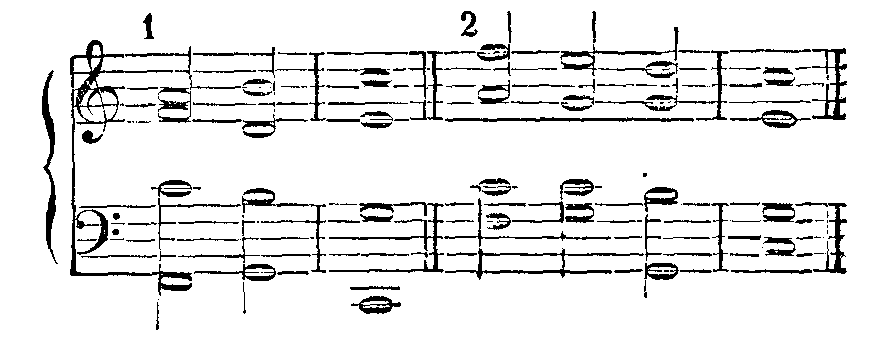
In der Durtonart lassen sich, wie wir gesehen haben, die Forderungen der Tonalität mit denen harmonischer Vollstimmigkeit am leichtesten und vollständigsten vereinigen. Die Töne ihrer Leiter können harmonisch alle verwendet werden als Bestandteile des Klanges der Tonica, ihrer oberen und ihrer unteren Quinte, weil die genannten drei Haupttöne der Tonart auch zugleich Grundtöne von Durakkorden sind. Das ist nicht in gleichem Maße der Fall in den
l. Durgeschlecht:
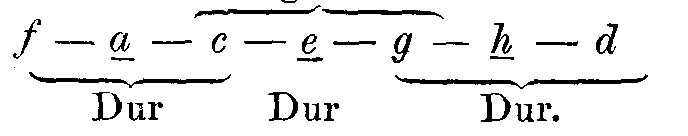
2. Quartengeschlecht:
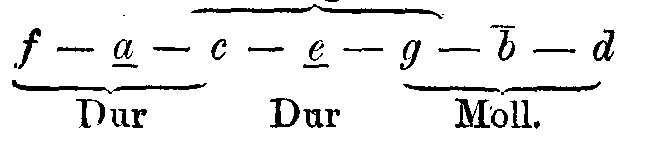
3. Septimengeschlecht:
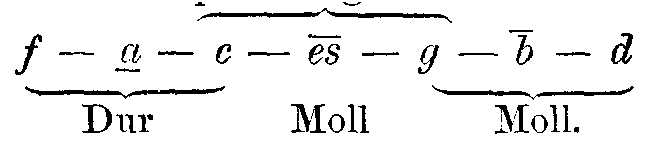
4. Terzengeschlecht (Moll):
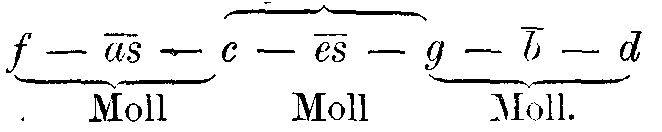
5. Sextengeschlecht:
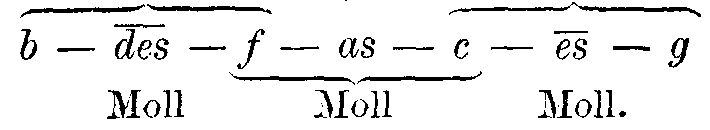
In den Mollakkorden liegt die Terz außerhalb des Klanges des Grundtones, sie kann nicht als Bestandteil dieses Klanges auftreten, und ihre Beziehung zu diesem ist deshalb nicht so unmittelbar verständlich wie die der Durterz, was namentlich im Schlußakkorde hinderlich wird. Daher findet man denn auch die modernen populären Tanzstücke und Lieder so überwiegend in Durtonarten geschrieben, daß solche in Molltonarten fast nur noch seltene Ausnahmen bilden. Das Volk verlangt eben die klarste und einfachste Verständlichkeit in seiner Musik, und diese gibt die Durtonart. In der homophonen Musik existierte ein solches Übergewicht der Durtonart durchaus nicht. Eben deshalb finden wir die harmonische Begleitung der Choräle, welche in einer Durtonart geschrieben sind, schon im 16. Jahrhundert ziemlich vollständig ausgebildet, so daß viele derselben auch dem modern gebildeten musikalischen Gefühle vollständig entsprechen, während die harmonische Behandlung der Molltonart oder der übrigen Kirchentonarten in derselben Zeit noch sehr schwankend war, und uns jetzt ziemlich fremdartig vorkommt.
In einem Durakkorde c — e — g können wir g und e als Bestandteile des c-Klanges ansehen, aber weder c noch g als Bestandteile des e-Klanges, und weder c noch e als solche des g-Klanges. Der Durakkord c — e — g ist also ganz eindeutig, er kann nur mit dem Klange des c verglichen werden, und deshalb ist c der herrschende Ton in dem Akkorde, sein Grundton, oder nach Rameau's Bezeichnung sein Fundamentalbaß, und keiner der beiden anderen Töne des Akkordes hat das geringste Recht, diese Stelle einzunehmen.
Im Mollakkorde c — ![]() —
g ist g ein Bestandteil des c-Klanges und des
—
g ist g ein Bestandteil des c-Klanges und des ![]() -Klanges.
Weder es noch c kommt in einem der beiden anderen
Klänge vor. Es ist also g jedenfalls ein abhängiger Ton.
Dagegen kann man den genannten Mollakkord einmal als einen c-Klang
betrachten, dem der fremde Ton
-Klanges.
Weder es noch c kommt in einem der beiden anderen
Klänge vor. Es ist also g jedenfalls ein abhängiger Ton.
Dagegen kann man den genannten Mollakkord einmal als einen c-Klang
betrachten, dem der fremde Ton ![]() hinzugefügt ist, oder als einen
hinzugefügt ist, oder als einen ![]() -Klang,
dem der Ton c hinzugefügt ist. Beide Fälle kommen
vor. Es ist aber die erstere Deutung die gewöhnliche und vorwiegende.
Denn wenn wir den Akkord als c-Klang betrachten, so finden wir in
ihm das g als dritten Partialton, und nur statt des schwächeren
fünften Partialtones e den fremden Ton
-Klang,
dem der Ton c hinzugefügt ist. Beide Fälle kommen
vor. Es ist aber die erstere Deutung die gewöhnliche und vorwiegende.
Denn wenn wir den Akkord als c-Klang betrachten, so finden wir in
ihm das g als dritten Partialton, und nur statt des schwächeren
fünften Partialtones e den fremden Ton ![]() .
Fassen wir den Akkord aber als
.
Fassen wir den Akkord aber als ![]() -
Klang, so ist zwar der schwache fünfte Partialton durch das grichtig
vertreten, statt des stärkeren dritten, welcher
-
Klang, so ist zwar der schwache fünfte Partialton durch das grichtig
vertreten, statt des stärkeren dritten, welcher ![]() sein sollte, finden wir aber den fremden Ton c. In der Regel finden
wir deshalb den Mollakkord c —
sein sollte, finden wir aber den fremden Ton c. In der Regel finden
wir deshalb den Mollakkord c — ![]() — g in der modernen Musik so gebraucht, daß c als
sein Grundton oder Fundamentalbaß behandelt ist, und der Akkord einen
etwas veränderten oder getrübten c-Klang vertritt, aber
es kommt der Akkord in der Lage
— g in der modernen Musik so gebraucht, daß c als
sein Grundton oder Fundamentalbaß behandelt ist, und der Akkord einen
etwas veränderten oder getrübten c-Klang vertritt, aber
es kommt der Akkord in der Lage ![]() —
g — c (besser
—
g — c (besser ![]() —
g
— c) auch in der
—
g
— c) auch in der ![]() -Durtonart
vor, als Vertreter des Akkordes der Subdominante
-Durtonart
vor, als Vertreter des Akkordes der Subdominante ![]() .Rameau
nennt ihn dann den Akkord der großen Sexte, und betrachtet richtiger,
als die neueren Theoretiker meist tun,
.Rameau
nennt ihn dann den Akkord der großen Sexte, und betrachtet richtiger,
als die neueren Theoretiker meist tun, ![]() als seinen Fundamentalbaß.
als seinen Fundamentalbaß.
In den Fällen nun, wo es darauf ankommt, die eine oder andere dieser Deutungen des Mollakkordes bestimmt festzustellen, kann man dies dadurch erreichen, daß man den Grundton teils durch seine tiefe Lage, teils durch die Zahl der auf ihn vereinigten Stimmen hervorhebt. Die tiefe Lage des Grundtones läßt diejenigen Töne, welche in seinen Klang hineinpassen, direkt als Partialtöne desselben erscheinen, während er selbst nicht einem viel höher liegenden anderen Tone als Partialton zugeeignet werden kann. Namentlich in der ersten Hälfte des vorigen Jahrhunderts, wo man zuerst anfing, Mollakkorde am Schlusse zu gebrauchen, suchen die Komponisten die Tonica auch durch bedeutende Tonstärke vor ihrer Terz hervorzuheben. So findet man in Händel's Oratorien regelmäßig, daß, wo er mit einem Mollakkorde schließt, die meisten der hervortretenden Gesang- und Instrumentalstimmen auf die Tonica konzentriert werden, während die Moll-Terz entweder nur von einer dieser Stimmen, oder auch wohl nur von dem begleitenden Klaviere, beziehlich der Orgel, angegeben wird. Es sind bei ihm in den Molltonarten die Fälle viel seltener, wo nur zwei Stimmen die Tonica im Schlußakkorde nehmen, eine deren Quinte, eine die Terz, als in den Durtonarten, wo diese Verteilung Regel ist.
Wenn der Mollakkord in seiner zweiten untergeordneten Bedeutung erscheint
als ![]() — g — c mit dem Grundtone es, wird das es als Grundton teils durch
die Lage im Basse, teils durch Beine nahe Verwandtschaft zur Tonica
— g — c mit dem Grundtone es, wird das es als Grundton teils durch
die Lage im Basse, teils durch Beine nahe Verwandtschaft zur Tonica ![]() hervorgehoben. Noch deutlicher bezeichnet die moderne Musik diese Deutung
des Akkordes, indem sie auch
hervorgehoben. Noch deutlicher bezeichnet die moderne Musik diese Deutung
des Akkordes, indem sie auch ![]() als Quinte von
als Quinte von ![]() hinzusetzt, so daß der Akkord dissonant wird in der Form
hinzusetzt, so daß der Akkord dissonant wird in der Form ![]() — g —
— g —![]() —
— ![]() .
.
Das Sträuben der älteren Komponisten, mit einem Mollakkorde zu schließen, läßt sich teils durch die von falschen Kombinationstönen herrührende Trübung der Konsonanz dieses Akkordes erklären, teils aus dem eben besprochenen Umstande, wonach der Mollakkord den Klang der Tonica nicht rein wiedergibt, sondern mit anderen, diesem Klange fremden Tönen gemischt. Zu der Terz, welche in den Klang der Tonica nicht hineinpaßt, kommen noch die Kombinationstöne, welche es ebenfalls nicht tun. So lange das Gefühl der Tonalität nur in dem Sinne gefaßt wurde, daß ein bestimmter einzelner Ton oder Klang als verbindendes Zentrum der Tonart angesehen wurde, konnte man in der Tat keinen genügenden Schluß bilden, wenn dieser Schluß nicht einfach und rein den Klang der Tonica darstellte und nichts diesem Klange Fremdes enthielt. Es war erst eine weitere Ausbildung des musikalischen Gefühls für die selbständige Bedeutung der Akkorde in der Tonart nötig, ehe der Mollakkord, trotz seiner dem Klange der Tonica fremden Bestandteile, als berechtigt im Schlusse erscheinen konnte.
Hauptmann1) gibt eine andere Erklärung für
die Vermeidung des Mollakkordes im Schlusse. Er behauptet, ehe man Septimenakkorde
gebraucht habe, sei keine Stimme dagewesen, welche passend in die kleine
Terz übergehen konnte. Wenn nämlich die Schlußkadenz aus
den Akkorden G — H — D und C — ![]() — G besteht, hätte nur das D des ersten Akkordes in das
— G besteht, hätte nur das D des ersten Akkordes in das ![]() des zweiten melodiös fortschreiten können, dies hätte aber
wie der Fortschritt des Leittones D in der
des zweiten melodiös fortschreiten können, dies hätte aber
wie der Fortschritt des Leittones D in der ![]() - Durtonart auf seinen Grundton
- Durtonart auf seinen Grundton ![]() geklungen, und das Gefühl von
geklungen, und das Gefühl von ![]() -Dur
erweckt. Wenn wir auch zugeben wollen, daß ein solches Leittonverhältnis
die Aufmerksamkeit des Hörers auf die betreffenden beiden Töne
besonders hinleitet und in gewissem Grade das Gefühl der Tonart stören
könnte, so
-Dur
erweckt. Wenn wir auch zugeben wollen, daß ein solches Leittonverhältnis
die Aufmerksamkeit des Hörers auf die betreffenden beiden Töne
besonders hinleitet und in gewissem Grade das Gefühl der Tonart stören
könnte, so
hätten sich doch wohl auch ohne Septimenakkorde mancherlei Formen der Stimmführung durch Dissonanzen hindurch finden lassen, um zu der kleinen Terz des Schlußakkordes hinzugelangen, wenn diese Bedürfnis gewesen wäre. Namentlich ist in dem sonst so häufig gebrauchten Plagalschlusse
c — ![]() — g — c
— g — c
F — f — ![]() — c
— c
C — ![]() — g — c
— g — c
die Überleitung der Quarte f zur Mollterz ![]() ohne allen Anstoß. Und vollends als man die Septimenakkorde zu gebrauchen
anfing, hätte sich doch die Septime F des Akkordes G
— H — D — F notwendig in die Terz Es des Schlußakkordes
auflösen sollen. Aber im Gegenteil, wo sie in Sätzen aus dem
15. Jahrhundert vorkommt2), läßt man sie entweder
aufsteigen in die Quinte des Schlußakkordes, oder absteigen zur großen
Terz E, wie es bis auf Bach's. Zeiten blieb.
ohne allen Anstoß. Und vollends als man die Septimenakkorde zu gebrauchen
anfing, hätte sich doch die Septime F des Akkordes G
— H — D — F notwendig in die Terz Es des Schlußakkordes
auflösen sollen. Aber im Gegenteil, wo sie in Sätzen aus dem
15. Jahrhundert vorkommt2), läßt man sie entweder
aufsteigen in die Quinte des Schlußakkordes, oder absteigen zur großen
Terz E, wie es bis auf Bach's. Zeiten blieb.
Wir haben im dreizehnten Abschnitte die neuere harmonische Musik der mittelalterlichen polyphonen gegenüber dadurch charakterisiert, daß sie das Gefühl für die selbständige Bedeutung der Akkorde entwickelt habe. In der Tat finden wir auch schon bei Palestrina, Gabrieli, noch mehr bei Monteverde und den ersten Opernkomponisten die verschiedenen Abstufungen des Wohlklanges der Akkorde sorgfältig für die Zwecke des Ausdruckes benutzt. Aber es fehlt bei den genannten Meistern noch fast jede Rücksicht auf die Verwandtschaft der einander folgenden Akkorde unter sich. Diese folgen einander oft in ganz unzusammenhängenden Sprüngen, und das einzige Band, welches sie verbindet, ist die Tonart, ans deren Tonstufen sie alle gebildet sind.
Die Umänderung nun, welche vom 16. Jahrhundert bis zum Anfang des 18. vor sich ging, kann man, glaube ich, so definieren, daß sich das Gefühl für die selbständige Verwandtschaft der Akkorde unter einander ausbildete, und daß nun auch für die Reihe konsonanter Akkorde, welche die Tonart zuläßt, ein gemeinsam verknüpfendes Zentrum in dem tonischen Akkorde gesucht und gefunden wurde. Es wiederholte sich hier für die Akkorde dasselbe Streben, welches in der Konstruktion der Tonleitern sich früher geltend gemacht hatte. Auch zwischen den Tonstufen der Leiter hatte man Verwandtschaft gesucht, erst eine kettenweise, dann eine solche, welche auf ein einziges Zentrum, die Tonica, zusammenlief.
Direkt verwandt nenne ich zwei Akkorde, welche einen odermehrere Töne gemein haben.
Im zweiten Grade verwandt sind Akkorde, welche beide mit demselben konsonanten Akkorde direkt verwandt sind.
Also c — e — g und g — h — d sind direkt verwandt, ebenso c — e — g und a — c —e; aber g — h — d und a — c — esind im zweiten Grade verwandt.
Wenn zwei Töne zweier Akkorde identisch sind, ist ihre Verwandtschaft eine engere, als wenn nur ein Ton es ist. Also sind c — e — g und a — c — e enger verwandt, als c — e — g und g — h — d.
Als tonischer Akkord innerhalb eines Tongeschlechts kann natürlich immer nur einer gewählt werden, der mehr oder weniger gut den Klang der Tonica darstellt, also derjenige Dur- oder Mollakkord, dessen Grundton die Tonica ist. Denn ebenso wie die Tonica als verbindendes Zentrum der Töne in einer normal gebildeten einstimmigen Melodie auf dem ersten akzentuierten Taktteile des Anfanges und am Schlusse gehört werden muß, so daß die Melodie von ihr ausgeht und zu ihr zurückkehrt, so gilt dasselbe auch für den tonischen Akkord innerhalb der Akkordkette. Wir verlangen an den beiden genannten Stellen des Satzes nicht bloß die Tonica zu hören, diese von einem beliebigen Akkorde begleitet, sondern wir lassen an beiden Orten als Begleitung der Tonica durchaus nur den tonischen Akkord zu, dessen Grundton die Tonica ist. Noch im 16. Jahrhundert war es anders, wie das oben Seite 407 zitierte Beispiel von Palestrina zeigt.
Wenn der tonische Akkord ein Durakkord ist, so vereinigt sich die Herrschaft der Tonica über die Töne ohne alle Schwierigkeit mit den Bedingungen der Herrschaft des tonischen Akkordes über die Akkorde. Denn indem das Stück mit dem tonischen Akkorde beginnt und endet, beginnt und endet es zugleich mit dem reinen unvermischten Klange der Tonica. Wenn der tonische Akkord dagegen ein Mollakkord ist, so läßt sich nicht so vollständig allen Bedingungen zugleich genügen. Man muß etwas von der Strenge der Tonalität nachlassen, um die Mollterz des tonischen Akkordes im Anfang und Schluß zulassen zu können. Wir finden noch bei Sebastian Bach im Anfange des 18. Jahrhunderts den Mollakkord zwar am Ende seiner Präludien, weil diese nur einleitende Stücke waren, aber nicht am Ende der Fugen, der Choräle und anderer endgültig schließender Sätze gebraucht. Bei Händel und selbst in den kirchlichen Kompositionen von Mozart ist der Schluß mit dem Mollakkorde abwechselnd gebraucht mit solchen Schlüssen, welche entweder gar keine Terz oder die Durterz enthalten. Und bei dem letztgenannten Komponisten kann man das auch keineswegs für eine äußerliche Nachahmung der alten Sitte erklären. Denn es ist immer wesentlich der Ausdruck des Stückes beachtet. Wenn am Schlusse eines Satzes, der in einer Molltonart sich bewegt, zuletzt ein Durakkord eintritt, so klingt dies immer wie eine plötzliche und unerwartete Aufhellung, des trüben Charakters der Molltonart; ein solcher Schluß erscheint nach der Sorge, dem Kummer, der Unruhe des Mollsatzes erheiternd, aufklärend und versöhnend. Also wo die Bitte um Frieden für die Entschlafenen in den Worten endet: "Et lux perpetua luceat eis", oder das Confutatis maledictis mit der Bitte schließt:
Zu einem künstlerisch zusammenhängenden Harmoniegewebe werden diejenigen Tongeschlechter am meisten geeignet sein, welche die größte Zahl unter sich und mit dem tonischen Akkorde verwandter konsonanter Akkorde liefern können. Da alle konsonanten Akkorde in engster Lage und einfachster Form Dreiklänge sind, welche aus einer großen und einer kleinen Terz zusammengesetzt sind, so finden wir sämtliche konsonante Akkorde einer Tonart einfach dadurch, daß wir alle ihre Tonstufen nach Terzen ordnen, was in folgender Übersicht geschehen ist. Die Klammern fassen die einzelnen konsonanten Dreiklänge zusammen; der tonische Akkord ist durch stärkeren Druck ausgezeichnet.
l) Durgeschlecht:
![]()
2) Quartengeschlecht:
![]()
3) Septimengeschlecht:
![]()
4) Terzengeschlecht:
![]()
5) Sextengeschlecht:
![]()
In dieser Übersicht sind die verschiedenen Stimmungen der Secunde und Septime der Tonart berücksichtigt, welche wir in der Konstruktion der Tonleitern für die homophone Musik gefunden haben. Wir bemerken nun aber hier, daß schon die dem tonischen Akkorde direkt verwandten Akkorde jeder Tonart sämtliche Tonstufen der Leiter enthalten, mit Ausnahme des Sextengeschlechts. Secunde und Septime der Tonica kommen erstens im g-Akkorde vor, der dem tonischen direkt verwandt ist, und zweitens in Akkorden, welche F enthalten, die aber dem tonischen nicht direkt verwandt sind. Dadurch erhalten in der harmonischen Musik die der Dominante verwandten Fülltöne der Leiter ein bedeutendes Übergewicht über die der Subdominante verwandten. Wo direkte Verwandtschaften der Akkorde zur Bestimmung der Tonstufen genügen, werden wir diese den indirekten vorziehen müssen. Beschränken wir uns also auf diejenigen Akkorde, die dem tonischen direkt verwandt sind, so erhalten wir folgende Übersicht der Tongeschlechter:
1) Durgeschlecht:
![]()
2) Quartengeschlecht:
![]()
3) Septimengeschlecht:
![]()
4) Terzengeschlecht:
![]()
5) Sextengeschlecht:
![]()
Ein Blick auf diese letztere Übersicht zeigt, daß die vollständigsten und geschlossensten Akkordreihen dem Durgeschlecht und dem Terzengeschlecht (Moll) zukommen, so daß für die harmonische Behandlung diese beiden entschieden brauchbarer sind als die übrigen Geschlechter. Dies ist auch der Umstand, auf welchem ihre Bevorzugung in der modernen harmonischen Musik beruht.
Dadurch wird nun auch die Stimmung der Fülltöne der Leiter,
wenigstens für die ersten vier Geschlechter, endgültig festgestellt.
Hauptmann betrachtet, wie ich meine, mit Recht als wesentlichen Bestandteil
der G-Dur- und C- Molltonleiter nur den Ton D,
welcher mit F eine unreine Terz bildet, so daß der
Accord D — F — A als dissonant betrachtet werden
muß. Dieser Akkord, in der genannten Stimmung ausgeführt, ist
in der Tat sehr entschieden dissonant. Dagegen läßt Hauptmann
eine
nach der Unterdominantseite übergreifende Durtonart zu, welche statt
D den Ton D enthält. Ich halte diese Art der
Darstellung für einen sehr glücklich gewählten Ausdruck
des wahren Sachverhältnisses. Wenn der konsonante Akkord
D
— F — A in einem Satze auftritt, kann man nicht unmittelbar
und ohne Zwischenstufe in den tonischen Akkord G — E— G zurückkehren.
Es würde das immer ein unvermittelter harmonischer Sprung sein. Es
ist also ein richtiger Ausdruck der Sachlage, wenn dies als eine beginnende
Modulation über die Grenzen der C-Durtonart, über die
Grenzen der direkten Verwandtschaft ihres tonischen Akkordes hinaus betrachtet
wird. In der Molltonart würde dem die Modulation in den Akkord ![]() —
F —
—
F — ![]() entsprechen.
Freilich wird in der modernen temperierten Stimmung der konsonante Akkord
D — F — A von dem dissonanten D — F — A
nicht unterschieden, und deshalb ist der Sinn für diesen von Hauptmann
gemachten Unterschied auch nicht deutlich ausgebildet.
entsprechen.
Freilich wird in der modernen temperierten Stimmung der konsonante Akkord
D — F — A von dem dissonanten D — F — A
nicht unterschieden, und deshalb ist der Sinn für diesen von Hauptmann
gemachten Unterschied auch nicht deutlich ausgebildet.
Was den anderen zweideutigen Füllton ![]() betrifft, welcher in den Akkorden
betrifft, welcher in den Akkorden ![]() — g —
— g — ![]() und g —
und g — ![]() —
d vorkommen kann, so ist schon im vorigen Abschnitte erwähnt,
daß selbst in der homophonen Musik an seine Stelle in aufsteigender
Bewegung fast immer h einzutreten pflegt. Durch harmonische
Rücksichten wird der Gebrauch von h unabhängig
von der Art der melodischen Bewegung ebenfalls begünstigt. Es ist
schon vorher angeführt worden, daß die beiden schwach verwandten
Töne der Leiter, wenn sie als Bestandteile des Klanges der Dominante
auftreten, in ganz enge Beziehung zur Tonica gesetzt werden. Das kann aber
nur mit den Klängen des Durakkordes g — h — d, nicht
mit denen des Mollakkordes g —
—
d vorkommen kann, so ist schon im vorigen Abschnitte erwähnt,
daß selbst in der homophonen Musik an seine Stelle in aufsteigender
Bewegung fast immer h einzutreten pflegt. Durch harmonische
Rücksichten wird der Gebrauch von h unabhängig
von der Art der melodischen Bewegung ebenfalls begünstigt. Es ist
schon vorher angeführt worden, daß die beiden schwach verwandten
Töne der Leiter, wenn sie als Bestandteile des Klanges der Dominante
auftreten, in ganz enge Beziehung zur Tonica gesetzt werden. Das kann aber
nur mit den Klängen des Durakkordes g — h — d, nicht
mit denen des Mollakkordes g — ![]() — d geschehen. An sich sind die Töne
— d geschehen. An sich sind die Töne ![]() und b ebenso nahe mit c verwandt als h und
d. Aber indem wir die letzteren als Teile des Klanges
g erscheinen
lassen, binden wir sie durch dieselbe nahe Verwandtschaft an c,
welche g hat. Deshalb pflegt man in der neueren Musik überall,
wo der Ton
und b ebenso nahe mit c verwandt als h und
d. Aber indem wir die letzteren als Teile des Klanges
g erscheinen
lassen, binden wir sie durch dieselbe nahe Verwandtschaft an c,
welche g hat. Deshalb pflegt man in der neueren Musik überall,
wo der Ton ![]() in c-moll als Bestandteil des Dominantdreiklanges oder eines ihn
vertretenden dissonanten Akkordes vorkommt, ihn in h zu
verwandeln, und je nach dem Gange der Melodie und Harmonie bald
in c-moll als Bestandteil des Dominantdreiklanges oder eines ihn
vertretenden dissonanten Akkordes vorkommt, ihn in h zu
verwandeln, und je nach dem Gange der Melodie und Harmonie bald ![]() ,
bald h, meistens aber das letztere, zu gebrauchen, wie ich
dies schon oben bei: der Konstruktion der Molltonleitern bemerkt habe.
Durch diesen systematischen Gebrauch der großen Septime h der
Tonart statt der kleinen b unterscheidet sich nun die neuere Molltonart
von der älteren Hypodorischen oder dem Terzengeschlecht. Es wird also
auch hier wiederum etwas von der Konsequenz der Tonleiter geopfert, um
die Harmonie fester zu binden.
,
bald h, meistens aber das letztere, zu gebrauchen, wie ich
dies schon oben bei: der Konstruktion der Molltonleitern bemerkt habe.
Durch diesen systematischen Gebrauch der großen Septime h der
Tonart statt der kleinen b unterscheidet sich nun die neuere Molltonart
von der älteren Hypodorischen oder dem Terzengeschlecht. Es wird also
auch hier wiederum etwas von der Konsequenz der Tonleiter geopfert, um
die Harmonie fester zu binden.
Die Verkettung der konsonanten Akkorde des Terzengeschlechts wird zwar etwas weniger reich, wenn wir durch die Einführung des Tones h das Terzengeschlecht in unser Mollgeschlecht umbilden. Statt der Kette
![]()
haben wir in Moll folgende:
![]()
mit einem Dreiklange weniger. Indessen bleibt der Wechsel zwischen dem
Tone ![]() und
h immer noch frei.
und
h immer noch frei.
Die Einführung des Leittones h in die c-Molltonleiter
brachte für den Ganzschluß in dieser Tonart eine neue Schwierigkeit
hervor. Wenn die Akkorde g — h — d und c — ![]() — g sich folgen, ist der erstere ein Durakkord von vollem Wohlklange,
der letztere ein Mollakkord von gedämpftem Wohlklange, was durch den
Kontrast mit dem vorhergehenden Durakkorde noch mehr hervorgehoben wird.
Gerade im Schlußakkorde aber ist volle Konsonanz ein wesentliches
Bedürfnis, damit sich das Gefühl des Hörers in dieser vollständig
beruhigen kann. Es mußten deshalb erst die Septimenakkorde erfunden
sein, durch welche man den Dominantdreiklang in einen dissonanten Akkord
verwandelt, ehe ein derartiger Tonschluß zulässig schien.
— g sich folgen, ist der erstere ein Durakkord von vollem Wohlklange,
der letztere ein Mollakkord von gedämpftem Wohlklange, was durch den
Kontrast mit dem vorhergehenden Durakkorde noch mehr hervorgehoben wird.
Gerade im Schlußakkorde aber ist volle Konsonanz ein wesentliches
Bedürfnis, damit sich das Gefühl des Hörers in dieser vollständig
beruhigen kann. Es mußten deshalb erst die Septimenakkorde erfunden
sein, durch welche man den Dominantdreiklang in einen dissonanten Akkord
verwandelt, ehe ein derartiger Tonschluß zulässig schien.
Es geht aus der gegebenen Darstellung hervor, daß, sobald man eine enge Verkettung der der Tonart eigentümlichen Akkorde nach demselben Prinzipe erstrebt, nach welchem die Verkettung der Töne der Tonleiter hergestellt ist, sobald man also verlangt, daß alle konsonanten Dreiklänge des Harmoniegewebes in derselben Weise einem unter ihnen, dem tonischen Dreiklange, verwandt sein sollen, wie alle Klänge der Tonleiter der Tonica verwandt sind, daß dann die Vereinigung beider Forderungen auf nur zwei Tongeschlechter führt, welche diese Bedingungen am vollkommensten erfüllen, nämlich das Dur- und das Mollgeschlecht.
Das Durgeschlecht erfüllt die Forderungen der Akkordverwandtschaft und der tonalen Verwandtschaft am vollständigsten. Es hat vier dem tonischen Akkorde unmittelbar verwandte Dreiklänge:
![]()
Man kann seine Harmonisierung so führen — und dies geschieht, wie gesagt, namentlich in populären Stücken, die leicht verständlich sein müssen —, daß alle Töne als Teile der drei Durakkorde erscheinen, welche das System enthält, des Durakkords der Tonica, der Dominante und der Subdominante. Solche Durakkorde mit tief liegendem Grundton erscheinen dem Ohre als Verstärkungen des Klanges der Tonica, der Dominante und der Subdominante, welche drei Klänge wiederum durch engste Quintenverwandtschaft mit einander verbunden sind. So kann in diesem Geschlechte alles auf die allerengsten und nächsten Verwandtschaften reduziert werden, welche es in der Musik gibt. Und da nun auch der tonische Akkord des Durgeschlechts unmittelbar und vollständig den Klang der Tonica repräsentiert, so fallen die beiden Forderungen der durchgehenden Herrschaft der Tonica und des tonischen Akkordes in eine zusammen, ohne einen Widerspruch zuzulassen, und ohne daß Veränderungen der Tonleiter dabei nötig sind.
Das Durgeschlecht hat also den Charakter vollständigster melodischer und harmonischer Konsequenz, größter Einfachheit und Klarheit aller Verhältnisse. Dazu kommt nun noch, daß sich die Durakkorde, die in ihm die herrschenden sind, durch vollen und ungetrübten Wohlklang auszeichnen, wenn man solche Umlagerungen derselben wählt, in welchen sie keine ungehörigen Kombinationstöne geben.
Die Durtonleiter ist rein diatonisch, und mit dem aufwärts steigenden Leitton der großen Septime versehen, wodurch auch der am schwächsten verwandte Ton der Leiter zur Tonica in nahe melodische Beziehung gesetzt wird.
An die herrschenden Durakkorde schließen sich noch zwei dem tonischen eng verwandte Mollakkorde innerhalb der Grenzen der Tonart an, welche man benutzen kann, um in die Reihe der Durakkorde Abwechselung zu bringen.
Das Mollgeschlecht steht in vielen Beziehungen hinter dem Dur zurück. Die Akkordkette seiner modernen Form ist:
![]()
Die Mollakkorde repräsentieren nicht so rein und einfach den Klang ihres Grundtons, wie die Durakkorde, vielmehr fällt ihre Terz aus diesem Klange heraus. Nur der Dominantdreiklang ist ein Durakkord, welcher die beiden Ausfüllungstöne der Leiter enthält. Diese beiden werden deshalb, wo sie als Bestandteile des Dominantdreiklanges, also als Bestandteile des Klanges der Dominante erscheinen, durch enge Quintenverwandtschaft an die Tonica gefesselt. Dagegen repräsentieren der Dreiklang der Tonica und der Subdominante nicht einfach die Klänge dieser Noten, sondern sind von kleinen Terzen begleitet, welche nicht auf enge Quintenverwandtschaft zur Tonica reduziert werden können. Die Verkettung der Töne mit der Tonica läßt sich also im Mollgeschlecht durch die Harmonisierung nicht auf so enge Verwandtschaften zurückführen wie im Durgeschlechte.
Die Forderung der Tonalität läßt sich mit der Herrschaft des tonischen Akkordes nicht so einfach vereinigen wie im Durgeschlechte. Wenn ein Satz mit einem Mollakkorde schließt, bleibt neben dem Klange der Tonica noch ein zweiter Klang stehen, der nicht ein Teil von jenem ist. Daher die lang dauernde Unsicherheit der Tonsetzer betreffs der Zulässigkeit eines Mollakkordes am Schlusse.
Die vorherrschenden Mollakkorde haben nicht die reine Klarheit und den ungetrübten Wohlklang der Durakkorde, weil sie von Kombinationstönen begleitet sind, welche nicht in den Akkord hineinpassen.
Die Molltonleiter enthält den für den Sänger schwer auszuführenden
Sprung ![]() — h, dessen Weite größer als die ganzen Töne
der diatonischen Leiter ist, und dem Zahlenverhältnis 75/64
entspricht. Um die Molltonleiter melodisch zu machen, muß sie im
Aufsteigen und Absteigen verschiedene Veränderungen erleiden, welche
im vorigen Abschnitte schon besprochen sind.
— h, dessen Weite größer als die ganzen Töne
der diatonischen Leiter ist, und dem Zahlenverhältnis 75/64
entspricht. Um die Molltonleiter melodisch zu machen, muß sie im
Aufsteigen und Absteigen verschiedene Veränderungen erleiden, welche
im vorigen Abschnitte schon besprochen sind.
Das Molltonsvstem zeigt daher nicht dieselbe einfache, klare und leicht verständliche Konsequenz wie das Durgeschlecht; es ist entstanden gleichsam durch ein Kompromiß zwischen den verschiedenen Anforderungen, die durch das Gesetz der Tonalität und durch die Verkettung des Harmoniegewebes gestellt waren. Es ist deshalb auch viel veränderlicher, viel mehr zu Modulationen in andere Tongeschlechter geneigt.
Diese Behauptung, daß das Mollsystem weniger vollkommen konsequent sei, als das Dursystem, wird bei vielen neueren musikalischen Theoretikern Anstoß erregen, ebenso wie die oben von mir, und vor mir schon von anderen Physikern aufgestellte Behauptung, daß der Wohlklang der Molldreiklänge im Allgemeinen gedämpfter sei, als der der Durdreiklänge. Es finden sich in neueren Büchern über Harmonielehre viele eifrige Versicherungen des Gegenteils. Aber ich glaube, daß die Geschichte der Musik, die äußerst langsame und vorsichtige Entwickelung des Mollsystems im 16. und 17. Jahrhundert, der vorsichtige Gebrauch des Mollschlusses bei Händel, das teilweise Vermeiden desselben auch noch bei Mozart, daß alle diese Umstände keinen Zweifel darüber lassen, wie das künstlerische Gefühl der großen Tonsetzer für unsere Schlußfolgerungen sprach. Dazu kommt dann auch das Wechseln mit der großen und kleinen Septime, großen und kleinen Sexte der Tonart, die schnell eintretenden, schnell wechselnden Modulationen, endlich sehr entscheidend auch der Gebrauch des Volkes. Zu Volksmelodien können nur solche von klaren, durchsichtigen Verhältnissen werden. Man sehe Sammlungen von Liedern durch, welche gegenwärtig bei denjenigen Klassen der abendländischen Völker beliebt sind, die harmonische Musik oft zu hören Gelegenheit haben, also bei Studenten, Soldaten, Handwerkern. Man wird auf hundert Lieder in Dur vielleicht eines oder zwei in Moll finden, und diese sind dann meist alte Volksmelodien, die noch aus der Zeit des überwiegend einstimmigen Gesanges herübergekommen sind. Charakteristisch ist es auch, daß, wie mir ein erfahrener Gesanglehrer versichert, Schüler von mäßigem musikalischen Talent viel schwerer die Mollterz treffen lernen, als die Durterz.
Auch glaube ich nicht, daß in diesem Resultate eine Herabsetzung des Mollsystems liege. Das Dursystem ist für alle fertigen, in sich klaren Stimmungen gut geeignet, für kräftig entschlossene, . wie sanfte oder süße, selbst für trauernde, wenn die Trauer in den Zustand schwärmerischer weicher Sehnsucht übergegangen ist. Aber es paßt durchaus nicht für unklare, trübe, unfertige Stimmungen, oder für den Ausdruck des unheimlichen, des Wüsten, Rätselhaften oder Mystischen, des Rohen, der künstlerischen Schönheit Widerstrebenden, und gerade für solche brauchen wir das Mollsystem mit seinen verschleierten Wohlklängen, seiner veränderlichen Tonleiter, Beinen leicht ausweichenden Modulationen, und dem weniger deutlich in das Gehör fallenden Prinzip seines Baues. Das Dursystem würde eine unpassende Form für solchen Ausdruck sein, und deshalb hat das Mollsystem neben ihm seine volle künstlerische Berechtigung.
Die harmonischen Eigentümlichkeiten der modernen Tonarten treten am besten hervor, wenn wir sie mit der Harmonisierung der übrigen alten Tongeschlechter vergleichen.
Unter den melodischen Tongeschlechtern ist das Lydische der Griechen (Jonische Kirchentollart) mit unserem Dur übereinstimmend, das einzige, welches in der großen Septime einen aufsteigenden Leitton hat. Die vier übrigen haben ihrer ursprünglichen Natur nach kleine Septimen, die man schon in den späteren Zeiten des Mittelalters anfing in große Septimen zu verwandeln, um die der Tonica schwach verwandte Septime gerade im Schlusse als Leitton fester an diese zu ketten.
Was zunächst das Quartengeschlecht (Jonisch der Griechen, Mixolydische Kirchentonart) betrifft, so unterscheidet sich dieses vom Dur nur durch die kleine Septime; verwandelt man diese in die große, so verschwindet jeder Unterschied zwischen beiden. Wenn die Tonica g ist, kann der tonische Akkord, ein Durakkord, nur g — h, — d sein, und die Akkordkette der unveränderten Tonart würde folgende sein müssen:
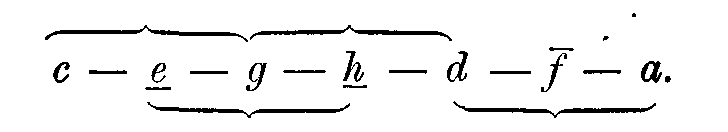
Versucht man einen Ganzschluß in dieser Tonart zu bilden, wie in den folgenden Beispielen unter l und 2, so klingt ein solcher matt, weil ihm der Leitton fehlt, selbst wenn man den Dominantakkord zum Septimenakkord erweitert.
Quartengeschlecht.
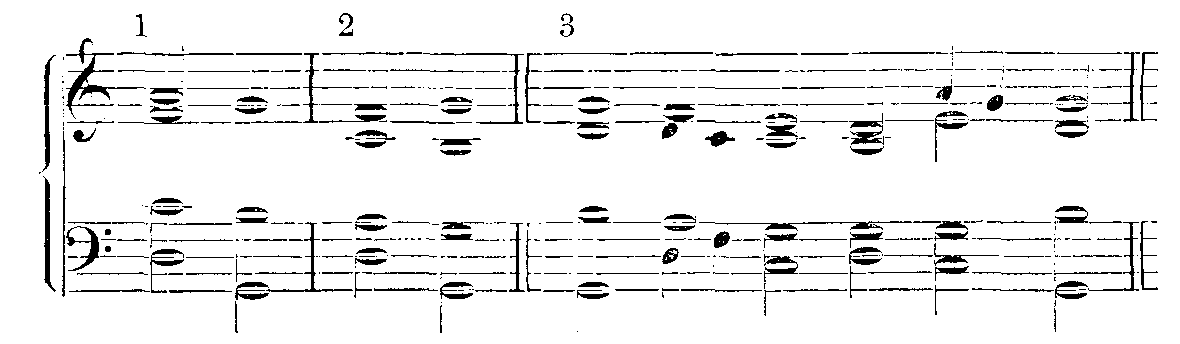
Das zweite Beispiel, wo der Leitton in der Oberstimme liegt, klingt noch matter als das erste, wo er sich mehr versteckt. Das f ist in beiden ein unsicher klingender Ton. Er ist nicht nahe genug verwandt mit der Tonica, nicht Teil des Klanges der Dominante d; nicht nahe genug der Tonica, um Leitton zu sein, und das Vorwärtsdrängen des Leittons zur Tonica fehlt ihm. Die älteren Tonsetzer schlossen deshalb Sätze im Quartengeschlecht, wenn sie es auch im Schlusse vom Durgeschlecht unterschieden halten wollten, mit dem halben oder plagalen Schlusse, wie ich ihn im Beispiel 3 angewendet habe. Diesem fehlt an und für sich schon die entschiedene Bewegung des Ganzschlusses, und der Mangel an Bewegung, den dort der fehlende Leitton bedingte, fällt hier nicht auf.
Im Verlaufe eines Satzes, der diesem Geschlechte angehört, kann bei aufsteigender Bewegung der Leitton allerdings oft angewendet werden, wenn dazwischen bei absteigender Bewegung die kleine Septime hinreichend oft eintritt. Aber gerade im Schlusse ist es mißlich, eine wesentliche Eigenschaft der Tonart zu verändern. Sätze im Quartengeschlecht klingen also wie Sätze in einer Durtonart, welche eine ausgesprochene Neigung haben, in die Durtonart der Unterdominante hinüber zu modulieren. Der Übergang zur Subdominante erscheint aus dem schon früher angegebenen Grunde weniger aktiv, als der zur Oberdominante. Dann fehlt diesem Tongeschlecht auch in seinen Schlüssen eine bestimmt ausgesprochene Bewegung, während Durakkorde, zu denen auch der tonische gehört, in ihm vorherrschen mit ihrem volleren Wohlklang. Das Quartengeschlecht muß demgemäß weich und wohlklingend sein wie Dur, aber es fehlt ihm an den kräftigeren Bewegungsimpulsen des Durgeschlechts. Damit stimmt auch die von Winterfeld3) gegebene Charakterisierung. Er bezeichnet die Jonische Kirchentonart (Dur) als eine Tonreihe, "die in sich abgeschlossen, auf den hell und heiter hinausstrahlenden harten Dreiklang, eine durch die Natur selber hinklingende, befriedigende Verschmelzung verschiedener Töne gegründet, auch das Gepräge heiteren, frohen Genügens trägt". Dagegen sei die mixolydische Kirchentonart (Quartengeschlecht) eine Tonreihe, "in der alles wieder hinklingt, hinstrebt zu dem Ursprunge, aus dem ihr Grundton erwuchs" (d. i. zur Durtonart der Subdominante), "durch die ein Zug der Sehnsucht hingeht neben jenem heiteren Genügen, dem christlichen Sehnen gleich nach geistlicher Wiedergeburt, Erlösung, Rückkehr einer "früheren Unschuld, gemildert aber durch die Seligkeit der Liebe und des Glaubens".
![]()
ebenso ursprünglich über der Dominante a, dagegen über der Subdominante g einen Durakkord, durch welchen letzteren es sich vom Terzengeschlecht (Aeolisch) unterscheidet. Beide genannte Geschlechter können, ohne ihren Charakter zu verwischen, die kleine Septime zum Leitton erhöhen, und aus beiden ist unsere Molltonart zusammengeschmolzen. Die aufsteigende Molltonleiter gehört dem Septimengeschlecht an, dem man den Leitton gegeben hat, die absteigende dem Terzengeschlecht. Gibt man aber dem Septimengeschlecht den Leitton, so wird seine Akkordkette reduziert auf die drei wesentlichen Dreiklänge der Tonart:
![]()
Diese Tonart hat im Ganzen den Charakter der Molltonart, nur daß der Übergang auf den Akkord der Subdominante mehr aufhellend wirkt, als in der normalen Molltonart, in welcher dieser Akkord selbst ein Mollakkord ist. Wenn man aber die vollständige Kadenz bildet, bekommen beide Dominanten der Tonart Durakkorde, dazwischen bleibt der Akkord der Tonica allein als Mollakkord stehen. Aber im Schlusse gerade macht es eine ungünstige Wirkung, wenn der Schlußakkord einen gedämpfteren Wohlklang hat als die beiden anderen Hauptakkorde der Tonart. Man muß auf diese scharfe Dissonanzen legen, wenn dadurch nicht ein Mißverhältnis entstehen soll. Bildet man aber nach Art der älteren Tonsetzer auch den Schlußakkord in Dur, so ist der Charakter der Tonart in der Kadenz ganz in Dur verwandelt. Oder da in dem System der Kirchentonarten das H immer in B verwandelt werden kann, was den Subdominantenakkord des Quartengeschlechts in einen Mollakkord verwandelt, so kann man dadurch das Septimengeschlecht in seiner Kadenz vor der Verwechselung mit Dur schützen, dann fällt es aber wiederum ganz mit dem alten Mollschlusse zusammen.
Sebastian Bach bringt in der Kadenz dieses Tongeschlechts die große Sexte der Tonica, die ihm charakteristisch ist, in andere Akkordverbindungen, und vermeidet so den Durdreiklang der Subdominante. Sehr gewöhnlich bringt er die große Sexte als Quinte des Septimenakkords auf der Secunde der Tonart an, wie in den nachstehenden Beispielen. Nro. l ist das Ende des Chorals "Was mein Gott will, das gescheh' allzeit" in der Matthäus-Passion. Nro.2 ist das Ende des Hymnus Veni redemptor gentium, am Schlusse der Kantate: "Schwingt freudig Euch empor zu den erhabenen Sternen". In beiden Tonica h, große Sexte gis:

Ähnliche Beispiele finden sich noch viele; er geht offenbar einem regelmäßigen Schlusse aus dem Wege.
Die neueren Komponisten, wenn sie ein zwischen Dur und Moll liegendes Tongeschlecht, wenigstens für einzelne melodische Phrasen oder Cadenzen, brauchen wollen, haben es meist vorgezogen, den einen Mollakkord des Geschlechts nicht der Tonica, sondern der Subdominante zu geben. Hauptmann nennt dieses die Moll-Durtonart; ihre Akkordkette ist folgende:
![]()
Hier haben wir einen Leitton im Dominantenakkorde, einen voll ausklingenden
Schluß im Durakkorde der Tonica, und der Anklang nach Moll hin kann
im Subdominantenakkorde ungestört stehen bleiben. Für die Harmonisierung
ist dieses Moll-Durgeschlecht jedenfalls viel geschickter als das alte
Septimengeschlecht. Aber für den homophonen Gesang paßt es wieder
nicht, ohne in aufsteigender Leiter ![]() in a zu verwandeln, weil sonst der komplizierte Sprung
in a zu verwandeln, weil sonst der komplizierte Sprung ![]() — h zu machen ist. Die alten Geschlechter sind aus dem
homophonen Gesange hergeleitet, für welchen das Septimengeschlecht
vollkommen gut paßt, wie es ja auch jetzt noch unsere aufsteigende
Molltonleiter bildet.
— h zu machen ist. Die alten Geschlechter sind aus dem
homophonen Gesange hergeleitet, für welchen das Septimengeschlecht
vollkommen gut paßt, wie es ja auch jetzt noch unsere aufsteigende
Molltonleiter bildet.
Während also das Septimengeschlecht in unbestimmter Weise zwischen Dur und Moll einherschwankt, ohne eine konsequente Durchführung zu erlauben, hat das Sextengeschlecht (Dorisch der Griechen, Phrygische Kirchentonart) mittels seiner kleinen Secunde eine viel eigentümlichere Charakteristik, die es von allen anderen Geschlechtern unterscheidet. Diese kleine Secunde steht in derselben melodischen Beziehung zur Tonica, wie ein Leitton; nur erfordert sie absteigende Bewegung. Für absteigende Bewegung ist dieses Geschlecht melodisch ebenso günstig gebaut, wie das Durgeschlecht für aufsteigende Bewegung. Die kleine Secunde ist die schwächste Verwandte der Tonica. Ihre Verwandtschaft zur Tonica wird vermittelt durch die Subdominante; einen Dominantenakkord kann das Geschlecht gar nicht bilden, ohne über seine Grenzen hinaus zu gehen. Nennen wir die Tonica e, so ist die Akkordkette:
![]()
hierin sind aber die Akkorde d —![]() — a und
— a und ![]() — a —
— a — ![]() nicht direkt verwandt mit dem tonischen, und der Ton f kann in gar keinen
konsonanten Akkord eintreten, der dem tonischen direkt verwandt wäre.
Da
nicht direkt verwandt mit dem tonischen, und der Ton f kann in gar keinen
konsonanten Akkord eintreten, der dem tonischen direkt verwandt wäre.
Da ![]() nun
gerade die charakteristische kleine Secunde der Tonart ist, so können
die genannten Akkorde nicht wohl ausbleiben, nicht einmal in der Kadenz.
Während also zwischen den auf einander folgenden Gliedern der Akkordkette
eine enge Verwandtschaft besteht, sind doch unentbehrliche Glieder derselben
nur entfernt mit dem Akkorde der Tonica verwandt. Ferner wird es im Verlaufe
eines Satzes in dieser Tonart immer nötig werden, den Dominantenakkord
h
— dis — fis zu bilden, wenn derselbe auch zwei der Tonleiter
ursprünglich fremde Töne enthält, um nicht den Eindruck
herrschend werden zu lassen, daß a die Tonica und a
—
nun
gerade die charakteristische kleine Secunde der Tonart ist, so können
die genannten Akkorde nicht wohl ausbleiben, nicht einmal in der Kadenz.
Während also zwischen den auf einander folgenden Gliedern der Akkordkette
eine enge Verwandtschaft besteht, sind doch unentbehrliche Glieder derselben
nur entfernt mit dem Akkorde der Tonica verwandt. Ferner wird es im Verlaufe
eines Satzes in dieser Tonart immer nötig werden, den Dominantenakkord
h
— dis — fis zu bilden, wenn derselbe auch zwei der Tonleiter
ursprünglich fremde Töne enthält, um nicht den Eindruck
herrschend werden zu lassen, daß a die Tonica und a
— ![]() — e
der tonische Akkord sei. Daraus geht hervor, daß das Sextengeschlecht
noch inkonsequenter in seiner Harmonisierung, noch loser gebunden sein
muß als das Mollgeschlecht, während es in melodischer Beziehung
große Konsequenz zuläßt. Es enthält drei wesentliche
Mollakkorde, nämlich den der Tonica
e —
— e
der tonische Akkord sei. Daraus geht hervor, daß das Sextengeschlecht
noch inkonsequenter in seiner Harmonisierung, noch loser gebunden sein
muß als das Mollgeschlecht, während es in melodischer Beziehung
große Konsequenz zuläßt. Es enthält drei wesentliche
Mollakkorde, nämlich den der Tonica
e — ![]() — h, den der Subdominante a —
— h, den der Subdominante a —![]() — e und denjenigen Akkord, welcher die beiden schwach verwandten
Töne der Tonica enthält, d —
— e und denjenigen Akkord, welcher die beiden schwach verwandten
Töne der Tonica enthält, d —![]() —
a.
Es ist das gerade Gegenbild des Durgeschlechts; wie dieses sich nach der
Dominantseite aufbaut, tut es jenes nach der Unterdominantseite.
—
a.
Es ist das gerade Gegenbild des Durgeschlechts; wie dieses sich nach der
Dominantseite aufbaut, tut es jenes nach der Unterdominantseite.
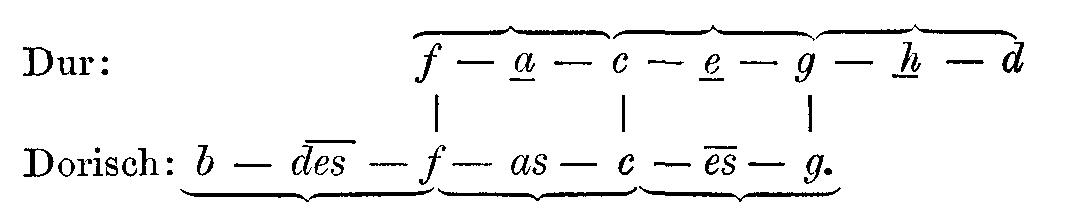
Für die Harmonisierung beruht der Unterschied auf dem Umstande,
daß die Verwandten, welche die Unterdominante f in die Tonleiter
einführt, nämlich b und ![]() ,
nicht zum Klange der Unterdominante gehören, wie es h und
d, welche die Dominante in die Tonart einführt, in Beziehung
auf diese tun, und daß der tonische Akkord immer auf der Dominantseite
der Tonica liegt. Daher sind in der harmonischen Verbindung die Töne
b und
,
nicht zum Klange der Unterdominante gehören, wie es h und
d, welche die Dominante in die Tonart einführt, in Beziehung
auf diese tun, und daß der tonische Akkord immer auf der Dominantseite
der Tonica liegt. Daher sind in der harmonischen Verbindung die Töne
b und ![]() nicht so eng, weder mit der Tonica noch mit dem tonischen Akkorde, zu verknüpfen,
wie es mit den der Dominante verwandten Ausfüllungstönen der
Fall ist. Das Sextengeschlecht bietet deshalb bei harmonischer Bearbeitung
den Charakter der Molltonart gleichsam in gesteigertem Maße. Seine
Töne und Akkorde sind allerdings verbunden, aber viel weniger deutlich
und erkennbar als die des Mollsystems. Die Akkorde, welche in demselben
neben einander zu stehen kommen können, ohne daß wir die Beziehung
zur Tonica e verlassen, sind d-Moll und
nicht so eng, weder mit der Tonica noch mit dem tonischen Akkorde, zu verknüpfen,
wie es mit den der Dominante verwandten Ausfüllungstönen der
Fall ist. Das Sextengeschlecht bietet deshalb bei harmonischer Bearbeitung
den Charakter der Molltonart gleichsam in gesteigertem Maße. Seine
Töne und Akkorde sind allerdings verbunden, aber viel weniger deutlich
und erkennbar als die des Mollsystems. Die Akkorde, welche in demselben
neben einander zu stehen kommen können, ohne daß wir die Beziehung
zur Tonica e verlassen, sind d-Moll und ![]() -Dur
einerseits, h-Dur andererseits, Akkorde, die im Dursysteme nur durch
auffallende modulatorische Wendungen zusammen zu bringen wären. Der
ästhetische Charakter des Sextengeschlechts entspricht dem; es paßt
wunderbar gut für das Geheimnisvolle, Mystische, oder für den
Ausdruck tiefster Niedergedrücktheit, in welchem keine Sammlung der
Gedanken mehr möglich scheint, tiefstes Versinken in Schmerzgefühl.
Da es andererseits durch seinen absteigenden Leitton eine gewisse Energie
in seiner absteigenden Bewegung hat, so kann es auch eine ernste und mächtige
Erhabenheit ausdrücken, die durch die fremdartig zusammengestellten
Durakkorde, welche das System enthält, sogar eine Art von eigentümlicher
Pracht und wunderbarem Farbenreichtum annimmt.
-Dur
einerseits, h-Dur andererseits, Akkorde, die im Dursysteme nur durch
auffallende modulatorische Wendungen zusammen zu bringen wären. Der
ästhetische Charakter des Sextengeschlechts entspricht dem; es paßt
wunderbar gut für das Geheimnisvolle, Mystische, oder für den
Ausdruck tiefster Niedergedrücktheit, in welchem keine Sammlung der
Gedanken mehr möglich scheint, tiefstes Versinken in Schmerzgefühl.
Da es andererseits durch seinen absteigenden Leitton eine gewisse Energie
in seiner absteigenden Bewegung hat, so kann es auch eine ernste und mächtige
Erhabenheit ausdrücken, die durch die fremdartig zusammengestellten
Durakkorde, welche das System enthält, sogar eine Art von eigentümlicher
Pracht und wunderbarem Farbenreichtum annimmt.
Trotzdem das Sextengeschlecht in der gewöhnlichen theoretischen Musiklehre gestrichen ist, haben sich von ihm doch viel deutlichere Spuren in der musikalischen Praxis erhalten, als von den anderen alten Geschlechtern, von denen das Quartengeschlecht mit der Durtonart, das Septimengeschlecht dagegen mit dem Terzengeschlecht zur Molltonart verschmolzen sind. Freilich paßt ein Geschlecht, wie das beschriebene, nicht zu häufiger Anwendung; für lange Sätze ist es nicht fest genug zusammengeschlossen, aber sein eigentümlicher Ausdruck kann, wo er hingehört, durch kein anderes ersetzt werden. Es kündigt sich, wo es vorkommt, meist durch seine eigentümliche Schlußkadenz, die von der kleinen Secunde in den Grundton übergeht, deutlich an. Bei Händel findet sich noch die natürliche Kadenz des Systems mit großer Wirksamkeit angewendet. So in der großartigen Fuge im Messias: "And with his stripes we are healed", welche die Vorzeichnung von F-Moll tragt, aber durch häufigen Gebrauch der Septimenharmonie auf Gauf den Grundton C hinweist. Die rein dorische Kadenz ist
folgende:
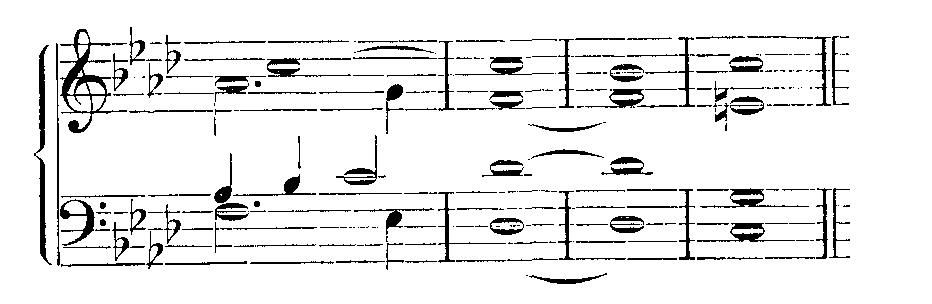
Ebenso im Samson, der Chor "Hör Jacob's Gott", welcher in dorischer Tonart von E das Flehen der geängsteten Israeliten im Gegensätze zu den unmittelbar darauf folgenden rauschenden Opfer-Gesängen der Philister in G-Dur sehr schön charakterisiert. Auch hier ist die Kadenz rein dorisch;

Der Israeliten-Chor, welcher den dritten Teil einleitet: "Im Donner komm o Gott herab", und hauptsächlich in A-Moll sich bewegt hat ebenfalls einen dorischen Zwischensatz.
Auch Sebastian Bach hat in den von ihm harmonisierten Chorälen, deren Melodie dem Sextengeschlecht angehört, die Harmonisierung in diesem Geschlecht belassen, so oft der Text einen tief schmerzlichen Ausdruck erfordert, z. B. in dem De profundis oder "Aus tiefer Not schrei ich zu Dir", ferner in dem Liede von Paul Gerhardt: "Wenn ich einmal soll scheiden, so scheide nicht von mir", während er dieselbe Melodie zu anderen Texten, z. B. "Befiehl Du deine Wege", "O Haupt voll Blut und Wunden" etc. in Dur oder Moll harmonisiert, wo dann die Melodie in der Terz oder Quinte der Tonart endet, statt auf der dorischen Tonica.
Daß Mozart in der Arie der Pamina im zweiten Akte der Zauberflöte dorisches Tongeschlecht angewendet hat, bemerkte schon Fortlage4). Eines der schönsten Beispiele für den Gegensatz dieses Geschlechts und der Durtonart findet sich bei demselben Meister im Sextett im zweiten Akte des Don Giovanni, wo Ottavio und Donna Anna eintreten. Ottavio singt tröstende Worte
4) Beispiele aus den Instrumentalsätzen erwähnt Ekert in seiner Habilitationsschrift "Die Prinzipien der Modulation und musikalischen Idee." Heidelberg 1860. S. 12.
Unter den Kompositionen von Beethoven könnte man den ersten Satz der Klaviersonate, Op. 90 in E- Moll, als einen solchen bezeichnen, der durch öfter wiederholte dorische Cadenzen einen eigentümlich gedrückten Charakter erhält, zu dem als Gegensatz der zweite Teil, ein Dursatz, von desto süßerem Ausdruck erscheint.
Die neueren Komponisten bilden eine Kadenz, die dem Sextengeschlecht
angehört, oft mit der kleinen Secunde und großen Septime, in
dem sogenannten übermäßigen Sextenakkorde: ![]() —
a
— dis, wo sowohl f wie dis einen halben
Tonschritt zur Tonica e zu machen haben. Dieser Akkord ist
aus dem Dur- und Mollgeschlecht nicht abzuleiten, daher auch vielen neueren
Theoretikern sehr rätselhaft und unerklärlich erschienen. Er
erklärt sich aber leicht als ein Rest des alten Sextengeschlechts,
indem man die dem Dominantenakkorde h — dis — fis angehörige
große Septime dis mit den Tönen
—
a
— dis, wo sowohl f wie dis einen halben
Tonschritt zur Tonica e zu machen haben. Dieser Akkord ist
aus dem Dur- und Mollgeschlecht nicht abzuleiten, daher auch vielen neueren
Theoretikern sehr rätselhaft und unerklärlich erschienen. Er
erklärt sich aber leicht als ein Rest des alten Sextengeschlechts,
indem man die dem Dominantenakkorde h — dis — fis angehörige
große Septime dis mit den Tönen ![]() —
a
von der Unterdominantseite vereinigt hat.
—
a
von der Unterdominantseite vereinigt hat.
Diese Beispiele mögen hinreichen um nachzuweisen, daß sich Reste des Sextengeschlechts auch in der neueren Musik erhalten haben. Es werden sich leicht noch viel mehr Beispiele finden lassen, wenn man danach sucht. Die Akkordverbindungen dieses Geschlechts sind nicht fest und deutlich genug, um weitläufige Sätze darauf bauen zu können; in kurzen Sätzen aber, Chorälen, oder kürzeren Zwischensätzen und melodischen Perioden größerer musikalischer Werke ist es von einer so wirksamen Ausdrucksweise, daß man es in der modernen Theorie nicht hätte vergessen sollen, um so mehr, da es von Händel, Bach, Mozart noch an so hervorragenden Punkten ihrer Werke gebraucht worden ist5).
5) Herr A. v. Oettingen hat in seinem "Harmoniesystem
in dualer Entwickelung" (Dorpat und Leipzig 1866) die durchgehende Analogie
des Sextengeschlechts mit dem Durgeschlecht, dessen direkte Umkehrung jenes
ist, in sehr interessanter Weise durchgeführt; namentlich auch gezeigt,
wie diese Umkehrung zu einer eigentümlich charakteristischen Harmonisierung
des Sextengeschlechts führt. In dieser Beziehung möchte ich das
Buch der Aufmerksamkeit der Musiker dringend empfehlen. Andererseits müßte,
wie mir scheint, erst durch die musikalische Praxis gezeigt werden, daß
das neue von dem Autor seiner Theorie des Sextengeschlechts, welches er
als das theoretisch normale Mollgeschlecht betrachtet, zu Grunde gelegte
Prinzip wirklich zum Aufbau größerer Musikstücke ausreicht.
Derselbe betrachtet nämlich den Molldreiklang c — ![]() —
g als Repräsentanten des den drei Klängen gemeinsamen Tones
g",
und nennt ihn deshalb den "phonischen g Klang", während
c
— e — g wie bei uns als "tonischer c Klang" betrachtet wird.
—
g als Repräsentanten des den drei Klängen gemeinsamen Tones
g",
und nennt ihn deshalb den "phonischen g Klang", während
c
— e — g wie bei uns als "tonischer c Klang" betrachtet wird.
Ähnlich verhält es sich übrigens auch mit dem Quartengeschlecht und Septimengeschlecht, obgleich diese beiden weniger spezifisch verschieden sind, jenes von Dur, dieses von Moll. Sie sind doch immer im Stande, gewissen musikalischen Perioden einen eigentümlichen Ausdruck zu geben, wenn es auch Schwierigkeiten haben würde, ihre Eigentümlichkeiten in längeren Sätzen konsequent fühlen zu lassen. Die harmonischen Wendungen, welche den beiden letztgenannten Geschlechtern zukommen, können allerdings auch innerhalb der Grenzen des gewöhnlichen Dur- und Mollsystems ausgeführt werden. Es wäre aber doch vielleicht eine Erleichterung für die theoretische Auffassung gewisser Modulationen, wenn man den Begriff dieser Geschlechter und ihrer Harmonisierung festgehalten hätte.
Der Vorzug der modernen Tonarten besteht also, wie die geschichtliche Entwickelung und die physiologische Theorie übereinstimmend zeigen, nur für die harmonische Musik. Ihre Bildung ist hervorgerufen durch das ästhetische Prinzip der modernen Musik, daß der tonische Akkord in der Reihe der Akkorde nach demselben Gesetze der Verwandtschaft herrschen soll, wie die Tonica in der Tonleiter. Zur faktischen Herrschaft ist dieses Prinzip erst seit dem Anfange des vorigen Jahrhunderts gekommen, seit man die Notwendigkeit fühlte, auch den tonischen Mollakkord der Regel nach in der Schlußkadenz zu bewahren.
Das physiologische Phänomen, welches unter diesem ästhetischen Prinzipe zur Wirksamkeit kam, ist, daß musikalische Klänge an sich schon Akkorde von Partialtönen sind, und daher umgekehrt Akkorde unter gewissen Umständen auch Klange vertreten können. Dieses Umstandes wegen spielt in jedem Dreiklange einer seiner Töne eine Hauptrolle, derjenige nämlich, als dessen Klang der Akkord angesehen werden kann. Praktisch hatte dies Prinzip längst Anerkennung erhalten, sobald man anfing, die Schlüsse der Tonsätze ans mehrstimmigen Akkorden zu bilden. Man fühlte hierbei sogleich, daß man über dem Schlußtone des Basses eine Oktave, eine Quinte, endlich eine große Terz hinzufügen durfte, aber man durfte keine Quarte, keine Sexte hinzufügen, und lange genug scheute man auch die kleine Terz. Jene ersten drei Intervalle liegen eben im Klange der im Basse liegenden Tonica, die letzteren nicht.
Ihre theoretische Anerkennung erhielt die verschiedene Geltung der Töne
in einem Akkorde erst durch Rameau in seiner Lehre vom Fundamentalbasse,
obgleich Rameau den von uns nachgewiesenen Grund dieser verschiedenen
Geltung noch nicht kannte. Derjenige Ton, dessen Klang der Akkord nach
unserer Erklärung darstellt, wird sein Fundamentalbaß,
sein Grundton genannt, zum Unterschiede von dem gewöhnlich
so genannten Baßtone, d. h. dem Tone seiner tiefsten Stimme.
Der Durdreiklang hat in jeder Umlagerung immer denselben Fundamentalbaß.
In den Akkorden c — e — g oder g — c — e ist
es immer nur c. Der Mollakkord d — ![]() — a hat ebenso in seinen verschiedenen Umlagerungen in der Regel nur
d
als Grundton, aber im großen Sextenakkorde
— a hat ebenso in seinen verschiedenen Umlagerungen in der Regel nur
d
als Grundton, aber im großen Sextenakkorde ![]() — a — d kann er auch
— a — d kann er auch ![]() als Grundton haben; in diesem Sinne kommt er in der Kadenz von (
als Grundton haben; in diesem Sinne kommt er in der Kadenz von (![]() -
Dur vor. Diesen letzteren Unterschied haben Rameau's Nachfolger
zum Teil aufgegeben; es ist aber hierin Rameau's künstlerisches
Gefühl der Natur der Sache ganz entsprechend gewesen. Der Mollakkord
läßt in der Tat diese zweifache Deutung zu, wie wir oben gezeigt
haben.
-
Dur vor. Diesen letzteren Unterschied haben Rameau's Nachfolger
zum Teil aufgegeben; es ist aber hierin Rameau's künstlerisches
Gefühl der Natur der Sache ganz entsprechend gewesen. Der Mollakkord
läßt in der Tat diese zweifache Deutung zu, wie wir oben gezeigt
haben.
Der wesentliche Unterschied der alten und neuen Tonarten liegt darin,
daß jene ihre Mollakkorde auf die Seite der Dominante. diese auf
die der Subdominante stellen;
| im |
|
|||
|
|
|
|
||
| Alt | im Terzengeschlecht ...... | Moll | Moll | Moll |
| Septimengeschlecht ..... | Dur | Moll | Moll | |
| Quartengeschlecht ..... | Dur | Dur | Moll | |
| Durgeschlecht ..... . | Dur | Dur | Dur | |
|
|
Moll-Durgeschlecht .... | Moll | Dur | Dur |
| Mollgeschlecht | Moll | Moll | Dur | |
Die Gründe dieser Konstruktion sind vorher schon erörtert.