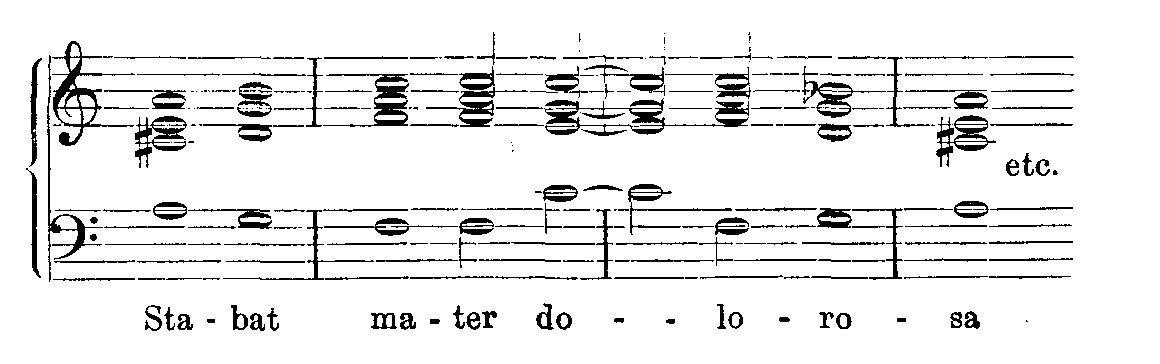DRITTE ABTEILUNG.
DIE
VERWANDTSCHAFT DER KLÄNGE.
TONLEITERN UND TONALITÄT.
Dreizehnter Abschnitt.
Übersicht der verschiedenen Prinzipien des
musikalischen Stils in der Entwickelung der Musik.
Bis hierher ist unsere Untersuchung rein naturwissenschaftlicher Art gewesen.
Wir haben die Gehörempfindungen analysiert, wir haben die physikalischen
und physiologischen Gründe der gefundenen Erscheinungen, der Obertöne,
Kombinationstöne, Schwebungen aufgesucht. In diesem ganzen Gebiete
hatten wir es nur "mit Naturerscheinungen zu tun, die rein mechanisch und
ohne Willkür bei allen lebenden Wesen ebenso eintreten müssen,
deren Ohr nach einem ähnlichen anatomischen Plane konstruiert ist,
wie das unsere. In einem solchen Gebiete, wo mechanische Notwendigkeit
herrscht und alle Willkür ausgeschlossen ist, kann man auch von der
Wissenschaft verlangen, daß sie feste Gesetze der Erscheinungen aufstelle,
und einen strengen Zusammenhang zwischen Ursache und Wirkung streng nachweise.
Wie in den Erscheinungen, welche die Theorie umfaßt, nichts Willkürliches
ist, so darf auch in den Gesetzen, unter welche diese Erscheinungen gefaßt
werden, in den Erklärungen, die wir ihnen unterlegen, schließlich
nichts Willkürliches bleiben. Und so lange so etwas noch darin wäre,
hätte die Wissenschaft die Aufgabe (wie meistens auch die Mittel),
durch fortgesetzte Untersuchungen es auszuschließen.
Indem wir uns in dieser dritten Abteilung unserer Untersuchungen hauptsächlich
der Musik zuwenden, und zur Begründung der elementaren Regeln der
musikalischen Komposition übergehen wollen, betreten wir einen andern
Boden, der nicht mehr rein naturwissenschaftlich ist, wenn auch die von
uns gewonnene Einsicht in das Wesen des Hörens hier noch mannigfache
Anwendung finden wird. Wir schreiten hier zu einer Aufgabe, die ihrem Wesen
nach in das Gebiet der Ästhetik gehört. Wenn wir bisher in der
Lehre von den Konsonanzen von Angenehm und Unangenehm gesprochen haben,
so handelte es sich nur um den unmittelbaren sinnlichen Eindruck des isolierten
Zusammenklanges auf das Ohr, ohne alle Rück- sicht auf künstlerische
Gegensätze und Ausdrucksmittel, also nur um sinnliches Wohlgefallen,
nicht um ästhetische Schönheit. Beide sind streng zu trennen,
wenn auch das erstere ein wichtiges Mittel ist, um die Zwecke der letzteren
zu erreichen.
Die geänderte Natur der fortan zu behandelnden Gegenstände
verrät sich schon durch ein ganz äußerliches Kennzeichen,
nämlich dadurch, daß wir fast bei jedem einzelnen derselben
auf historische und nationale Geschmacksverschiedenheiten stoßen.
Ob ein Zusammenklang mehr oder weniger rauh ist als ein anderer, hängt
nur von der anatomischen Struktur des Ohres, nicht von psychologischen
Motiven ab. Wie viel Rauhigkeit aber der Hörer als Mittel musikalischen
Ausdrucks zu ertragen geneigt ist, hängt von Geschmack und Gewöhnung
ab; daher die Grenze zwischen Konsonanzen und Dissonanzen sich vielfältig
geändert hat. Ebenso sind die Tonleitern, Tonarten und deren Modulationen
mannigfachem Wechsel unterworfen gewesen, nicht bloß bei ungebildeten
und rohen Völkern, sondern selbst in denjenigen Perioden der Weltgeschichte
und bei denjenigen Nationen, wo die höchsten Blüten menschlicher
Bildung zum Aufbruch kamen.
Daraus folgt der Satz, der unseren musikalischen Theoretikern und Historikern
noch immer nicht genügend gegenwärtig ist, daß das System
der Tonleitern, der Tonarten und deren Harmoniegewebe nicht bloß
auf unveränderlichen Naturgesetzen beruht, sondern daß es zum
Teil auch die Konsequenz ästhetischer Prinzipien ist, die mit fortschreitender
Entwickelung der Menschheit einem Wechsel unterworfen gewesen sind und
ferner noch sein werden.
Daraus folgt nun noch nicht, daß die Wahl der genannten Elemente
musikalischer Technik rein willkürlich sei, und sie keine Ableitung
aus einem allgemeineren Gesetze zuließen. Im Gegenteil, die Regeln
eines jeden Kunststils bilden ein wohl zusammenhängendes System, wenn
derselbe überhaupt zu einer reichen und vollendeten Entwickelung gekommen
ist. Ein solches System von Kunstregeln wird zwar von den Künstlern
nicht aus bewußter Absicht und Konsequenz entwickelt, sondern mehr
durch herumtastende Versuche und durch das Spiel der Phantasie, indem sie
ihre Kunstgebilde bald so, bald anders sich ausdenken oder ausführen,
und durch den Versuch allmählich ermitteln, welche Art und Weise ihnen
am besten gefalle. Aber die Wissenschaft kann die Motive doch zu ermitteln
suchen, seien sie nun psychologischer oder technischer Art, die bei diesem
Verfahren der Künstler wirksam gewesen sind. Der wissenschaftlichen
Ästhetik werden hierbei die psychologischen Motive zur Untersuchung
zufallen, der Naturwissenschaft die technischen. Wenn der Zweck
richtig festgestellt ist, dem die Künstler einer gewissen Stilart
nachstreben, und die Hauptrichtung des Weges, den sie dazu eingeschlagen
haben, so läßt sich übrigens mehr oder weniger bestimmt
nachweisen, warum sie gezwungen waren diese oder jene Regel zu befolgen,
dieses oder jenes technische Mittel zu ergreifen. In der Musiklehre namentlich,
wo eigentümliche physiologische Tätigkeiten des Ohres, die nicht
unmittelbar vor der bewußten Selbstbeobachtung offen darliegen, eine
große Rolle spielen, bleibt der wissenschaftlichen Erörterung
ein breites und reiches Feld offen, um die Notwendigkeit der technischen
Regeln für eine jede einzelne Richtung in der Entwickelung unserer
Kunst zu erweisen.
Die Charakterisierung freilich der Hauptaufgabe, welche jede Kunstschule
verfolgt, und des Grundprinzips ihres Kunststils kann nicht Aufgabe der
Naturwissenschaft sein, sondern diese muß ihr aus den Resultaten
der historischen und ästhetischen Forschungen gegeben werden.
Der Vergleich mit der Baukunst, welche ebenso wie die Musik wesentlich
von einander verschiedene Richtungen eingeschlagen hat, wird das Verhältnis
deutlicher zu machen geeignet sein. Die Griechen ahmten in ihren
steinernen Tempeln die ursprünglichen Holzbauten nach; das war das
Grundprinzip ihres Baustils. Man erkennt noch deutlich in der ganzen Gliederung
und in der Anordnung der Verzierungen diese Nachahmung der Holzkonstruktion.
Die senkrechte Stellung der tragenden Säulen, die meist horizontale
des getragenen Gebälks zwangen, auch alle untergeordneten Teile überwiegend
nach horizontalen und vertikalen Linien zu gliedern. Für die Zwecke
des griechischen Gottesdienstes, dessen Hauptakte unter freiem Himmel geschahen,
genügten solche Bauten, deren innere Räumlichkeit natürlich
durch die Länge der verwendbaren steinernen oder hölzernen Balken
eng begrenzt war. Die alten Italiener (Etrusker) dagegen erfanden
das Prinzip des ans keilförmigen Steinen zusammengesetzten Gewölbes.
Durch diese technische Erfindung wurde es möglich, viel weitläufigere
Gebäude mit gewölbten Decken zu überdachen, als die Griechen
es mit ihren horizontalen Balken tun konnten. Unter diesen gewölbten
Gebäuden sind bekanntlich die Gerichtshallen (Basiliken) für
die spätere Entwickelung der Baukunst bedeutend geworden. Mit der
gewölbten Decke tritt nun der Rundbogen in der romanischen (byzantinischen)
Kunst als Hauptmotiv der Gliederung und Verzierung auf. Die Säulen
verwandelten sich der schwereren Last entsprechend in Pfeiler, denen sich
nach voller Entwickelung dieses Stils Säulen nur noch in sehr verjüngten
Dimensionen und halb in die Maße des Pfeilers eingesenkt, als eine
verzierende Gliederung desselben, und als untere Fortsetzung der Gewölberippen,
die vom oberen Ende des Pfeilers nach der Decke ausstrahlten, anschlössen.
In dem Gewölbe drängen die keilförmig gehauenen Steine
gegeneinander; weil sie aber alle gleichmäßig nach innen drängen,
verhindert jeder den anderen wirklich zu fallen. Den stärksten und
gefährlichsten Druck üben die Steine in dem horizontalen Teile
des Gewölbes, die gar keine, auch keine schief gestellte Unterlage
mehr haben, sondern nur noch durch ihre Keilform und die größere
Dicke ihres oberen Endes am Fallen gehindert werden. Bei sehr großen
Gewölben ist also der horizontal liegende mittlere Teil der gefährlichste,
der bei der kleinsten Nachgiebigkeit der Nachbarsteine zusammenstürzt.
Als nun die mittelalterlichen Kirchenbauten immer größere Dimensionen
annahmen, verfiel man darauf, den mittleren horizontal liegenden Teil des
Gewölbes ganz wegzulassen, und die Seiten unter mäßigerer
Steigung aufwärts laufen zu lassen, bis sie oben im Spitzbogen zusammenstießen.
Nun wurde dem entsprechend der Spitzbogen das herrschende Prinzip. Das
Gebäude gliederte sich äußerlich durch die hervortretenden
Strebepfeiler. Diese, wie der überall hindurchbrechende Spitzbogen,
gaben harte Formen, die Kirchen wurden im Innern enorm hoch. Beides aber
entsprach dem kräftigen Sinne der nordischen Völker, und vielleicht
erhöhte sogar die Härte der Formen den Eindruck des Gewaltigen
und Mächtigen, weil sie vollständig beherrscht sind von der wunderbaren
Konsequenz, die sich durch die bunte Formenpracht der gotischen Dome
hinzieht.
So sehen wir hier, wie die an die wachsenden Aufgaben sich anschließenden
technischen Erfindungen nach einander drei ganz verschiedene Stilprinzipien,
nämlich das der geraden Horizontallinie, des Rundbogens und des Spitzbogens,
erzeugten, und wie mit jeder neuen Änderung in dem Hauptplane der
Konstruktion des Gebäudes auch alle untergeordneten Einzelheiten bis
in die kleinsten Verzierungen hinein sich ändern; daher sind auch
die einzelnen technischen Konstruktionsregeln nur aus dem Konstruktionsprinzipe
des Ganzen zu begreifen. Obgleich der gotische Stil die reichsten und in
sich konsequentesten, die mächtigsten und ergreifendsten Architekturformen
entwickelt hat, ungefähr wie unser modernes Musiksystem unter den
übrigen, so wird es doch nicht leicht Jemandem einfallen behaupten
zu wollen, der Spitzbogen sei die natürlich gegebene Urform aller
architektonischen Schönheit, und müsse überall eingeführt
werden. Und gegenwärtig weiß man sehr wohl, daß es eine
künstlerische Absurdität ist, einem Gebäude in griechischer
Tempelform gotische Fenster einzusetzen, sowie sich auch umgekehrt leider
Jedermann in unseren meisten gotischen Domen davon überzeugen kann,
wie abscheulich die vielen kleinen, in griechischem oder römischem
Stile ausgeführten Kapellen aus der Renaissancezeit zum Ganzen passen.
Ebenso wenig, wie den gotischen Spitzbogen, müssen wir unsere Durtonleiter
als Naturprodukt betrachten, wenigstens nicht in anderem Sinne,
als daß beide die notwendige und durch die Natur der Sache
bedingte Folge des gewählten Stilprinzips sind. Und ebenso wenig,
wie wir in einen griechischen Tempel gotische Verzierungen setzen, müssen
wir die in Kirchentonarten geschriebenen Kompositionen dadurch verbessern
wollen, daß wir ihre Töne nach dem Schema unserer Dur- und Mollharmonie
mit Versetzungszeichen versehen. Bisher hat freilich dieser Sinn für
historische Kunstauffassung bei unseren Musikern und selbst bei den musikalischen
Historikern noch wenig Fortschritte gemacht. Sie beurteilen alte Musik
meist nach den Vorschriften der modernen Harmonielehre und sind geneigt,
jede Abweichung von der letzteren für bloßes Ungeschick der
Alten zu halten, oder für barbarische Geschmacklosigkeit11).
11) Namentlich in den an fleißig gesammelten Tatsachen
sonst so reichen historisch musikalischen Schriften von R. G.
Kiesewetter herrscht ein offenbar übertriebener Eifer, alles zu
leugnen, was nicht in das Schema der Dur- und Molltonart paßt.
Ehe wir also an die Konstruktion der Tonleitern und der Regeln für
das Harmoniegewebe gehen können, müssen wir die Stilprinzipien
wenigstens der Hauptentwickelungsphasen der musikalischen Kunst zu bezeichnen
suchen. Wir können sie für unsere Zwecke nach drei Hauptperioden
unterscheiden.
1. Die homophone (einstimmige) Musik des Altertums, an
welche sich auch die jetzt bestehende Musik der orientalischen und
asiatischen Völker anschließt.
2. Die polyphone Musik des Mittelalters, vielstimmig, aber noch
ohne Rücksicht auf die selbständige musikalische Bedeutung der
Zusammenklänge, vom 10. bis in das 17. Jahrhundert reichend, wo sie
dann übergeht in
3. die harmonische oder moderne Musik, charakterisiert
durch die selbständige Bedeutung, welche die Harmonie als solche gewinnt.
Ihre Ursprünge fallen in das 16. Jahrhundert.
l. Die homophone Musik.
Die einstimmige Musik ist bei allen Völkern die ursprüngliche
gewesen. Wir finden sie noch bei den Chinesen, Indern, Arabern, Türken
und Neugriechen in diesem Zustande, trotzdem diese Völker zum Teil
sehr ausgebildete Musiksysteme besitzen. Daß die Musik der hellenischen
Blütezeit, abgesehen vielleicht von einzelnen Instrumentalverzierungen,
Kadenzen und Zwischenspielen, durchaus einstimmig gewesen ist, oder die
Stimmen mit einander höchstens in der Oktave gingen, kann jetzt wohl
als festgestellt gelten. In den Problemen des Aristoteles12)
wird gefragt: "Weshalb wird die Konsonanz der Oktave allein gesungen? Diese
spielen sie auf der Magadis (einem harfenähnlichen Instrumente), aber
keine von den anderen Konsonanzen." An einer anderen Stelle bemerkt er,
daß die Stimmen von Knaben und Männern, die in Wechselgesängen
zusammenwirken, das Intervall einer Oktave zwischen sich lassen.
12) Probl. XIX, 18 und 39. Gegen das Ende der Gesänge
seheint zuweilen die Instrumentalbegleitung sich von der Stimme getrennt
zu haben. Man scheint dies unter dem Namen der Krusis
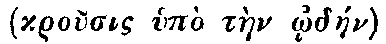
verstehen zu müssen. Siehe Arist. Probl. XIX, 39
und Plutarch de Musica XIX, XXVIII. Daß sie übrigens die Wirkung
der Konsonanzen kannten, aber nicht liebten, zeigt die Stelle Aristoteles
de Audibilibus. Ed. Bekker S. 801: "Deshalb verstehen wir auch
besser, wenn wir nur einen hören, als wenn viele dasselbe sagen. Ebenso
auf den Saiten. Und noch viel schlimmer ist es, wenn gleichzeitig die Kithara
gespielt und dazu die Flöte geblasen wird, weil die Stimmen dann mit
den anderen zusammenfließen. Besonders ist dies bei den Konsonanzen
deutlich. Beide Töne verbergen sich nämlich unter einander.
Einstimmige Musik, allein und für sich genommen ohne Begleitung
der Poesie, ist zu arm an Formen und Veränderungen, als daß
sich darin größere und reichere Kunstformen entwickeln könnten.
Daher ist die reine Instrumentalmusik in diesem Stadium notwendig beschränkt
auf kurze Tanzstückchen oder Märsche; mehr findet sich in der
Tat nicht vor bei den Völkern, welche keine harmonische Musik haben.
Zwar haben Flötenvirtuosen13) in den pythischen Spielen
wiederholt den Sieg davongetragen, aber Virtuosenkünste lassen sich
auch in knappen Kompositionsformen, z. B. in Variationen einer kurzen Melodie,
ausführen. Daß übrigens das Prinzip der Variationen (meiabolh
) einer Melodie mit Berücksichtigung des dramatischen Ausdrucks (meiabolh)
den Griechen bekannt war, geht ebenfalls aus Aristoteles (Problem
15) hervor. Er beschreibt die Sache sehr deutlich und bemerkt, daß
man die Chöre müsse die Melodien in den Antistrophen einfach
wiederholen lassen, weil viele Variationen anzubringen einem leichter sei,
als vielen. Die Wettkämpfer aber und die Schauspieler könnten
dergleichen ausführen.
13) Vielleicht waren die
Variationen unseren Oboen ähnlicher.
Umfangreichere Kunstwerke kann homophone Musik nur als Gesang in Verbindung
mit der Poesie bilden, und in dieser Weise ist die Musik auch im klassischen
Altertum angewendet worden. Nicht nur Lieder (Oden) und religiöse
Hymnen wurden gesungen, sondern selbst Tragödien und große epische
Gesänge wurden in einer gewissen Weise musikalisch vorgetragen und
mit der Lyra begleitet. Wir können uns jetzt schwer eine Vorstellung
davon machen, wie das geschah, da wir nach unserer modernen Geschmacksrichtung
gerade im Gegenteil von einem guten Deklamator oder Vorleser dramatische
Naturwahrheit im Sprechton verlangen, und singenden Ton als einen der größten
Fehler betrachten. In dem singenden Tone der italienischen Deklamatoren,
in den liturgischen Rezitationen der römisch-katholischen Priester
mögen wir Nachklänge des antiken Sprechgesanges haben. Übrigens
lehrt eine etwas aufmerksamere Beobachtung bald, daß auch im gewöhnlichen
Sprechen, wo der singende Ton der Stimme hinter den Geräuschen, welche
die einzelnen Buchstaben charakterisieren, mehr versteckt wird, wo ferner
die Tonhöhe nicht genau festgehalten wird und schleifende Übergänge
in der Tonhöhe häufig eintreten, sich dennoch gewisse, nach regelmäßigen
musikalischen Intervallen gebildete Tonfälle unwillkürlich einfinden.
Wenn einfache Sätze gesprochen werden ohne Affekt des Gefühls,
so wird meist eine gewisse mittlere Tonhöhe festgehalten, und nur
die betonten Worte und die Enden der Sätze und Satzabschnitte werden
durch einen Wechsel der Tonhöhe hervorgehoben. Das Ende eines bejahenden
Satzes vor einem Punkte pflegt dadurch bezeichnet zu werden, daß
man von der mittleren Tonhöhe um eine Quarte fällt. Der fragende
Schluß steigt empor, oft um eine Quinte über den Mittelton.
Zum Beispiel eine Baßstimme spricht:

Akzentuierte Worte werden ebenfalls dadurch hervorgehoben, daß
man sie etwa einen Ton höher legt als die übrigen, und so fort.
Beim feierlichen Deklamieren werden die Tonfälle mannigfacher und
komplizierter. Das moderne Rezitativ ist durch Nachahmung dieser Tonfälle
in gesungenen Noten entstanden. Darüber spricht sich sein Erfinder
Jacob Peri in der Vorrede zu seiner 1600 herausgegebenen Oper Eurydice
ganz deutlich aus. Man suchte damals durch das Rezitativ die Deklamation
der antiken Tragödien wieder herzustellen. Nun ist allerdings die
antike Rezitation von unserem modernen Rezitative dadurch einigermaßen
verschieden gewesen, daß jene das Metrum der Gedichte genauer festhielt
und ihr die begleitenden Harmonien des letzteren fehlten. Indessen können
wir doch aus unserem Rezitative, wenn es gut vorgetragen wird, einen besseren
Begriff davon erhalten, wie sehr durch eine solche musikalische Rezitation
der Ausdruck der Worte gesteigert werden kann, als durch die monotone Rezitation
der römischen Liturgie, obgleich die letztere der Art nach vielleicht
der antiken Rezitation ähnlicher ist, als das Opernrezitativ. Die
Feststellung der römischen Liturgie durch Papst Gregor den Großen
(590 bis 604) reicht zurück in eine Zeit, wo Reminiszenzen der
alten Kunst, wenn auch verblaßt und entstellt, durch Tradition noch
überliefert sein konnten, namentlich wenn, wie man wohl als wahrscheinlich
annehmen darf, Gregorius im Wesentlichen nur die Normen für
die schon seit der Zeit des Papstes Sylvester (314 bis 335) bestehenden
römischen Singschulen endgültig festgestellt hat. Die meisten
dieser Formeln für die Lektionen, Kollekten u. s. w. ahmen deutlich
den Tonfall des gewöhnlichen Sprechens nach. Sie gehen in gleicher
Tonhöhe fort, einzelne akzentuierte oder nicht lateinische Worte werden
in der Tonhöhe etwas verändert, für jede Interpunktion sind
besondere Schlußformeln vorgeschrieben, z. B. für die Lektionen
nach Münsterschem Gebrauche14):

14) Antony, Lehrbuch des Gregorianischen Kirchengesanges.
Münster 1829. Nach den von Fétis in seiner Histoire
générale de Musique, Paris 1869, Thl. I, Cap. VI zusammengestellten
Nachrichten ist es übrigens zweifelhaft geworden, ob dieses System
der Deklamation mit vorgeschriebenen Kadenzen nicht vielmehr aus dem jüdischen
Ritualgesange herzuleiten ist. Schon in den ältesten Handschriften
des alten Testaments finden sich 25 verschiedene Zeichen für solche
Kadenzen und melodische Phrasen angewendet. Ja der Umstand, daß die
entsprechenden Zeichen der griechischen Kirche ägyptische Schriftzeichen
des Demotischen Alphabets sind, deutet auf einen viel älteren ägyptischen
Ursprung dieser Notation hin.
Nach der Feierlichkeit des Festes, dem vorgetragenen Gegenstande, dem
Range des vortragenden oder darauf antwortenden Priesters sind diese und
ähnliche Schlußformeln bald mehr, bald weniger verziert. Man
erkennt leicht in ihnen das Streben, die natürlichen Tonfälle
der gewöhnlichen Sprache nachzuahmen, aber so, daß sie von ihren
individuellen Unregelmäßigkeiten befreit, feierlicher klingen.
Freilich wird in solchen feststehenden Formeln auf den grammatischen Sinn
der Sätze nicht geachtet, der denn doch die Betonung sehr mannigfaltig
abändert. In ähnlicher Weise kann man sich denken, daß
die antiken Tragödiendichter ihren Schauspielern die Tonfälle
vorschrieben, in denen gesprochen werden sollte, und sie durch musikalische
Begleitung darin erhielten. Und da sich die antike Tragödie von unmittelbarer
äußerlicher Natur-Wahrheit viel mehr entfernt hielt als das
moderne Schauspiel, wie die künstlichen Rhythmen, die ungewöhnlichen
volltönenden Worte, die steifen fremdartigen Masken zeigen, so konnte
auch ein mehr singender Ton zur Deklamation passen, als er unserem modern
gewöhnten Ohre vielleicht gefallen würde. Dann müssen wir
bedenken, daß durch Akzentuierung (Vermehrung der Tonstärke)
einzelner Worte, durch die Schnelligkeit oder Langsamkeit des Sprechens,
durch Pantomimik sich noch viel Leben in eine solche Vortragsweise bringen
läßt, die freilich unerträglich monoton wird, wenn der
Vortragende sie nicht auf solche Weise zu beleben weiß.
Jedenfalls aber hat die homophone Musik, auch wo sie in alter Zeit ausgedehnte
Dichtungen größter Art zu begleiten hatte, immer notwendig eine
ganz unselbständige Rolle gespielt. Die musikalischen Wendungen mußten
eben durchaus von dem wechselnden Sinn der Worte abhängen, und konnten
ohne diesen keinen selbständigen Kunstwert und Zusammenhang haben.
Eine eigentliche durchgehende Melodie zum Absingen von Hexametern in den
Epen oder von jambischen Trimetern in den Tragödien wäre unerträglich
gewesen. Freier dagegen und selbständiger sind wohl diejenigen Melodien
(Nomen) gewesen, welche man den Oden und tragischen Chören unterlegte.
Für die Oden gab es auch bekannte Melodien, deren Benennungen zum
Teil noch aufbewahrt sind, auf welche man immer wieder neue Gedichte machte.
In den großen ausgeführten Kunstwerken also mußte die
Musik ganz unselbständig sein, selbständig konnte sie nur kurze
Sätze bilden. Damit hängt nun ganz wesentlich die Ausbildung
des musikalischen Systems der homophonen Musik zusammen. Wir finden allgemein
bei den Nationen, welche dergleichen Musik besitzen, gewisse Stufenleitern
der Tonhöhe festgesetzt, in denen sich die Melodien bewegen. Diese
Tonleitern sind sehr mannigfacher, zum Teil, wie es aussieht, sehr willkürlicher
Art, so daß viele uns ganz fremdartig und unbegreiflich erscheinen,
während sie doch von den begabteren unter den Nationen, denen sie
angehören, von den Griechen, Arabern und Indern außerordentlich
subtil und mannigfaltig ausgebildet worden sind.
Bei der Besprechung dieser Tonsysteme ist nun für unseren vorliegenden
Zweck die Frage von wesentlicher Wichtigkeit, ob in ihnen eine bestimmte
Beziehung aller Töne der Leiter auf einen einzigen Haupt- und Grundton,
die Tonica, zu Grunde gelegen hat. Die neuere Musik bringt einen
rein musikalischen inneren Zusammenhang in alle Töne eines Tonsatzes
dadurch, daß alle in ein dem Ohre möglichst deutlich wahrnehmbares
Verwandtschaftsverhältnis zu einer Tonica gesetzt werden. Wir können
die Herrschaft der Tonica als des bindenden Mittelgliedes für sämtliche
Töne des Satzes mit Fétis als das Prinzip der Tonalität
bezeichnen. Dieser gelehrte Musiker hat mit Recht darauf aufmerksam
gemacht, daß in den Melodien verschiedener Nationen die Tonalität
in sehr verschiedenem Grade und verschiedener Weise entwickelt sei. Sie
ist namentlich in den Liedern der Neugriechen, in den Gesangsformeln der
griechischen Kirche und in dem Gregorianischen Gesange der römischen
Kirche nicht in der Art entwickelt, daß diese Melodien leicht zu
harmonieren wären, wahrend Fétis15) im Ganzen
fand, daß die alten Melodien der nordischen Völker germanischen,
keltischen und slawischen Ursprungs sich leicht mit harmonischer Begleitung
versehen lassen.
15) Fétis' Biographie universelle des musiciens
T. I, p. 126.
In der Tat ist es auffallend, daß in den musikalischen Schriften
der Griechen, welche Subtilitäten oft in recht weitläufigerweise
behandeln und über alle möglichen anderen Eigentümlichkeiten
der Tonleitern den genauesten Aufschluß geben, nichts deutlich gesagt
ist über eine Beziehung, welche in dem modernen System allen anderen
vorgeht, und sich überall auf das Deutlichste fühlbar macht.
Die einzigen Hindeutungen auf die Existenz einer Tonica finden wir nicht
bei den musikalischen Schriftstellern, sondern wieder bei Aristoteles16).
Dieser fragt nämlich:
Wenn Jemand von uns den Mittelton (????)
verändert, nachdem er die anderen Saiten gestimmt hat, und
das Instrument gebraucht, warum klingt alles übel und scheint schlecht
gestimmt, nicht nur wenn er an den Mittelton kommt, sondern auch durch
die ganze andere Melodie? Wenn er aber den Lichanos oder irgend einen anderen
Ton verändert hat, so tritt ein Unterschied nur hervor, wenn man gerade
diesen gebraucht. Geschieht dies nicht mit gutem Grunde? Denn alle guten
Melodien gebrauchen oft den Mittelton, und alle guten Komponisten kommen
oft zum Mittelton hin, und wenn sie von ihm fortgehen, kehren sie bald
wieder zurück, zu keinem anderen aber in gleicher Weise." Dann vergleicht
er den Mittelton noch mit den Bindewörtern der Sprache, namentlich
denen, welche "und" bedeuten und ohne die die Sprache nicht bestehen könne.
"So auch ist der Mittelton wie ein Band der Töne, und namentlich der
schönen, weil sein Ton am meisten vorhanden ist." An einer anderen
Stelle finden wir dieselbe Frage wieder mit etwas geänderter Antwort:
"Warum, wenn der Mittelton verändert wird, klingen auch die anderen
Saiten wie verdorben? Wenn aber jener bleibt, und von den anderen eine
verändert wird, so wird die veränderte allein verdorben. Ist
dies so, weil sowohl das Gestimmtwerden allen zukommt, als auch allen ein
gewisses Verhalten zum Mittelton, und durch diesen schon die Ordnung einer
jeden gegeben ist? Wenn aber der Grund der Stimmung und das Zusammenhaltende
weggenommen wird, so scheint Ordnung nicht mehr in gleicher Weise vorhanden
zu sein." In diesen Sätzen ist die ästhetische Bedeutung einer
Tonica, als welche hier der Mittelton genannt wird, so gut beschrieben,
wie es nur irgend geschehen kann. Dazu kommt noch, daß von den Pythagoräern
der Mittelton mit der Sonne, die anderen Töne der Leiter mit den Planeten
verglichen werden17). Man scheint auch der Regel nach mit dem
genannten Mitteltone den Gesang begonnen zu haben, denn im 33sten Probleme
des Aristoteles heißt es: "Warum ist es harmonischer, von
der Höhe nach der Tiefe, als von der Tiefe zur Höhe zu gehen?
Vielleicht weil jenes ist vom Anfange angefangen? Denn der Mittelton ist
auch der höchst gelegene Führer des Tetrachordes (nämlich
des unteren). Das andere aber hieße nicht vom Anfange, sondern vom
Ende anfangen. Oder ist vielleicht das Tiefe nach dem Hohen edler und wohlklingender?"
Daraus scheint aber auch hervorzugehen, daß man mit dem Mitteltone,
mit welchem man anfing, nicht zu schließen pflegte, sondern mit dem
tiefsten Tone, der Hypate, von welcher letzteren wieder Aristoteles
im vierten Probleme sagt, daß diese im Gegensatz zu der dicht
darüber liegenden Parhypate mit vollem Nachlaß jeder
Anspannung gesungen werde, welche bei der anderen noch vorhanden sei. Diese
Worte des Aristoteles werden wir jedenfalls auf die nationale dorische
Skala der Hellenen anwenden dürfen, welche, von Pythagoras auf
acht Töne erweitert, folgende war:
Tiefes Tetrachord
|
E Hypate |
| F Parhypate |
| G Lichanos |
| A Mese (Mittelton). |
|
Höheres Tetrachord
|
H Paramese |
| C Trite |
| D Paranete |
| E Nete. |
16) Problemata 20 und 36. Im Anfang des letzteren ist
nach einer Konjektur meines Kollegen Stark statt 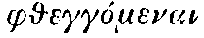 und
und 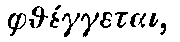 was
keinen vernünftigen Sinn gibt, zu setzen
was
keinen vernünftigen Sinn gibt, zu setzen 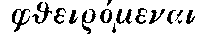 und
und  Die erste Stelle ist auch von Ambrosch schon teilweise zitiert.
Die erste Stelle ist auch von Ambrosch schon teilweise zitiert.
17) Nicomachus Harmonice Lib. I, p. 6. Edit.
Meibomii.
Nach moderner Ausdrucksweise liegt in der zuletzt zitierten Beschreibung
des Aristoteles, daß die Parhypate eine Art absteigenden Leitton
für die Hypate bildet. In dem Leitton ist die Anstrengung fühlbar,
welche mit seinem Übergange in den Grundton aufhört.
Wenn nun der Mittelton der Tonica entspricht, so ist die Hypate deren
Quinte, die Dominante. Für unser Gefühl ist es aber viel notwendiger
mit der Tonica zu schließen, als mit ihr anzufangen, und wir erklären
deshalb gewöhnlich ohne Weiteres den Schlußton eines Satzes
für dessen Tonica. Doch läßt die moderne Musik der Regel
nach die Tonica auch in dem ersten akzentuierten Taktteile des Anfangs
hören. Die ganze Tonmasse entwickelt sich aus der Tonica heraus und
kehrt wieder in sie zurück. Eine volle Beruhigung im Schlusse ist
nicht möglich, als indem die Tonreihe in das verbindende Zentrum des
ganzen Satzes ausläuft.
In dieser Beziehung also scheint die ältere griechische Musik von
der unserigen abgewichen zu sein, indem sie auf der Dominante endigte,
nicht auf der Tonica. Übrigens steht dies in vollkommener Analogie
mit der Betonung beim Sprechen. Wir haben gesehen, daß das Ende der
bejahenden Sätze ebenfalls auf der nächst tieferen Quinte des
Haupttones gebildet wird. Dieselbe Eigentümlichkeit ist auch in dem
modernen Rezitative meist beibehalten, in welchem die Gesangstimme auf
der Dominante zu enden pflegt, wo sie von den Instrumenten mit dem Dominantseptimenakkorde
aufgenommen wird, dem der Akkord der Tonica folgt, um den für unser
musikalisches Gefühl nötigen Schluß in der Tonica zu bilden.
Da nun die griechische Musik sich an der Rezitation von epischen Hexametern
und jambischen Trimetern herangebildet hat, wird es uns nicht überraschen
dürfen, wenn auch in den Melodien für Oden die erwähnten
Eigentümlichkeiten des Sprechgesanges so herrschend blieben, daß
Aristoteles sie als Regel betrachten konnte18).
18) Unter den angeblich antiken Melodien, welche uns überliefert
sind, zeigt das von B. Marcello veröffentlichte Bruchstück
aus der homerischen Ode an die Demeter die besprochene Eigentümlichkeit
sehr deutlich.
Aus den angeführten Tatsachen geht hervor, worauf es für unseren
Zweck besonders ankommt, daß den Griechen, bei denen sich unsere
diatonische Leiter zuerst ausgebildet hat, das Gefühl für Tonalität
in ästhetischer Beziehung nicht fehlte, daß es aber doch nicht
so entschieden ausgebildet war, wie in der neueren Musik, und namentlich,
wie es scheint, sich in den technischen Regeln der Melodiebildung durchaus
nicht deutlich geltend machte. Daher ist eben Aristoteles, der die
Musik als Ästhetiker behandelt, der einzige Schriftsteller, so weit
bisher bekannt ist, der davon spricht; die eigentlich musikalischen Schriftsteller
erwähnen es gar nicht. Leider sind auch die Andeutungen des Aristoteles
so sparsam, daß Zweifel genug übrig bleiben. Namentlich
erwähnt er nichts über die Verschiedenheiten der verschiedenen
Tongeschlechter in Bezug auf den Hauptton, so daß gerade der wichtigste
Gesichtspunkt, aus dem wir den Bau der griechischen Tonleitern zu betrachten
hätten, fast ganz im Dunkel bleibt.
Bestimmter findet sich die Beziehung auf eine Tonica ausgesprochen in
den Tonleitern der altchristlichen Kirchenmusik. Man unterschied ursprünglich
die vier sogenannten authentischen Tonleitern, wie sie vom Bischof Ambrosius
von Mailand ( 398) festgesetzt waren. Keine von diesen stimmt mit
einer unserer Tonleitern überein; die später von Gregorius
hinzugefügten vier plagalischen Tonreihen sind keine Tonleitern
in unserem Sinne des Wortes. Die vier authentischen Tonleitern des Ambrosius
sind:
1) DEFGAHCD
2) EFGAHCDE
3) FGAHCDEF
4) GAHCDEFG
Doch war die Veränderung des H in B vielleicht von
Anfang an erlaubt; dadurch wurde dann die erste Tonleiter unserer absteigenden
Molltonleiter gleich, die dritte eine F-Durtonleiter. Die alte Regel war,
daß die Gesänge der ersten Leiter in D schlossen, die
der zweiten in E, der dritten in F, der vierten in G.
Dadurch waren also diese Töne in unserem Sinne als Tonica charakterisiert.
Aber die Regel wurde nicht strenge gehalten. Man konnte auch in anderen
Tönen der Leiter, sogenannten Confinaltönen schließen,
und schließlich wurde die Verwirrung so groß, daß Niemand
mehr recht zu sagen wußte, woran man die Tonart erkennen solle. Es
wurden allerlei unzureichende Regeln aufgestellt, und man griff zu dem
mechanischen Hilfsmittel, gewisse Anfangs- und Schlußphrasen, die
sogenannten Tropen, festzusetzen, welche die Tonart charakterisieren
sollten.
Obgleich man also bei diesen mittelalterlichen Kirchentonarten die Regel
der Tonalität schon bemerkt hatte, war die Regel selbst doch so unsicher,
und erlaubte so viele Ausnahmen, daß wir auch hier nicht zweifeln
können, daß das Gefühl für die Tonalität viel
unentwickelter gewesen sei, als in der modernen Musik.
Den Begriff der Tonica haben übrigens auch die Indier gefunden,
deren Musik ebenfalls einstimmig ist. Sie nennen sie "Ansa"19).
Die indischen Melodien, wie sie von englischen Reisenden nachgeschrieben
sind, erscheinen übrigens den modernen europäischen Melodien
sehr ähnlich. Dasselbe haben Fétis und Coussemaker20)
bemerkt in Bezug auf die wenigen bekannten Reste alt germanischer und keltischer
Melodien.
19) Jones, Über die Musik der Indier, übersetzt
von Dalberg. S. 36 und 37.
20) Histoire de l'Harmonie au moyen ?ge. Paris 1862, p.
5 bis 7.
Wenn also auch die Beziehung auf einen vorherrschenden Ton, die Tonica,
der einstimmigen Musik nicht ganz fehlt, so ist sie ohne Frage viel schwächer
entwickelt gewesen als in der modernen Musik, wo wenige einander folgende
Akkorde hinreichen, um festzustellen, in welcher Tonart die betreffende
Stelle des Stücks sich bewegt. Es scheint mir dies seinen Grund zu
haben in dem unentwickelten Zustande und in der untergeordneten Rolle,
welche der homophonen Musik notwendig zukommen. Melodien, die sich in wenigen
leicht übersehbaren Tönen auf und ab bewegen, die ihren Zusammenhang
durch ein nicht musikalisches Hilfsmittel, nämlich die Worte der Poesie,
schon haben, bedürfen keines konsequent durchgeführten musikalischen
Bindemittels. Auch in dem modernen Rezitative wird die Tonalität viel
weniger festgehalten, als in anderen Kompositionsformen. Die Notwendigkeit
einer festen Bindung der Tonmassen durch rein musikalische Beziehungen
drängt sich dem Gefühl erst dann deutlicher auf, wenn große
Massen von Tönen, die eine selbständige Bedeutung ohne Hilfe
der Poesie haben sollen, künstlerisch zusammen zu schließen
sind.
2. Polyphone Musik.
Der zweite Entwickelungsabschnitt der Musik ist die polyphone Musik
des Mittelalters. Gewöhnlich wird als die zuerst erfundene vielstimmige
Musik das sogenannte Organum oder die Diaphonie angeführt,
wie sie der flandrische Mönch Hucbald im Anfange des zehnten
Jahrhunderts zuerst beschrieben habe. Dabei sollen zwei Stimmen in Quinten
oder Quarten neben einander hergegangen, zuweilen auch Verdoppelungen einer
oder beider in der Oktave hinzugefügt seien. Es gibt dies eine für
uns unerträgliche Musik. Nach O. Paul21) hat es
sich dabei aber nicht um eine gleichzeitige Ausführung beider Stimmen
gehandelt, sondern um eine beantwortende Wiederholung einer Melodie in
transponierter Lage, und Hucbald wäre somit als der Erfinder
dieses später in der Fuge und Sonate so wichtig gewordenen Prinzips
anzusehen.
21) Geschichte des Klaviers. Leipzig 1868, S. 49.
Die erste unzweifelhafte Form prinzipmäßig mehrstimmiger Musik
war der sogenannte Discantus, welcher um das Ende des elften Jahrhunderts
in Frankreich und Flandern bekannt wurde. Die ältesten aufbewahrten
Beispiele dieses Discantus sind von der Art, daß zwei ganz verschiedene
Melodien und zwar schien man sie gern so verschiedenartig wie möglich
zu wählen aneinander gepaßt wurden durch kleine Veränderungen
des Rhythmus oder der Tonhöhen, bis sie ein einigermaßen konsonierendes
Ganzes bildeten. Zuerst scheint man namentlich gern eine liturgische Formel
mit irgend einem schlüpfrigen Liedchen gepaart zu haben. Die ersten
derartigen Beispiele können nicht wohl irgend eine andere Bedeutung
gehabt haben, als daß es musikalische Kunststückchen zur gesellschaftlichen
Unterhaltung waren. Es war eine neue Entdeckung, an der man sich amüsierte,
daß zwei ganz verschiedene unabhängige Melodien neben einander
gesungen werden konnten und gut zusammen klangen.
Das Prinzip des Discantus war fruchtbar und von solcher Art, daß
jene Zeit es entwickeln konnte; ans ihm ist die eigentlich polyphone Musik
hervorgegangen. Verschiedene Stimmen, jede für sich selbständig
und eine eigene Melodie tragend, sollten vereinigt werden, so daß
sie keine, oder wenigstens nur schnell vorübergehende und sich auflösende
Mißklänge bildeten. Die Konsonanz an sich war nicht Zweck, nur
ihr Gegenteil, die Dissonanz, sollte vermieden werden. Alles Interesse
konzentrierte sich auf die Bewegung der Stimmen. Um die verschiedenen Stimmen
zusammenzuhalten, war strenges Einhalten des Taktes nötig, es entwickelte
sich deshalb unter dem Einflusse des Discantus in reicher Mannigfaltigkeit
das System der musikalischen Rhythmik, welches wiederum dazu beitrug die
Melodiebewegung kräftiger und eindringlicher zu machen. Der Gregorianische
Cantus firmus kannte keine Takteinteilung, und die Rhythmik
der Tanzmusik war wohl äußerst einfach gewesen. Außerdem
wuchs der Reichtum und das Interesse der melodischen Bewegung in dem Maße,
als sich die Stimmen vervielfältigten. Um aber zwischen den verschiedenen
Stimmen einen künstlerischen Zusammenhang herzustellen, welcher anfangs,
wie wir sahen, gänzlich fehlte, war noch eine neue Erfindung nötig.
Diese tauchte zuerst in kleinen Anfängen auf, erlangte aber schließlich
eine die ganze moderne Kompositionskunst beherrschende Wichtigkeit. Sie
bestand darin, daß man die musikalische Phrase, welche eine Stimme
vorgetragen hatte, durch eine andere wiederholen ließ; es entstanden
also kanonische Nachahmungen, wie wir sie vereinzelt schon in Discanten
aus dem zwölften Jahrhundert finden22). Diese entwickelten
sich allmählich zu einem höchst künstlichen Systeme, namentlich
bei den niederländischen Komponisten, die freilich schließlich
oft mehr Berechnung als Geschmack in ihren Kompositionen zeigten.
22) Coussemaker l. c. Déchant: Custodi nos.
Pl. XXVII, Nro. IV. Übersetzt in p. XXVII, Nro. XXIX.
Aber durch diese Art der polyphonen Musik, die Wiederholung derselben
Melodiewendungen hinter einander in verschiedenen Stimmen, war jetzt zuerst
die Möglichkeit gegeben, große breit angelegte musikalische
Sätze zu komponieren, welche ihren künstlerischen Zusammenhang
nicht mehr in der Verbindung mit einer fremden Kunst, der Poesie, sondern
in rein musikalischen Mitteln fanden. Es paßte diese Art der Musik
auch in hohem Grade für kirchliche Gesänge, in denen der Chor
die Empfindungen einer ganzen, aus verschiedenartigen Individuen zusammengesetzten
Gemeinde auszudrücken hatte. Aber man wendete sie nicht allein auf
kirchliche Kompositionen an, sondern auch auf weltliche Gesänge, Lieder
(Madrigale). Man kannte eben noch keine andere Form harmonischer Musik,
welche künstlerisch ausgebildet gewesen wäre, als die auf kanonische
Wiederholungen gegründete. Verschmähte man diese, so war man
auf homophone Musik beschränkt. Daher finden sich denn auch eine Menge
Lieder als strenge Kanons oder in kanonischen Wiederholungen komponiert,
deren Inhalt ganz und gar nicht für eine so schwerfällige Weise
geeignet ist. Auch die ältesten Beispiele mehrstimmiger Instrumentalkompositionen,
Tanzstücke aus dem Jahre 152923), sind in dem Stile der
Madrigale und Motetten komponiert, einer Kompositionsweise, die sich in
freierer Behandlung übrigens bis in die Suiten aus S. Bach's und
Händel's Zeit hinüberzieht. Selbst in den ersten Versuchen
zu musikalischen Dramen im sechzehnten Jahrhundert hatte man noch keine
andere Form, die handelnden Personen ihre Gefühle musikalisch aussprechen
zu lassen, als daß man durch einen Chor Madrigale in fugiertem Stile
hinter oder auf der Bühne absingen ließ. Man kann sich von unserem
Standpunkte aus kaum in den Zustand einer Kunst hineinversetzen, welche
die kompliziertesten Stimmgebäude in ihren Chören aufbaut, und
dabei nicht im Stande ist, zu einer Liedermelodie oder zu einem Duett eine
einfache Begleitung zu setzen, um die Harmonie vollständig zu machen.
Und doch wenn man liest, wie die Erfindung des Rezitativs mit einfacher
Akkordbegleitung durch Jacob Peri gefeiert und bewundert wurde,
welche Streitigkeiten sich über den Ruhm dieser Erfindung erhoben,
welches Aufsehen Viadana erregte, indem er zu einstimmigen und zweistimmigen
Gesängen einen Basso continuo zu setzen erfand, als
eine in sich unselbständige Stimme, die nur der Harmonie dienen sollte24),
so kann man nicht zweifeln, daß diese Kunst, eine Melodie durch Akkorde
zu begleiten, die jetzt jeder Dilettant in einfachster Weise zu lösen
weiß, den Musikern bis zum Ende des sechzehnten Jahrhunderts noch
vollständig verborgen war. Erst im sechzehnten Jahrhundert fing man
an, sich der Bedeutung bewußt zu werden, welche die Akkorde als Teile
des Harmoniegewebes unabhängig von der Stimmführung besitzen.
23) Winterfeld, Johannes Gabrieli und sein Zeitalter.
Bd. IT. S. 41.
24) Winterfeld, l. c. Bd. II, S. 19 und S. 59.
Diesem Zustande der Kunst entsprach der Zustand des Tonsystems. Es wurden
im Wesentlichen die alten Kirchentonarten beibehalten, von denen die erste
die Tonreihe von D bis d, die zweite von E bis e,
die dritte von F bis f, die vierte von G bis g
umfaßte. Unter diesen war die von F bis f gehende
zur harmonischen Bearbeitung unbrauchbar, weil sie statt der Quarte FB
den Tritonus FH enthielt. Andererseits war kein Grund vorhanden,
die Reihen von C bis c und von G bis g auszuschließen.
So veränderten sich die Kirchentonarten unter dem Einfluß der
polyphonen Musik. Da man aber trotz der Veränderung die alten unpassenden
Namen beibehielt, entstand eine arge Verwirrung in der Auffassung der Tonarten.
Erst als das Ende dieser Periode herannahete, unternahm es ein gelehrter
Theoretiker, Glareanus in seinem Dodecachordon (Basel 1547), die
Lehre von den Tonarten wieder in Ordnung zu bringen. Er unterschied 12
solche, 6 authentische und 6 plagalische, und teilte ihnen griechische
Namen zu, die aber unrichtig übertragen waren. Doch ist seine Nomenklatur
für die Kirchentonarten später allgemein beibehalten worden.
Die authentischen Kirchentöne des Glareanus mit ihren griechischen
Namen sind folgende sechs:
Jonisch: CDEFGAHC
Dorisch: DEFGAHCD
Phrygisch: EFGAHCDE
Lydisch: FGAHCDEF
Mixolydisch: GAHCDEFG
Aeolisch: AHCDEFGA
Jonisch entspricht unserem Dursystem, Aeolisch unserem Moll;
Lydisch ist in polyphoner Musik wegen der falschen Quarte kaum gebraucht
worden, und immer nur mit allerlei Veränderungen.
Wie wenig man die musikalische Bedeutung des Harmoniegewebes zu beurteilen
wußte, zeigt sich nun in der Lehre von den Tonarten wieder darin,
daß bei Beurteilung der Tonart einer polyphonen Komposition immer
nur einzelne Stimmen berücksichtigt wurden. Glareanus schreibt
in gewissen Kornpositionen den verschiedenen Stimmen, dem Tenor und Basse,
dem Sopran und Alt verschiedene Tonarten zu; Zarlino nimmt den Tenor
als Hauptstimme, nach welcher die Tonart zu beurteilen sei.
Die praktischen Folgen dieser Nichtbeachtung der Harmonie zeigen sich
mannigfaltig in den Kompositionen. Man beschränkte sich im Ganzen
auf die Töne der diatonischen Leiter; Versetzungszeichen wurden wenig
angewendet. Die Erniedrigung- des Tones H in B war schon
bei den Griechen in einem eigenen Tetrachorde, dem der Synemmenoi, eingeführt
und wurde beibehalten. Außerdem wird zuweilen ein vor f,
c und g gebraucht, um in den Cadenzen Leittöne zu gewinnen.
Es fehlte also die Modulation in unserem Sinne aus der Tonart einer Tonica
in die einer anderen mit anderen Vorzeichnungen fast ganz. Ferner blieben
die bevorzugten Akkorde bis zum Ende des fünfzehnten Jahrhunderts
die aus Oktaven und Quinten ohne Terz gebildeten, welche uns leer klingen,
und die wir zu vermeiden suchen. Sie erschienen den Tonsetzern des Mittelalters
als die wohlklingendsten, weil sie nur das Bedürfnis möglichst
vollkommener Konsonanzen hatten; namentlich durften nur solche im Schlußakkorde
vorkommen. Die vorkommenden Dissonanzen sind allgemein solche, welche durch.
Vorhalt und Durchgangstöne eintreten, die Septimenakkorde, welche
in der neueren Harmonie eine so große Wichtigkeit für die Bezeichnung
der Tonart, für die Bindung und die Beschleunigung der harmonischen
Schritte haben, fehlten.
So groß also auch die künstlerische Ausbeute dieses Zeitraumes
in der Rhythmik und in der Kunst der Stimmführung gewesen ist, für
die Harmonik und das Tonsystem hat es wenig mehr geleistet, als daß
es eine Menge noch ungeordneter Erfahrungen zusammengehäuft hat. Da
Akkorde durch die verwickelten Stimmgänge in mannigfachen Umlagerungen
und Folgen entstanden, so konnten die Musiker dieses Zeitraumes nicht umhin,
diese Akkorde zu hören und ihre Wirkung kennen zu lernen, wenn sie
auch noch wenig Geschicklichkeit zeigen, solche Wirkungen zu benutzen.
Jedenfalls bereiteten die Erfahrungen dieses Zeitraumes die Entwickelung
der eigentlich harmonischen Musik vor, und machten es den Musikern möglich,
eine solche zu produzieren, als äußere Einwirkungen auf eine
solche Erfindung hindrängten.
3. Die harmonische Musik.
Die moderne harmonische Musik ist dadurch charakterisiert, daß
in ihr die Harmonie eine selbständige Bedeutung für den Ausdruck
und für den künstlerischen Zusammenhang der Komposition erhält.
Die äußeren Anstöße zu dieser Umformung der Musik
waren mehrfacher Art. Der erste ging vom protestantischen Kirchengesange
aus. Es lag im Prinzip des Protestantismus, daß die Gemeinde selbst
den Gesang übernehmen mußte; man konnte ihr aber nicht zumuten,
die künstlichen rhythmischen Verschlingungen der niederländischen
Polyphonie durchzuführen. Dagegen waren die Stifter der neuen Konfession,
Luther an ihrer Spitze, zu sehr durchdrungen von der Macht und Bedeutung
der Musik, um dieselbe sogleich auf einen schmucklosen einstimmigen Gesang
zurückzuführen. Es entstand deshalb für die Komponisten
des protestantischen Kirchengesanges die Aufgabe, einfach harmonierte Choräle
zu setzen, in denen alle Stimmen gleichzeitig fortschritten. Dadurch waren
die kanonischen Wiederholungen der gleichen melodischen Phrasen in verschiedenen
Stimmen abgeschnitten, und diese waren es ja, welche hauptsächlich
die Einheit des Ganzen zusammengehalten hatten. Es mußte nun im Klange
der Töne selbst ein neues Verbindungsprinzip gesucht werden, und dies
ergab sich durch die strengere Beziehung auf eine herrschende Tonica. Erleichtert
wurde das Gelingen dieser Aufgabe dadurch, daß die protestantischen
Kirchenlieder zum großen Teil schon bestehenden Volksmelodien angeschlossen
wurden, und die Volkslieder der germanischen und keltischen Stämme,
wie schon früher bemerkt wurde, ein festeres Gefühl für
Tonalität im modernen Sinne verrieten, als die der südlichen
Völker. So entwickelte sich schon in den protestantischen Kirchenliedern
des 16. Jahrhunderts das System der Harmonie der jonischen Kirchentollart,
unseres heutigen Dur, ziemlich korrekt, so daß wir in diesen Chorälen
auch heute nichts Fremdartiges für unser Gefühl finden, wenn
auch manche später erfundenen Hilfsmittel zur festen Bezeichnung der
Tonart, wie z. B. die Septimenakkorde, noch fehlen. Dagegen dauerte es
viel länger, ehe die übrigen Kirchentonarten, in deren Harmonisierung
noch viel Unsicherheit herrschte, in unser Mollsystem verschmolzen. Das
protestantische Kirchenlied jener Zeit war von mächtiger Wirkung auf
die Gemüter der Zeitgenossen, und diese wird von allen Seiten in den
lebhaftesten Worten hervorgehoben, so daß man nicht zweifeln kann,
der Eindruck einer solchen Musik sei für sie ein ganz neuer und besonders
mächtiger gewesen.
Auch in der römischen Kirche verlangte man nach einer Änderung
des Kirchengesanges. Die Ausschreitungen der polyphonen Kunst zerrissen
den Sinn der Worte, machten diese unverständlich und machten es dem
ungeübten, häufig wohl auch selbst dem gelehrten und gebildeten
Hörer schwer, das Gewirr der Stimmen aufzulösen. In Folge der
Verhandlungen des Tridentinischen Konzils und im Auftrage des Papstes Pius
IV. hat Palestrina diese Vereinfachung und Verschönerung
des Kirchengesanges vollführt, und soll durch die einfache Schönheit
seiner Kompositionen die vollständige Verdrängung des mehrstimmigen
Gesanges aus der römischen Liturgie verhindert haben. Palestrina,
der für kunstgeübte Sängerchöre schrieb, ließ
die verwickeltere Stimmführung der polyphonen Musik nicht ganz fallen,
aber durch passende Abschnitte und Einteilungen gliederte er sowohl die
Masse der Töne als die Masse der Stimmen, welche letzteren meist in
mehrere Chöre gesondert erscheinen. Mehr oder weniger häufig
treten auch die Stimmen choralmäßig neben einander hergehend
auf, und zwar dann überwiegend in konsonanten Akkorden. Dadurch machte
er seine Sätze übersichtlicher, verständlicher und im Allgemeinen
außerordentlich wohlklingend. Nirgends tritt aber die Abweichung
der Kirchentonarten von den für die harmonische Behandlung ausgebildeten
neueren Tonarten so auffallend hervor, wie bei Palestrina und den
gleichzeitigen italienischen Kirchenkomponisten, unter denen Johannes
Gabrieli, ein Venezianer, noch hauptsächlich zu nennen ist. Palestrina
war der Schüler eines in der Bartholomäusnacht zu Lyon ermordeten
Hugenotten, des Claude Goudimel, von dem harmonische Bearbeitungen
der französischen Psalmen aasgeführt sind, die von der modernen
Art und Weise nicht sehr viel abweichen, namentlich wo sie sich in Dur
bewegen. Die Psalmenmelodien waren aber entweder Volksliedern entnommen
oder solchen wenigstens nachgebildet. Durch seinen Lehrer war also Palestrina
jedenfalls mit dieser Weise der Behandlung bekannt, er hatte es aber
zu tun mit Thematen aus dem Gregorianischen Cantus firmus, die
in Kirchentonarten sich bewegten, deren Charakter streng festgehalten werden
mußte, auch selbst in solchen Sätzen, deren Melodien er selbständig
erfand oder umbildete. Diese Tonarten nötigten zu einer ganz anderen
Weise harmonischer Behandlung, die uns sehr fremdartig klingt. Als Probe
will ich hier nur den Anfang seines achtstimmigen Stabat mater zitieren:
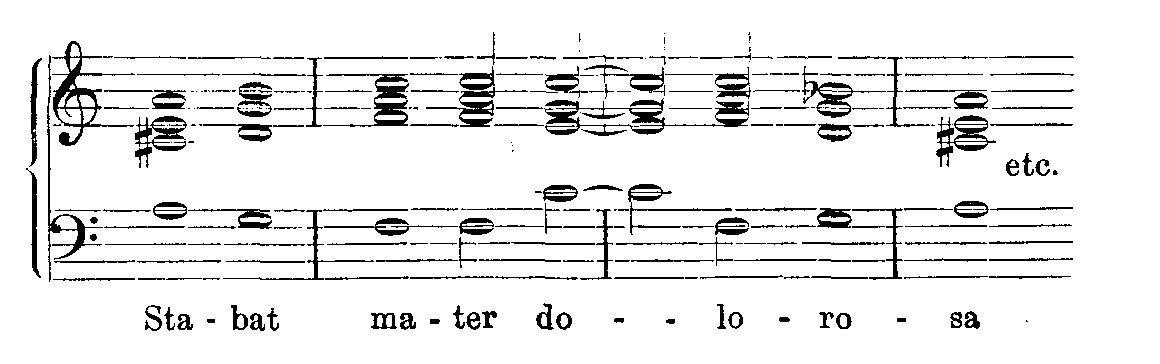
Hier finden wir gleich als Anfang eines Stücks, wo wir feste Bezeichnung
der Tonart verlangen würden, eine Reihe Akkorde aus den verschiedensten
Tonarten von A-Dur bis F-Dur anscheinend regellos durch einander gewürfelt,
gegen alle unsere Regeln der Modulation. Und wer würde ohne Kenntnis
der Kirchentonarten aus diesem Anfang die Tonica des Stückes erraten
können? Als solche erscheint am Ende der ersten Strophe D,
und auf das D weist auch die Erhöhung des C zu Cis
im ersten Akkorde hin, und die Hauptmelodie, welche der Tenor zu führen
hat, läßt von Anfang an D als Tonica erkennen. Aber erst
im achten Takte des Satzes erscheint ein D-Mollakkord, den ein moderner
Komponist auf den ersten guten Taktteil des ersten Taktes hätte setzen
müssen.
Es spricht sich in diesen Zügen sehr deutlich aus, wie abweichend
die Natur des ganzen Systems der Kirchentonarten von unseren modernen Tonarten
war, denn wir dürfen von Meistern wie Palestrina, sicher voraussetzen,
daß ihre Harmonisierung sich auf ein richtiges Gefühl für
das eigentümliche Wesen jener Tonarten gründete und nicht auf
Willkür und Ungeschick, um so mehr ihnen die Fortschritte, welche
inzwischen im protestantischen Kirchenliede gemacht waren, nicht unbekannt
sein konnten.
Was wir in solchen Beispielen, wie dies angeführte eines ist, vermissen,
ist erstens, daß der Akkord der Tonica nicht gleich im Anfang die
hervortretende Rolle spielt, die ihm in der modernen Musik zukommt. In
dieser hat der tonische Akkord unter den Akkorden eben dieselbe hervorragende
und verbindende Bedeutung wie unter den Tönen der Tonleiter die Tonica.
Zweitens vermissen wir überhaupt das Gefühl für die Verwandtschaft
der auf einander folgenden Akkorde, welches bewirkt, daß in der Regel
die moderne Musik nur Akkorde auf einander folgen läßt, welche
durch einen gemeinsamen Ton mit einander verbunden sind. Es hängt
dies offenbar damit zusammen, daß, wie wir später sehen werden,
in den alten Kirchentonarten nicht so eng unter sich und mit dem tonischen
Akkorde verbundene Akkordketten herzustellen sind, wie in der modernen
Dur- und Molltonart.
Wenn also auch bei Palestrina und Gabrieli sich schon
eine feine künstlerische Empfindung für die ästhetische
Wirkung der einzelnen verschiedenartigen Akkorde zu erkennen gibt, und
insofern die Harmonien bei ihnen schon ihre selbständige Bedeutung
haben, so fehlen doch noch diejenigen Erfindungen, welche den musikalischen
Zusammenhang des Akkordgewebes in sich selbst herstellen sollten. Diese
Aufgabe erforderte aber eine Beschränkung und Umformung der bisherigen
Tonleitern auf unser Dur und Moll. Andererseits ging durch diese Beschränkung
diejenige Mannigfaltigkeit des Ausdrucks größtenteils verloren,
welche auf der Verschiedenartigkeit der Tonleitern beruhte. Die alten Tonleitern
bilden teils Zwischenstufen zwischen Dur und Moll, teils steigern sie noch
den Charakter der Molltonart, wie die phrygische Kirchentonart. Diese Verschiedenheit
ging verloren und mußte durch neue Hilfsmittel ersetzt werden, nämlich
durch die Transposition der Tonleitern in verschiedene Grundtöne und
die modulatorischen Übergänge von einer zur anderen Tonart.
Diese Umbildung vollzog sich im Laufe des 17. Jahrhunderts. Den lebhaftesten
Anstoß aber erhielt die Ausbildung harmonischer Musik durch die beginnende
Entwickelung der Oper, welche angeregt war durch die erneute Bekanntschaft
mit dem klassischen Altertume, und geradezu unternommen wurde in der Absicht,
die antike Tragödie wieder herzustellen, von der man wußte,
daß sie musikalisch rezitiert worden sei. Hier drängte sich
unmittelbar die Aufgabe dem Komponisten auf, eine oder wenige Solostimmen
musikalische Sätze ausführen zu lassen, welche doch harmonisiert
sein mußten, um zwischen die polyphonisch bearbeiteten Chöre
hineinzupassen, und in denen die Singstimmen vor allen anderen heraustreten
die begleitenden Stimmen ganz untergeordnet gehalten werden mußten.
Dadurch ergab sich zunächst die Erfindung des Rezitativs durch Jacob
Peri und Caccini um 1600, und arioser Sologesänge durch
Claudio Monteverde und Viadana. In der Notenschrift kündet
sich die neue Betrachtungsweise der Harmonie dadurch an, daß bei
diesen Komponisten die bezifferten Basse erscheinen. Jede solche bezifferte
Baßnote repräsentiert einen Akkord, und es werden also die Akkorde
bezeichnet, während die Führung der Stimmen in diesen Akkorden
dem Geschmack des Spielers überlassen bleibt. Was also in der polyphonen
Musik Nebensache war, wird hier Hauptsache, und umgekehrt.
Die Oper machte es auch notwendig, nach stärkeren Ausdrucksmitteln
zu suchen, als die Kirchenmusik zugelassen hatte. Bei Monteverde,
welcher an neuen Erfindungen ungemein reich war, finden wir die Septimenakkorde
zuerst frei einsetzend, worüber er von seinem Zeitgenossen Artusi
heftig getadelt wird. Überhaupt entwickelt sich schnell ein kühnerer
Gebrauch der Dissonanzen, welche in selbständiger Bedeutung, um schärfere
Schattierungen des Ausdrucks zu erreichen, und nicht mehr als zufällige
Ergebnisse der Stimmführung eintreten.
Unter diesen Einflüssen begann denn auch schon bei Monteverde
die Umgestaltung und Verschmelzung der dorischen, äolischen und
phrygischen Kirchentonart in unsere moderne Molltonart, welche im Laufe
des siebenzehnten Jahrhunderts sich vollzog, wodurch auch diese Tonarten
für die Hervorhebung der Tonica in der Harmonisierung geschickter
gemacht wurden, wie wir dies später genauer begründen werden.
Wir haben der Hauptsache nach schon bezeichnet, welchen Einfluß
diese Änderungen auf die Natur des Tonsystems hatten. Da das bisherige
Bindemittel der musikalischen Sätze, nämlich die kanonische,
Wiederholung gleicher melodischer Figuren, überall wegfallen mußte,
wo eine der Melodie untergeordnete einfache harmonische Begleitung eintrat,
so mußte im Klange der Akkorde selbst ein neues Mittel künstlerischen
Zusammenhanges gesucht werden; dies ergab sich, indem man durch die Harmonisierung
einmal die Beziehungen der Töne zu der einen herrschenden Tonica viel
bestimmter konnte hervortreten lassen, als dies früher der Fall war,
und zweitens, indem man den Akkorden selbst durch ihre Verwandtschaft unter
einander und zum tonischen Akkorde ein neues Band gab. Wir werden im Fortgang
unserer Untersuchung sehen, daß sich aus diesem Prinzip die unterscheidenden
Eigentümlichkeiten des modernen Tonsystems herleiten lassen, und daß
dieses Prinzip mit großer Konsequenz in unserer jetzigen Musik durchgeführt
ist. In der Tat ist die Art, wie das Tonmaterial der Musik jetzt für
den künstlerischen Gebrauch zurecht gemacht ist, an sich schon ein
bewunderungswürdiges Kunstwerk, an welchem die Erfahrung, der Scharfsinn
und der künstlerische Geschmack der europäischen Nationen seit
Terpander und Pythagoras nun drittehalb Jahrtausende gearbeitet
haben. Die Ausbildung der wesentlichen Züge seiner jetzigen
Gestalt ist aber kaum 200 Jahre alt in der Praxis der Tonsetzer, und seinen
theoretischen Ausdruck erhielt das neue Prinzip erst durch Rameau im
Anlange des vorigen Jahrhunderts. In weltgeschichtlicher Beziehung ist
es also ganz und gar Produkt des neueren Zeitalters, national beschränkt
auf die germanischen, romanischen, keltischen und slawischen Völker.
Mit diesem Tonsysteme, welches großen Reichtum von Formen bei
fest geschlossener künstlerischer Konsequenz zuließ, ist es
nun möglich geworden, Kunstwerke zu schaffen, viel größer
an Umfang, viel reicher in Formen und Stimmen, viel energischer im Ausdrucke,
als irgend eine vorausgegangene Zeit produzieren konnte, und wir sind deshalb
gar nicht geneigt, mit den modernen Musikern zu rechten, wenn sie es für
das vorzüglichste von allen erklären, und ihm ihre Aufmerksamkeit
vor allen anderen ausschließlich zuwenden. In wissenschaftlicher
Beziehung dagegen, wenn wir daran gehen, seinen Bau zu erklären und
die Konsequenz desselben aufzudecken, dürfen wir nicht vergessen,
daß das moderne System nicht aus einer Naturnotwendigkeit entwickelt
ist, sondern aus einem frei gewählten Stilprinzip, daß neben
ihm und vor ihm andere Tonsysteme aus anderen Prinzipien entwickelt worden
sind, in deren jedem gewisse beschränktere Aufgaben der Kunst so gelöst
worden sind, daß der höchste Grad künstlerischer Schönheit
erreicht wurde.
Die Beziehung auf die Geschichte der Musik wird in der vorliegenden
Abteilung unseres Werkes auch deshalb nötig, weil wir hier Beobachtung
und Experiment zur Feststellung der von uns aufgestellten Erklärungen
meist nicht anwenden können, denn wir können uns, erzogen in
der modernen Musik, nicht vollständig zurückversetzen in den
Zustand unserer Vorfahren, die das Alles nicht kannten, was uns von Jugend
auf geläufig ist, und es erst zu suchen hatten. Die einzigen Beobachtungen
und Versuche also, auf die wir uns berufen können, sind diejenigen,
welche die Menschheit in ihrem Entwickelungsgange über musikalische
Dinge angestellt hat. Wenn unsere Theorie des modernen Tonsystems richtig
ist, muß. dieselbe auch die Erklärung für die früheren
unvollkommeneren Stadien der Entwickelung abgeben können.
Als Grundprinzip für die Entwickelung des europäischen Tonsystems
stellen wir die Forderung auf, daß die ganze Masse der Töne
und Harmonieverbindungen in enge und stets deutliche Verwandtschaft zu
einer frei gewählten Tonica zu setzen sei, daß aus dieser sich
die Tonmasse des ganzen Satzes entwickele und in sie wieder zurücklaufe.
Die antike Welt entwickelte dieses Prinzip an homophoner Musik, die
moderne an harmonischer. Dieses Prinzip ist aber, wie man sieht, ein ästhetisches,
kein natürliches.
Wir können seine Richtigkeit nicht von vorn herein erweisen, wir
müssen sie an seinen Konsequenzen prüfen. Auch ist die Entstehung
solcher ästhetischer Grundprinzipien nicht einer Naturnotwendigkeit
zuzuschreiben, sondern sie sind Produkte genialer Erfindung, wie wir vorher
an den Prinzipien der architektonischen Stilarten als Beispielen erläutert
haben.