![]()
Die absolute Empfindung ist, nach der Maßformel, der Unterschied zwischen absoluten Empfindungen, kurz Empfindungsunterschied, nach der Unterschiedsformel, der besonders aufgefaßte Empfindungsunterschied, kurz empfundene Unterschied, die Kontrastempfindung, nach der Unterschiedsmaßformel und deren Verallgemeinerungen, den Lagenformeln, zu beurteilen, und die hiernach bestimmte Kontrastwirkung zu der nach der Maßformel und darauf gestützten Summenformel (Kap. XX) bestimmten Summenwirkung zu fügen, um die psychische Gesamtwirkung zu haben.
Dies so zu fassen, werden wir durch die Tatsache genötigt, daß überall, wo die Gleichförmigkeit eines Reizes stellenweise oder zeitweise durch eine Verminderung, Zessation, Intermission desselben unterbrochen wird, die Seele sich stärker erregt findet, als wenn der Reiz gleichförmig sich durch Raum oder Zeit forterstreckte. Da nun doch durch die stellen- oder zeitweise Verminderung oder Zessation des Reizes die Summe der davon abhängigen absoluten Empfindungen gegen den Fall abnimmt, daß der Reiz kontinuierlich fortwirkte, so muß die verstärkte Wirkung in der Seele auf einer Wirkung des Kontrastes beruhen, welche nicht mit der Summenwirkung der Reize zusammenfällt oder darin aufgeht.
Die Rücksicht auf die hebende Wirkung des Kontrastes (Kap. 24) ändert nichts in dieser Hinsicht; weil durch sie die Summe absoluter Empfindungen im Ganzen keinen Zuwachs erfährt. Wenn das Weiß durch Kontrast mit Schwarz an Helligkeit wächst, so nimmt das Schwarz hingegen zugleich an Helligkeit ab, ja ich werde künftig2) erfahrungsmäßig dartun und erklären, daß und warum die Vertiefung des Schwarz durch die Kontrastwirkung im Allgemeinen spürbarer ist, als die Erhellung des Weiß. Insofern also eine Hebung der Eindrücke durch den Kontrast stattfindet, verstärkt sich hierdurch nur die Empfindung des Unterschiedes, die zur Summenwirkung zu fügen ist, wird aber nicht hierdurch erst begründet, und die Summe absoluter Empfindungen gewinnt nichts dadurch.
Wenn man einmal eine ganze weiße Papierfläche, das andere mal eine solche mit einer schwarzen Scheibe inmitten in das Auge faßt, so ist die Summe der absoluten Lichteindrücke wie Lichtempfindungen zweitenfalls kleiner als erstenfalls; aber die Seele findet sich vermöge des zutretenden Kontrastes zweitenfalls stärker als erstenfalls affiziert, um so mehr, wenn man gar ein Papier mit mehrfachen Abwechselungen von Weiß und Schwarz, wie z. B. ein Schachbrettmuster, betrachtet, wenn schon die Summe der absoluten Lichteindrücke hier noch mehr vermindert ist, da sich dafür die Kontrastwirkung vervielfacht.
Auf mein sehr empfindliches Auge machen einzelne helle Sonnenflecke in der Stube einen so starken Eindruck, daß ich sie nicht wohl vertrage, aber ich kann im vollen Sonnenscheine auf der Straße und selbst durch Schnee gehen oder in den hellen Himmel sehen, ohne es lästig zu fühlen; ungeachtet doch hierbei die ganze Netzhaut mit derselben oder größeren Intensität gereizt ist, als erstenfalls eine begrenzte Stelle.
Eine plötzliche Pause in einer rauschenden Musik oder ein plötzlicher Paukenschlag nach einer Pause macht einen Eindruck, der nicht bloß als Summe der Eindrücke der Komponenten zu erklären ist, da vielmehr erstenfalls die Wirkung der einen Komponente abgebrochen wird, letztenfalls der Eindruck im Momente des eintretenden Schlages unvergleichlich stärker, als in jedem Momente des fortgehenden Paukenwirbels ist. Nun könnte man zwar letzteres daraus erklären, daß der erste Paukenschlag einer frischen Empfindlichkeit begegnet, die sich bei fortgesetztem Wirbel mehr und mehr abstumpft; und unstreitig hängt auch hieran etwas; aber derselbe Umstand kann erstenfalls nicht geltend gemacht werden, und bedingt daher auch unstreitig zweitenfalls nicht den Haupteffekt.
Manche scheinbare Anomalien erklären sich durch die doppelte Bestimmungsweise der Seele respektiv durch absolute und Kontrasteindrücke.
schwächere Lichtempfindung als Grau, und macht doch einen stärkeren Eindruck in der Seele als Grau. Wie reimt sich dieses? Man unterscheide die absolute Lichtempfindung des Schwarz von der Kontrastempfindung seines Unterschiedes gegen die vorausgegangene, die umgebende oder die mittlere Helligkeit, die wir in Erinnerung haben. Absolut genommen bleibt immer Schwarz eine positive Lichtempfindung, und wir werden das auch zugestehen, wenn wir es gegen das Nichtssehen des Fingers halten; und eine schwächere Lichtempfindung als Grau, was wir nicht minder zugestehen werden. Aber der Unterschied des Schwarz von der mittleren Helligkeit ist größer, als der des Grau, was sogar ganz damit zusammenfallen kann; und diese größere Differenz macht einen größeren Eindruck ihrer Art in der Seele.
Mit der Kälte ist es anders als mit dem Schwarz, und es findet nur Analogie, nicht Gleichheit beider Fälle statt. Indes die absolute Stärke der Lichtempfindung mit Verminde-rung des Lichtreizes entschieden durch alle Grade der Vertiefung des Schwarz abnimmt, und bloß der Contrasteindruck sich verstärkt, wächst dagegen die Empfindung von einem Punkte, wo wir es weder warm noch kalt finden, absolut mit zunehmender Kälte; und es kann uns starke Kälte eben so stark, nur ganz anders sinnlich affizieren, als starke Hitze. Dies hindert aber nicht, daß sich im Gebiete der Temperaturempfindungen eben so wohl auch Kontrastein-drücke von demselben Charakter geltend machen, als im Gebiete der Lichtempfindung. Und so kann uns eine warme Temperatur kühl gegen eine wärmere und eine kalte warm gegen eine kältere erscheinen.
Für den ersten Anblick scheint es, daß das Prinzip, die nach der Unterschiedsmaßformel oder Lagenformel berechnete Kontrastempfindung zu der Summe der nach der Maßformel berechneten absoluten Empfindungen zu fügen, um die Totalwirkung der Reize zu haben, der Erfahrung nicht genügt, sofern sich die Tatsache danach nicht folgern läßt, daß man durch Kontrast zwischen einem stärkeren und schwächeren Reize eine stärkere psychische Gesamtleistung erzielen kann, als wenn beide Reize dem stärkeren gleich wären. Denn die auf die Maßformel gegründete Summenformel gibt für zwei Reize b, b ' mit den Schwellenwerten b, b' die Empfindungssumme
![]()
Die Unterschiedsmaßformel oder Lagenformel gibt für den empfundenen Unterschied
![]() ,
,
unter Stellung des größeren Reizes in den Zähler 3), wobei v stets größer als 1 ist, so lange wir mit keinen verkehrten Empfindungen (Kap. 27) zu tun haben. Addieren wir nun beide Ausdrücke, so erhalten wir
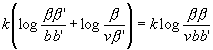 ,
,
wogegen der Wert, welchen man durch die bloße Summenformel für den Fall erhält, daß beide Reize dem größeren b gleich sind, ist
![]() .
.
Dieser Wert aber ist größer als ![]() ,
sofern v größer als 1 ist.
,
sofern v größer als 1 ist.
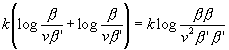
mithin im Ganzen
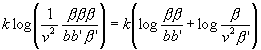
Das heißt, die totale psychische
Leistung, die durch den Zutritt des Kontrastes zur Summenwirkung erzielt
wird, ist um ![]() stärker, als die, welche man durch die bloße Summenformel für
den Fall erhält; daß beide Reize dem stärkeren bgleich
sind.
stärker, als die, welche man durch die bloße Summenformel für
den Fall erhält; daß beide Reize dem stärkeren bgleich
sind.
Es wird nützlich sein, zu bemerken, daß wir
dadurch, daß wir hier den empfundenen Unterschied 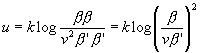 setzen,
indes wir in dem Kapitel über die Unterschiedsmaßformel und
Lagenformeln
setzen,
indes wir in dem Kapitel über die Unterschiedsmaßformel und
Lagenformeln ![]() setzten, nichts Widersprechendes setzen, indem wir den früheren Wert
setzten, nichts Widersprechendes setzen, indem wir den früheren Wert ![]() eben
nur als den einseitig aufgefaßten Unterschied anzusehen, oder dem
k
jener Formeln den doppelten Wert als dem k der Maßformel beizulegen
nötig haben. In der Tat unterscheiden sich die Ausdrücke
eben
nur als den einseitig aufgefaßten Unterschied anzusehen, oder dem
k
jener Formeln den doppelten Wert als dem k der Maßformel beizulegen
nötig haben. In der Tat unterscheiden sich die Ausdrücke ![]() und
und  nur
dadurch, daß der eine Ausdruck das Doppelte des anderen ist, da
nur
dadurch, daß der eine Ausdruck das Doppelte des anderen ist, da  =
2
=
2 ![]() ist,
wonach es ganz gleichgültig ist, ob wir den einen oder anderen verwenden,
so lange wir bloß mit dem Vergleiche empfundener Unterschiede unter
einander zu tun haben, ohne sie in Bezug zur Summenwirkung zu betrachten,
da sich die Verhältnisse der empfundenen Unterschiede nicht ändern,
mögen wir sie durch den einen oder anderen Ausdruck messen. Eben deshalb
ließ sich auch bei unserer Aufstellung der Unterschiedsmaßformel
und Lagenformeln kein Bestimmungsgrund finden, die zweiseitige von der
einseitigen Auffassung des Kontrastes vorzuziehen. Ein solcher liegt nun
aber in der angeführten Tatsache, welche die Verbindung der Summen-
und Kontrastwirkung betrifft, und es ist daher dieser Tatsache eine fundamentale
Bedeutung beizulegen.
ist,
wonach es ganz gleichgültig ist, ob wir den einen oder anderen verwenden,
so lange wir bloß mit dem Vergleiche empfundener Unterschiede unter
einander zu tun haben, ohne sie in Bezug zur Summenwirkung zu betrachten,
da sich die Verhältnisse der empfundenen Unterschiede nicht ändern,
mögen wir sie durch den einen oder anderen Ausdruck messen. Eben deshalb
ließ sich auch bei unserer Aufstellung der Unterschiedsmaßformel
und Lagenformeln kein Bestimmungsgrund finden, die zweiseitige von der
einseitigen Auffassung des Kontrastes vorzuziehen. Ein solcher liegt nun
aber in der angeführten Tatsache, welche die Verbindung der Summen-
und Kontrastwirkung betrifft, und es ist daher dieser Tatsache eine fundamentale
Bedeutung beizulegen.
So wie Empfindungen über der Schwelle
und unter der Schwelle nach früherer Auseinandersetzung nicht zu addieren,
sondern besonders in Betracht zu nehmen sind, sofern sie als besondere
bestehen, kann man auch in dem Falle, wo der empfundene Unterschied unter
die Schwelle fällt, sei es, daß v zu groß oder ![]() zu klein wird, von der Kombinationsformel der Summen- und Kontrastempfindung
keinen Gebrauch mehr machen, sondern, wo ein solcher Fall eintritt, bedeutet
es, daß der jetzt nicht empfundene Unterschied nichts zum Bewußtseinszustande
mehr beiträgt, und es bleibt
zu klein wird, von der Kombinationsformel der Summen- und Kontrastempfindung
keinen Gebrauch mehr machen, sondern, wo ein solcher Fall eintritt, bedeutet
es, daß der jetzt nicht empfundene Unterschied nichts zum Bewußtseinszustande
mehr beiträgt, und es bleibt ![]() allein noch übrig, die positive Empfindung zu repräsentieren.
allein noch übrig, die positive Empfindung zu repräsentieren.
Eine Folge davon ist, daß, wenn ein Reiz sich kontinuierlich in Raum oder Zeit ändert, die Kontrastwirkung zwischen einander nahen Punkten vernachlässigt werden kann, und daß die Totalwirkung sich da, wo die Änderung nicht zu rasch erfolgt, überhaupt auf die Summenwirkung reduziert, indem sie dann auch zwischen fernen Punkten zu vernachlässigen ist, was von Wichtigkeit ist, wenn man den Versuch macht, Empfindungen als Funktion elementarer Bewegungen oder Änderungen mittelst der im Kap. 16 gegebenen Formeln zu konstruieren.
Wenn wir früher das Resultat erhielten, daß ein Reiz bei gleichförmigster Verteilung über der Schwelle das Maximum der Empfindungssumme gewährt, so geht aus Vorigem hervor, daß er damit doch nicht das Maximum der Empfindungsleistung gewährt, sofern bei so ungleichförmiger Verteilung, daß ein Kontrast sich geltend machen kann, der Kontrast eine neue Empfindungsleistung zur Empfindungssumme fügt.
Wir haben im Vorigen die Betrachtung auf den einfachsten Fall beschränkt, daß man mit bloß zwei unterschiedenen Reizen zu tun hat, was genügte, die Verhältnisse im Allgemeinen übersehen zu lassen, welche für die Verbindung der Kontrastwirkung mit der Summenwirkung gelten. Eine weitere Frage ist, wie die Verhältnisse der Gesamtwirkung da zu beurteilen sind, wo sich Kontrastwirkungen zwischen mehr als zwei Reizen geltend machen; wo es also gilt, außer den absoluten Empfindungen auch Kontrastempfindungen zu summieren. Da es hier z. B. bei drei Reizen b, b ', b " nicht bloß den Kontrast von b: b ' und b' : b '', sondern auch von b: b " gilt, und bei n Reizen überhaupt die Zahl der solchergestalt in Betracht zu ziehenden Verhältnisse n(n - 1) ist, falls wir jedes Verhältnis herüber und hinüber, also doppelt, rechnen (sonst halb so groß), so fragt sich, wie die Summation hierbei zu bewirken ist. Hiefür liegt mir bis jetzt kein ganz evidentes Prinzip vor; doch vermute ich, das folgende werde maßgebend sein, da es rationell und mit der Erfahrung verträglich scheint.
Da keines jener Verhältnisse vor
dem anderen einen anderen Vorrang betreffs der Empfindung hat, als der
durch die Verhältnisschwelle gegeben ist, so wird man zuvörderst
alle empfundenen Unterschiede zu summieren haben, die den n(n
- 1) Verhältnissen einzeln zugehören. Diese Summe werde durch
å ausgedrückt. Nun sind aber nur
n Zeit- oder Raumpunkte vorhanden, auf welche die Empfindung fällt,
oder weiche zur Empfindung beitragen; mithin wird jene Summe im Verhältnisse ![]() zu reduzieren sein, d. i. n – 1 zu dividieren sein; mithin den Wert
haben
zu reduzieren sein, d. i. n – 1 zu dividieren sein; mithin den Wert
haben ![]() .
Führen wir dies für drei Reize, b,
b ', b ", nach
absteigender Ordnung der Größe genommen, aus, und geben k
den doppelten Wert gegen das k der Maßformel, um jedes Verhältnis
bloß einfach einzuführen, so haben wir
.
Führen wir dies für drei Reize, b,
b ', b ", nach
absteigender Ordnung der Größe genommen, aus, und geben k
den doppelten Wert gegen das k der Maßformel, um jedes Verhältnis
bloß einfach einzuführen, so haben wir
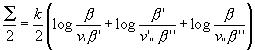
wenn v,, v'", v" die den drei Verhältnissen zugehörigen Verhältnisschwellen sind, deren Indizes den Indizes der Reize, wofür sie gelten, entsprechend genommen sind. Diese Schwellen können unter Umständen gleich 1 gesetzt, und unter Umständen als gleich angenommen werden, so bei drei Lichtern, die auf einem gleichförmigen Grunde die Spitzen eines gleichseitigen Dreiecks bilden. Im allgemeinen Falle aber sind v,, v'", v" als verschieden von 1 und von einander anzunehmen. Gleichviel, welche Werte sie haben, so geht durch Verwandlung der Summe der Logarithmen in den Logarithmus des Produktes obiger Ausdruck über in
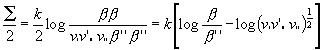
Nun wäre ohne Zufügung des mittleren Reizes b' der empfundene Unterschied gewesen
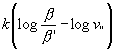
was in dem Falle, daß v, v'" = v", mit dem obigen Ausdrucke übereinkommt; wonach bei drei Reizen, deren Verhältnisschwellen dies Verhältnis haben, die Kontrastsumme eben so groß wäre, als bei zweien ohne Zufügung des mittleren. Wo hingegen alle drei Schwellen gleich sind, wozu es, wie oben bemerkt, Beispiele gibt, ist die Kontrastsumme bei drei Reizen kleiner, als zwischen den zwei extremen für sich.
Geht man zu 4 Reizen über, nennt sie nach absteigender Ordnung der Größe b, b ', b ", b "', und das Produkt der 6 Schwellen, die hier in Betracht kommen, w, so verschwinden die mittleren Reize nicht mehr aus dem Ausdrucke der Kontrastsumme und wir erhalten dafür
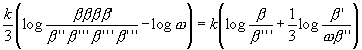
Bei etwa versuchter Anwendung dieser Formeln ist in Rücksicht zu ziehen, daß man, wo es sich z. B. um die Kontrastsumme handelt, welche Sterne am Himmel gewähren, nicht bloß den Kontrast der Sterne gegen einander, sondern auch vom schwarzen Himmelsgrunde in Betracht zu ziehen hat, der hierbei unstreitig die Hauptwirkung gewährt.
Wenn Lichtpunkte zu Lichtflächen zusammenfließen, so mindert sich notwendig ihre Kontrastsumme gegen den Grund, weil die stärkste Kontrastwirkung, mithin kleinste Verhältnisschwelle, unstreitig zwischen jedem Lichtpunkte und dem nächsten Teile des schwarzen Grundes besteht, welcher aber für die im Innern einer Lichtfläche liegenden Punkte durch gleiche Lichtpunkte ersetzt ist. Überhaupt muß hiernach die Verteilungsweise der kontrastierenden Reize gegen einander großen Einfluß auf die Kontrastsumme gewinnen.
Auf weitere Ausführungen und Rechnungen will ich jedoch hier nicht eingehen, da zuzugestehen bleibt, daß das hier zu Grunde gelegte Rechnungsprinzip weder a priori, noch durch Erfahrung bis jetzt hinreichend sicher gestellt ist.
Nicht ohne Interesse ist, daß der Himmel, der uns schon früher die schönsten und einfachsten Belege zu den Fundamentaltatsachen und Gesetzen der Psychophysik geliefert hat, auch das schönste und einfachste Beispiel sowohl für eine Summen- als Kontrastwirkung liefert. In der Tat werden wir keine reinere zugleich und erhabenere Summenwirkung der Empfindung ohne Kontrast erhalten können, als durch einen rein blauen Tageshimmel, und keine einfachere und erhabenere Kontrastwirkung, als durch einen sternenhellen Nachthimmel. Dazu gibt der Wechsel von Wolken, Morgen- und Abendröte auch einen unerschöpflichen Wechsel von Kontrasten, die sich in der Zeit entwickeln.